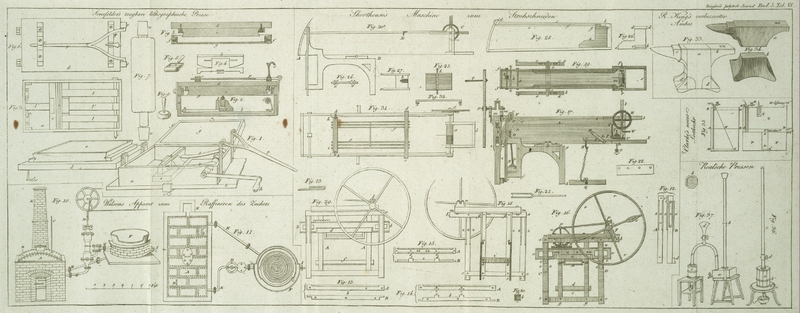| Titel: | Erklärung des dem Samuel Shorthouse, Gentleman zu Dudley in Gloucestershire ertheilten Patentes auf eine Maschine, welche Stroh in beliebiger Länge schneidet, wodurch dasselbe zugleich ein besseres und brauchbareres Futter für Hornvieh, und der dadurch erzeugte Dünger zum unmittelbaren Gebrauche geschikt wird; auch auf die Weise, das trokene Stroh zum bequemen Dünger zu machen; ferner auf die Weise, das Stroh zu schneiden, damit es mit dem Kernfutter für Pferde gemengt werden kann; endlich auf die Weise Stroh in jeder gegebenen Länge zu irgend einem Zweke zu schneiden. Dd. 4. November 1819. |
| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. XLVII., S. 269 |
| Download: | XML |
XLVII.
Erklärung des dem Samuel Shorthouse, Gentleman zu Dudley in Gloucestershire ertheilten Patentes auf eine Maschine, welche Stroh in beliebiger Länge schneidet, wodurch dasselbe zugleich
ein besseres und brauchbareres Futter für Hornvieh, und der dadurch erzeugte Dünger zum unmittelbaren Gebrauche geschikt wird;
auch auf die Weise, das trokene Stroh zum bequemen Dünger zu machen; ferner auf die Weise, das Stroh zu schneiden, damit es
mit dem Kernfutter für Pferde gemengt werden kann; endlich auf die Weise Stroh in jeder gegebenen Länge zu irgend einem Zweke
zu schneiden. Dd. 4. November 1819.
Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. II. Series. N. CCXXVIII. Mai 1821. S. 1.
Mit Abbildungen auf Tab. VI.
Shorthouse's verbesserte Strohschneidemaschine.
Ich erklaͤre, daß meine Erfindung in Folgendem besteht:
das Gestell derselben besteht großen Theils aus gegossenem Eisen, aus zwei
Saͤulen, zwei Traͤgern, einem Verbindungs-Stuͤke und
zwei Ekstuͤken.
Fig. 12. Tab.
VI. stellt eine der beiden Saͤulen vor: A von
vorne, B von der Seite.
Fig. 13. ist
der vordere Traͤger, A zeigt denselben von vorne,
und B in der horizontalen Ansicht.
Fig. 14. ist
der hintere Traͤger, A zeigt ihn von der hinteren
Seite, und B ist eine horizontale Ansicht desselben.
Fig. 15. ist
das Verbindungsstuͤk, wovon A die Ansicht von
ruͤkwaͤrts, und B die horizontale ist.
Fig. 16.
zeigt die ganze Maschine im Aufrisse von vorne, und Fig. 17. von der
Seite.
Fig. 18.
zeigt das Gestell von ruͤkwaͤrts und Fig. 19. ist ein
horizontal Plan der Strohlade etc.
Die zwei Traͤger, Fig. 13. und 14. sind mit
Schraubenstiften an dem oberen Ende der Saͤulen befestigt, wie man bei a und E in Fig. 16. sieht, wo ab der vordere Traͤger ist; in Fig. 18. ist
ab der hintere Traͤger, so daß die
beiden Traͤger einander gegenuͤber stehen, waͤhrend die oberen
Enden der Saͤulen CD, Fig. 16. zwischen
denselben liegen. Jede Saͤule hat einen Vorsprung vorne an dem oberen Theile
derselben, wie in c, Fig. 12. wodurch der
vordere Traͤger vorwaͤrts kommt, und ein groͤßerer Raum
zwischen den Traͤgern erhalten wird. Jede Saͤule hat auch an dem
unteren Theile derselben einen Vorsprung, wie bei d,
Fig. 12.
woran das Verbindungsstuͤk Fig. 15. mit
Schraubenstiften, die durch die Saͤule gehen, wie ee in Fig. 16. und cc in Fig. 17. befestigt ist.
Der Traͤger Fig. 14. und das Verbindungsstuͤk Fig. 15. haben jeder zwei
Vorspruͤnge oder Ohren, wie cc
Fig. 14, und
dd
Fig. 15. auch
aa
Fig. 17.
Eines der vorerwaͤhnten Ekstuͤke des Gestelles ist in Fig. 17. durch cdefgh dargestellt. Die unteren Erden dieser
beiden Ekstuͤke sind gegen die Vorspruͤnge oder Ohren des
Verbindungsstuͤkes gestellt, und an denselben mit Schraubenstiften befestigt,
wie gg in Fig. 16. und e in Fig. 17. auch ee in Fig. 18. Die oberen Enden
der Ekstuͤke legen sich an die correspondirenden Ohren der Traͤger
Fig. 14.
und sind daran mit Schraubenstiften befestigt, wie bei c
Fig. 17. und
gg
Fig. 18. die
beiden Ekstuͤke stehen also parallel mit einander und in rechtwinkeliger Richtung mit den beiden
Saͤulen CD, Fig. 16. Ein vierekiger
Fluͤgel oder eine hervorstehende Rippe ist an jedem Ekstuͤke
angebracht zwischen g und h,
Fig. 17.
wie Fig. 18.
kk zeigt. Ein Stuͤk Holz oder Eisen ist
an diese Fluͤgel mit Stiften befestigt, und dient zur Verbindung der beiden
Ekstuͤke, wie i, Fig. 18. kleine Ribben
oder Vorspraͤnge befinden sich noch uͤberdieß an den Saͤulen,
an dem Verbindungsstuͤke und an den Ekstuͤken, um sie dadurch
staͤrker zu machen, wie zzzz in Fig. 12, 15, 16, 17 und 18.
Jeder der oben erwaͤhnten Vorspruͤnge oder jedes Ohr besteht aus zwei
Hervorragungen, welche einen Trog bilden, und ein Stuͤk Holz zur
Ausfuͤllung des Raumes zwischen denselben aufnehmen, wie Fig. 20. zeigt, welches
einen Durchschnitt durch das Holz u und das Eisen
darstellt: cc sind die eisernen Hervorragungen und
b ist das Holz. Das obere Ende der beiden
Traͤger Fig.
13 und 14. hat einen Fluͤgel, oder eine Rippe, wie b zeigt in Fig. 13. und b in Fig. 14. Diese
Fluͤgel oder Rippen bilden horizontale Flaͤchen an den
Traͤgern, welche dazu dienen, zwei Mittelstuͤke aus Holz zu tragen,
welche mit Schraubenstiften befestigt sind, wie mm
in Fig. 16.
mm, Fig. 18. und mm, Fig. 17. n, Fig. 16. ist ein Rad mit
Zaͤhnen an seinem unteren Umkreise. o
Fig. 16. und
o
Fig. 17. sind
zwei Ansichten eines Kniees; dieses Rad und das Knie arbeiten zwischen den zwei
Traͤgern ab, Fig. 16. und ab, Fig. 18. und werden von
denselben getragen: die Laͤufe des Knies und der Spindel des Rades sind in
den hoͤlzernen Mittelstuͤken mm,
Fig. 16.
und mm, Fig. 18.
eingefuͤgt. Der Mittelpunkt des Kniees ist erhoben, damit er Spielraum
gewinnt, wie in n, Fig. 18. und in q, Fig. 16. Das Knie o und das Rad n, Fig. 16. sind
mittelst einer eisernen Stange, wie pp zeigt,
durch bewegliche Gelenke pp verbunden.
Fig. 21. ist
ein horizontaler Aufriß der Stange pp. Das Ende
der Spindel des Kniees bei q, Fig. 16. ist mit einem
Flugrade, rrr versehen: die Verbindung dieses
Rades mit dem Kniee ist noch deutlicher bei p, Fig. 17. zu
sehen. Der Griff q in Fig. 17. dient zum
Treiben der Maschine, und kann in irgend eines der Loͤcher s, Fig. 16. gestekt werden.
Durch jede der beiden Saͤulen CD, Fig. 16.
laͤuft eine laͤngliche Oeffnung, ee
in Fig. 12.
und ss in Fig. 17. in die
laͤngliche Oeffnung der Saͤule D kommen
zwei Walzen, und eine in jene von C, wie die punktirten
Kreise ttu, Fig. 16. und von der
Seite in ss, Fig. 17. zeigen. Ein
Balken von gegossenem Eisen vv, Fig. 16. geht durch die
Oeffnungen in beiden Saͤulen, und ruht auf den Walzen tt. Der Balken vv hat auf jeder Seite an der oberen und unteren Kante kleine
Fluͤgel oder Rippen, welche bis an die Seiten der Oeffnungen in den
Saͤulen reichen, in welche er eingesezt ist, aber Spielraum genug geben, um
denselben frei arbeiten zu lassen, wie in ss, Fig. 17. x in Fig. 16. ist das Messer,
welches in Fig.
22. noch deutlicher dargestellt ist. Der Ruͤken des Balkens vv ist von w zu w schief abgedacht oder allmaͤhlig duͤnner
werdend, wie t in Fig. 17. zeigt. Das
Messer ist an der schief abgedachten Seite des Balkens angebracht, und mit
Schraubenstiften daran befestigt, wodurch die Schneide des Messers schief gegen die
Vorderseite der Strohlade geneigt wird, gegen welche sie arbeitet.
Oben an dem Balken befindet sich ein Reker y, Fig. 16. in
dessen Zaͤhne die Zaͤhne an der unteren Seite des Rades n eingreifen. Wenn das Schwungrad mittelst des Griffes
q gedreht wird, so bewegt dasselbe den Balken vv ruͤk- und vorwaͤrts auf
den Rollen tt, und sezt so das Messer in Bewegung:
die Rolle u verwahrt den Balken vor dem Aufsteigen, wenn
das Stroh gegen die Schneide des Messers druͤkt. A, Fig.
17. ist ein Seitenaufriß der Strohlade, oder der Trog, in welchem das zu
schneidende Stroh liegt, und Fig. 19. ist ein
horizontaler Aufriß derselben. Ein Fluͤgel oder eine Rippe befindet sich an
der inneren Seite eines jeden Ekstuͤkes von z bis
g. Fig. 17. wie es in aa und bb, Fig. 19. und
in oo, Fig. 18. dargestellt ist.
Auf jedem dieser Fluͤgel befindet sich ein Mittelstuͤk von Holz, das
durchlaufende Einschnitte besizt, wie vv, Fig. 17. und
cc und dd,
Fig. 19.
Diese Mittelstuͤke sind an den Fluͤgeln mit Schraubenstiften
befestigt, und werden gelegentlich vor- und ruͤkwaͤrts bewegt,
um die Vorderseite der Strohlade dem Messer anzupassen. Ein Laͤufer oder eine
Achse, w, Fig. 17. ist an dem Boden
der Strohlade mittelst Schraubenstiften befestigt: ee, Fig.
19. stellt dasselbe vor. Da die Enden dieser Achse sich in den
Mittelstuͤken cc, dd, Fig. 19. bewegen, so wird
die Strohlade ein Hebel, der von den beiden Ekstuͤken des Geruͤstes
gestuͤzt wird, und zwischen denselben arbeitet.
Das Vordertheil der Lade ist mit einer Vorderseite von Eisen, Stahl, oder
gehaͤrtetem Eisen versehen, und an den Seiten kreisfoͤrmig, wie cats, Fig. 17. zeigt; der Boden
ist, wie ff in Fig. 19. ausweiset, und
A in Fig. 16. gerade Die
innere Kante des Bodens ist abgefeilt, um zu vermeiden, daß das Messer nicht auf
dieselbe auffaͤllt: die kreisfoͤrmige Kruͤmmung der Seiten ist
von der Achse w, Fig. 17. als von dem
Mittelpunkte aus, beschrieben. Ein kreisfoͤrmiger, mit Eisen
ausgefuͤtterter, Einschnitt, dessen Mittelpunkt gleichfalls die Achse w ist, Fig. 17. ist durch jede
Seite der Lade geschnitten, wie x in Fig. 17. zeigt. Die Lade
wird zwischen den vorderen Ekstuͤken durch ein Stuͤk Holz, welches an
jeder Seite derselben, wie bei HH, Fig. 16. befestigt ist,
geleitet. Eine Platte, oder ein laͤngliches Stuͤk gegossenes Eisen,
welches als Drukgewicht dient, ist unter der Lade angebracht, und seine Enden ruhen
in den Oeffnungen der Ekstuͤke: diese Oeffnungen koͤnnen von
beliebiger Hoͤhe und Weite seyn, je nachdem das Drukgewicht dik und breit ist; ein
Ende dieses Drukgewichtes sieht man bei b, Fig. 17. wo es
in der Oeffnung y ruht, und seine Laͤnge ist mit
d, Fig. 16. bezeichnet.
Am Grunde dieses Drukgewichtes kann ein Brett befestigt werden, wie c, Fig. 16. Fig. 25. zeigt ein
Drukbrett, mit einem quer durch dasselbe oben hin laufenden Stifte h, welchen man auch in h,
Fig. 19.
sieht. Dieses Drukbrett hat einen durch dasselbe laufenden Durchschnitt, welcher mit
seiner Oberflaͤche parallel ist, wie Fig. 23. als
Seitendurchschnitt desselben zeigt. Das Drukbrett ist hinter der Vorderseite der
Lade bei B, Fig. 17. und der Stift
g, Fig. 19. laͤuft
durch Loͤcher an den Seiten der Lade, und durch den Einschnitt in dem
Drukbrette, wie bei C, Fig. 17. und die Enden
des anderen Stiftes h, Fig. 19. laufen durch die
kreisfoͤrmigen Einschnitte x, Fig. 17. an den Seiten
der Lade. Zwei eiserne Stangen, wovon eine in DE,
Fig. 17.
dargestellt ist, befinden sich zu jeder Seite des Stiftes h, Fig.
19. (an jeder Seite der Lade naͤmlich einer), und das untere Ende
dieser Stangen ist an das Drukgewicht, mittelst beweglicher Gelenke an beiden Enden,
wie D und E, Fig. 17. befestigt.
Quer uͤber dem oberen Theile der Lade (in beliebiger Lage uͤber dem
Drukgewichte) ist ein Stift befestigt, an welchem sich eine Rolle dreht, wie F, Fig. 17. und K in Fig. 19. Eine Walze an
einer Spindel (welche Spindel in Fig. 24. dargestellt ist)
ist oben auf der Lade bei G, Fig. 17. quer
uͤbergelegt, und noch deutlicher bei m, Fig. 19.
dargestellt. Da die Laͤufe aa, Fig. 24. quer
uͤber die Lade in die Loͤcher derselben als ihre Mittelpunkte der
Bewegung zu liegen kommen, wie oo, in Fig. 19.
zeigt, so ragen die Enden der Spindel aus den Seiten der Lade hervor, wie pp zeigt. An einem Ende dieser Spindel ist das
Stellrad H, Fig. 17, befestigt, und an dem anderen Ende sind die
vier Griffe IIII
Fig. 17.
angebracht. L
Fig. 17. ist
ein Balken, der sich an dem Stifte S, Fig. 17. dreht, und von
der Eisenplatte M geleitet wird. An dem einen Ende
dieses Balkens ist der Haken N befestigt, an welchem
eine Kette aufgehaͤngt ist, deren unteres Ende an dem Gewichte Q angebracht ist. Der Treibhaken T ist an dem Balken bei P eingefuͤgt,
so daß er sich um einen Stift dreht, und an demselben Stifte, (welcher durch den
Balken laͤuft) ist der Wagbalken U, dessen oberes
Ende hinter den Treibhaken T, bei P, gekehrt ist, und dazu dient, das obere Ende des Treibhakens gegen das
Stellrad anzudruͤken. W ist ein Faͤnger
oder ein Stellhaken. Das Ende des Balkens L ruht auf dem
Stuͤke R, welches mit Stiften an der Seite der
Lade befestiget ist. Das Stuͤk R hat einen durch
dasselbe laufenden Einschnitt, wie n in Fig. 19. zeigt. Durch den
Balken V, Fig. 17. laͤuft
ein Loch, uͤber welchem eine eiserne Schraubenmutter befestigt ist; der Stift
O, welcher durch den Einschnitt n in dem Stuͤke R und
durch das in dem Balken unmittelbar uͤber demselben befindliche Loch
laͤuft, wird durch die weibliche Schraube gedreht, und mittelst eines Knopfes
oder einer Nuß an seinem oberen Ende, wie v in Fig. 17. in
jeder verlangten Lage befestigt. Der Stift O ist mit
einem runden Kopfe versehen, und hat einen Waͤscher an demselben; auch ist er
mit einem kleinen gekruͤmmten Stifte, der an seinem Kopfe befestigt ist, und
als Handhabe beim Drehen desselben dient, ausgeruͤstet. Der Schieber ist eine
Art von hohler Lade, von welcher Fig. 26. ein
Seitendurchschnitt ist, und Fig. 27. der horizontale
Grundriß derselben. Dieser Schieber ist innenwendig in der Strohlade angebracht, und
muß Spielraum genug erhalten, um mit Leichtigkeit in derselben fortgeschoben werden
zu koͤnnen: er hat, wie man bei aa, Fig. 27.
sieht, zwei Fuͤße: eine Seitenansicht des einen dieser Fuͤße sieht
man bei ab, Fig. 26. Der Boden dieses
Schiebers ist uͤber dem Grunde seiner Fuͤße, wie man bei cb, Fig. 26. sieht, und
dadurch erhaͤlt man einen kleinen Raum zwischen dem Boden der Lade und dem
Boden des Schiebers. Oben an dem Schieber ist ein Loch b, Fig.
27. angebracht, welches auf einem Stuͤke Holzes aufgesezt ist. Oben
an der Lade, laͤngs den Kanten, sind Leisten oder Falze von Holz, wie rrrr, Fig. 19. diese Leisten
halten den Schieber in der Lade: auch an dem oberen Ende des Schiebers ist an jeder
Seite eine Leiste von Holz befestigt, wie dd in
Fig. 26.
zeigt. Diese Leisten laufen unmittelbar unter den Leisten rrrr, welche, zugleich mit den oberwaͤhnten
Fuͤssen, den Schieber aufrecht erhalten. s, Fig. 19. ist
ein Zug, durch welchen die Lade in Bewegung gebracht wird. Ein Ende eines
Seilstuͤkes ist an der Walze oo, Fig. 19.
befestigt, das andere Ende an einem Haken, welcher mit dem Schieber verbunden ist:
wenn die Lade mit Stroh gefuͤllt ist, (der Schieber befindet sich dann bei
a, Fig. 28), laͤuft
das Seil von der Walze oo uͤber die Rolle
k, Fig. 19. und kehrt zu dem
Schieber zuruͤk, an welchem dasselbe mittelst eines Hakens in dem Loche b, Fig. 27. befestigt ist:
die Lage dieses Seiles sieht man bei b, c, d, e, f, g,
Fig.
28.
Wenn der Zug X, Fig. 17. (dasselbe
Stuͤk, welches in Fig. 19. s ist), gehoben wird, so senkt sich das Ende der
Strohlade nieder, und erlaubt dem Strohe unter dem Drukgewichte den Durchgang bis
zur Schneide des Messers. Wenn der Zug X oder s hierauf niedergedruͤkt wird, so druͤkt
das Gewicht b auf das Stroh vorne in der Lade, indem
dasselbe zu gleicher Zeit durch die Gewalt der Lade gegen die Schneide des Messers
gedruͤkt wird: da dieses sich gleichzeitig vor und ruͤkwaͤrts
bewegt, so schneidet es das Stroh unmittelbar durch. Das Stroh wird in der Lade auf
folgende Weise vorwaͤrts geschoben: wenn der Zug X, wie oben gesagt wurde, in die Hoͤhe gehoben ist, so wird der Balken
bei N durch die Kette und durch das Gewicht Q niedergedruͤkt, und zwar so lang, bis der Kopf
des Stiftes bei O mit dem Stuͤke R in Beruͤhrung kommt. Der Treibstok T treibt zugleich das Stellrad um ein, zwei, drei
Zaͤhne uͤber den Punkt, wo der Faͤnger W das Rad festhaͤlt, je nachdem naͤmlich die Entfernung von
O bis R, welche durch
das auf- oder abwaͤrts Schrauben des Stiftes so bestimmt wird,
groͤßer oder geringer ist. Das Stellrad dreht die Walze oo
Fig. 19. um,
welche sich an derselben Spindel befindet, und die Rolle bewegt, mittelst des oben
erwaͤhnten Seiles, den Schieber, welcher das Stroh vorwaͤrts bringt.
Wenn aber das Stroh in groͤßerer Laͤnge geschnitten werden soll, als
man dasselbe dadurch erhaͤlt, daß man das Rad nur um drei Zaͤhne
bewegt, so muß die Walze mittelst der Griffe IIII
gedreht werden, wodurch das Stroh vorwaͤrts geschoben und in jeder beliebigen
Laͤnge abgeschnitten werden kann. Die Laͤnge des kuͤrzesten
Schnittes steht in Verhaͤltniß des Durchmessers der Walze und der Zahl der
Zaͤhne an dem Stellrade.
Wenn diese Maschine in großem Maßstabe erbaut wird, um bloß lange Schnitte zu
schneiden (eine große Menge oder eine bedeutende Tiefe von Stroh in der Lade erlaubt
keine seinen Schnitte) so muß die Saͤule D, Fig. 16. bei
b statt bei E befestigt
werden, wie man dieß bei a, Fig. 29. sieht. Der
horizontale Theil der Ekstuͤke muß laͤnger seyn, im
Verhaͤltnisse der Laͤnge der Lade, wie bei AB, Fig. 30. Die
Ekstuͤke muͤssen in groͤßerer Entfernung von einander
angebracht werden, im Verhaͤltnisse zur Weite der Strohlade, wie man bei AA, Fig. 20. sieht. Der
Balken bb, das Messer d, und das Drukgewicht f, muß in demselben
Verhaͤltnisse laͤnger seyn, wie man bei Fig. 29. sieht. Das Knie
h muß kuͤrzer, und im Verhaͤltnisse
zur angewandten Kraft
seyn. Die Walze muß groͤßer seyn, wie bei a, Fig. 31. Der
Zug an der Lade kann so, wie man bei b, Fig. 31. sieht,
angebracht seyn. Der Balken L, der Treiber T, der Stift O, und Kette
und Gewicht Q, Fig. 17. muͤssen
wegbleiben. Das Stellrad und die Griffe koͤnnen an einem und demselben Ende
der Spindel, wie bei C, Fig. 31. und bei C, Fig. 30. angebracht
werden; oder die Griffe koͤnnen an einem Ende der Spindel, und das Stellrad
an dem anderen angebracht werden. Ein beweglicher Rahmen von Holz, wie in d, e, f, g, h, i,
Fig. 31. muß
oben auf die Lade gelegt werden, um das Stroh niederzuhalten, so daß es sich sachte
der Laͤnge nach fortbewegen kann: es wird bei hi durch zwei Stuͤke Holzes kk
niedergehalten, die an den Latten befestigt sind, und bei de durch Stuͤke Holzes, die an den Seiten
der Lade angebracht sind, wie man an D in Fig. 30.
sieht, und durch andere Stuͤke Holzes, die unter den Enden de, Fig. 31. befestigt sind,
wie man bei aa, Fig. 32. sieht, wo die
lezteren unter die vorigen laufen. Die Verhaͤltnisse der Theile dieser
Maschine, so wie die Materialien, aus welcher sie gemacht werden kann,
koͤnnen abgeaͤndert werden, so wie die Arbeiter es gut finden, ohne
jedoch von meiner urspruͤnglichen Anreihung und meinem Baue abzuweichen.
Urkunde dessen etc.
Bemerkungen uͤber den Bau der groͤßeren Maschine.
Wenn Stroh in gehoͤriger Laͤnge zu Duͤnger oder zu Winterfutter
fuͤr mageres Vieh geschnitten werden soll, so kann die Lade in vier Minuten
gefuͤllt und ausgeschnitten seyn, und wird acht Striche (StrikeEin Strike ist soviel als 2 Bushel. Der Bushel
enthaͤlt 1801 Franz. Cubikzoll. Anm. d. Uebers.)
eingedruͤkt und aufgehaͤuft liefern.
Die Maschine braucht einen Mann zur Fuͤhrung des Messers, und einen zur
Leistung der Strohlade. Diese beiden Leute koͤnnen des Tages an tausend
Striche schneiden, und hierbei noch Zeit genug zum Essen, zum Messerwezen, und zum
Entfernen des geschnittenen Strohes an der Vorderseite der Maschine finden, so daß
die Auslage fuͤr das Strohschneiden zu diesem Zweke nur sehr gering seyn
kann.
Die Laͤnge des zu obigem Zweke geschnittenen Strohes ist vier und einen halben
Zoll; diese Laͤnge kann aber, nach Gutbefinden, abgeaͤndert
werden.
Man kann wohl nicht daran zweifeln, daß dieselbe Menge Strohes, die man dem Hornviehs
geschnitten gibt, dasselbe mehr naͤhrt und gesuͤnder erhaͤlt,
als wenn man ihm das Stroh ganz und lang, wie es ist, verfuͤttert.
Wenn man dem Hornviehs geschnittenes Stroh fuͤttert, so kann der
Duͤnger desselben alsogleich gebraucht werden.
So wuͤrde auch der Stallduͤnger alsogleich gebraucht werden
koͤnnen, wenn das zur Streue verwendete Stroh vorlaͤufig geschnitten
waͤre.
Wenn ein Paͤchter bei seinem nicht in Maͤstung stehenden Viehe keine
andere Absicht hat, als sein Stroh zum bequemen Duͤnger zu machen, so wird er
finden, daß diese Maschine von großer Wichtigkeit ist. Sie erspart die
Nothwendigkeit der Anwendung eines Kapitales, und die Gefahr die man laͤuft,
wenn man in dieser Hinsicht Vieh haͤlt: denn auf diese Weise kann Stroh am
besten als Duͤnger sowohl auf Garten- als Akerland angewendet
werden.
Wenn verfaulter vegetabilischer Duͤnger auf Wiesenland ausgestreut wird, und
es kommt trokenes Wetter, so wird der Duͤnger hart und hindert das Wachsthum;
kommt aber nasses Wetter, so wird der groͤßte Theil des Nahrhaften in dem
Duͤnger weggewaschen und geht fuͤr den Boden verloren. Wenn man
hingegen trokenes Stroh anwendet, so werden diese beiden Nachtheile vermieden, und der Boden
bei weiten mehr verbessert, indem er nach und nach die ganze Wohlthat des
Duͤngers, ohne allen Verlust, empfaͤngt.
Wenn, nachdem man Weizen gesaͤet hat, eine gehoͤrige Menge Strohes auf
der Oberflaͤche des Landes ausgestreut wird, so schuͤzt dieses Stroh
die jungen Pflaͤnzchen vor Frost und kalten Winden, und wird zugleich
Duͤnger fuͤr die naͤchste Ernte.
Die schoͤne und uͤppige Grasernte, welche man an jenen Stellen
erhaͤlt, wo Stroh und Heu lang aufgeschobert steht, und kein andere;
Duͤnger angewendet wird als trokenes Stroh oder Heu, welches von den Schobern
umher verstreut wird, ist ein deutlicher Beweis der guten Wirkung des trokenen
Strohes, wo man dasselbe als Duͤnger verwendet.
Wenn diese Art von Wirtschaft angenommen wuͤrde, so wuͤrde man eine
weit groͤßere Flaͤche Landes mit derselben Menge Strohes
duͤngen koͤnnen, als bei dem gegenwaͤrtigen Verfahren nicht
moͤglich ist.
Herr Humphry Dary sagt in seiner Agricultural
ChemistryLecture the Sinth. S. 417., wo er vom
Duͤnger spricht: »Trokenes Stroh von Weizen, Hafer, Gerste, Bohnen,
Erbsen, auch verdorbenes Heu und jede andere aͤhnliche Art trokener
vegetabilischer Materie ist in jedem Falle ein nuͤzlicher Duͤnger.
Man laͤßt zwar im Allgemeinen solche Substanzen gaͤhren, ehe man
sie anwendet; allein es laͤßt sich noch zweifeln, ob dieses Verfahren
allgemein befolgt werden soll.«
»Es unterliegt keinem Zweifel, daß Stroh von allen Ernten, wenn es
unmittelbar untergepfluͤgt wird, den Pflanzen Nahrung gibt: allein, ein
Einwurf, den man gegen diese Methode das Stroh als Duͤnger anzuwenden,
machen kann, ist die Schwierigkeit langes Stroh unterzugraben, und die
Unsauberkeit, die dadurch auf den Gruͤnden entstuͤnde.«
»Wenn man das Stroh gaͤhren laͤßt, so wird es ein bequemerer
Duͤnger; allein man verliert hier zugleich wieder sehr viel an
naͤhrender Materie. Man erhaͤlt dadurch vielleicht mehr
Duͤnger fuͤr eine einzelne Ernte, allein der Bos den selbst wird
dadurch weniger verbessert, als es geschehen seyn wuͤrde, wenn alle
vegetabilische Materie klein zertheilt und mit dem Boden gemengt worden
waͤre.«
»Man wirft gewoͤhnlich alles Stroh, welches man zu nichts Besserem
brauchen kann, auf einen Misthaufen um es daselbst gaͤhren und sich
zersezen zu lassen; es waͤre aber des Versuches werth zu sehen, ob es
nicht wirtschaftlicher waͤre, dasselbe durch eine zwekmaͤßige
Maschine klein schneiden zu lassen, und dann troken aufzubewahren, bis es als
Duͤnger fuͤr die kuͤnftige Ernte untergepfluͤgt
wird. Auf diese Weise wuͤrde es, obschon es sich um vieles langsamer
zersezte und Anfangs weniger Wirkung hervorbrachte, einen weit anhaltenderen
Einfluß auf die Verbesserung des Bodens aͤußern.«
Bemerkungen über die Wirkungen der kleineren Maschine.
Diese Maschine verrichtet die laͤngeren Schnitte auf dieselbe Weise, wie die
groͤßere Maschine, und die Menge Strohes, die sie schneidet, steht im
Verhaͤltnisse zu ihrer Groͤße. Sie schneidet aber auch zugleich das
Stroh so klein und fein, daß man es mit dem Kernfutter fuͤr Pferde mengen
kann, und zwar sowohl in Bezug auf Quantitaͤt als auf Qualitaͤt auf
eine ganz ausgezeichnete Weise.
NB. Diese Maschinen sind sehr einfach (? Uebers.) und stark, sowohl in dem
Geruͤste als in ihren Bewegungen; sie gerathen also nicht leicht in
Unordnung. Das Messer kann mit einem gemeinen Wezsteine gewezt werden, ohne daß man
noͤthig haͤtte, dasselbe aus der Maschine zu nehmenDaß unsere bisherigen
Strohschneide-Maschinen zu einfach sind und zu wenig leisten, ist
vielleicht eben so wahr, als daß diese Maschine, wie Abbildung und
Beschreibung beurkundet, zu zusammengesezt ist. Sie enthaͤlt jedoch
mehrere sehr schoͤne Ideen, die zur Vervollkommnung unserer
gewoͤhnlichen Maschine dienen koͤnnten. Wenn wir auch, solang
nicht wiederholte Versuche im Grossen fuͤr die groͤßeren
Vortheile trokener Strohduͤngung gesprochen haben, an den
Vorzuͤgen derselben vor der gewoͤhnlichen, wenn gleich noch
mangelhaften, Art zu duͤngen zweifeln, so wuͤrde doch bei
jedem staͤrkeren Pferdestande, vorzuͤglich bei
Cavallerie-Regimentern, ein Ersparniß in den nicht unbedeutenden
Ausgaben fuͤr Strohschneider hoͤchst wuͤnschenswerth
seyn, und es waͤre der Muͤhe werth, auch bloß des Versuches
wegen, eine solche Maschine verfertigen zu lassen, um ihren Ertrag mit
unseren gewoͤhnlichen Maschinen nach Abzug aller Kosten vergleichen
zu koͤnnen. Anmerk. d. Uebers..
Tafeln