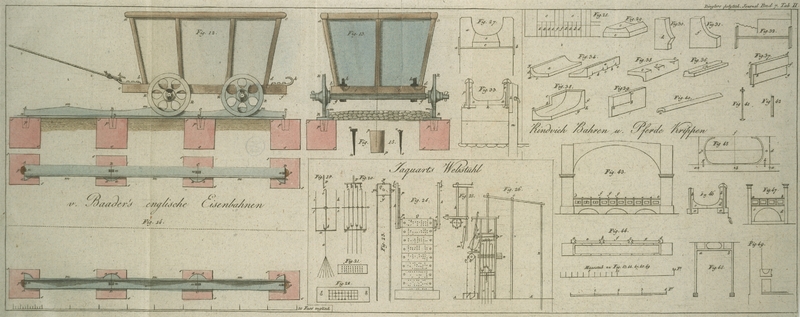| Titel: | Ueber die Weberstühle à la Jacquart. Von Professor C. Bernoulli. |
| Autor: | Prof. Christoph Bernoulli [GND] |
| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. II., S. 53 |
| Download: | XML |
II.
Ueber die Weberstühle à la Jacquart. Von Professor C. Bernoulli.
Mit Abbildungen auf Tab. II.
Bernoulli über Weberstühle à la Jacquart.
Schwerlich duͤrfte irgend eine der neuen Erfindungen in
der Webekunst derjenigen an Wiatigkeit gleich kommen, welche der Mechaniker Jacquart in Lyon
gemacht hat. Wie viele Patente werden jaͤhrlich fuͤr Erfindungen
ertheilt, die dem Patentnehmer wohl eine augenblikliche Aufmerksamkeit zuziehen
moͤgen, kaum aber zur Nachahmung reizen? Nicht so die Erfindung,
wofuͤr schon im Jahre 1808 Herr Jacquart ein Brevet erhielt. Zu bald wurden
die mancherley Vortheile derselben einleuchtend, und schnell wurden in Frankreich
eine Menge von Kunstwebestuͤhlen mit diesem nuͤzlichen Mechanismus
versehen, und bereits ist der Einfluß, der von dieser Vervollkommnung auf die
Darstellung aller Bildgewebe zu erwarten war, unverkennbar. Die fast unbegreifliche
Mannigfaltigkeit und Abwechselung des Dessins in den neuesten ZeugenSo erschienen
z.B. neulich Giletzeuge mit eingewebten Figuren und Namen; mit sehr
aͤhnlichen Napoleonskoͤpfen; ja mit den Koͤpfen aller
Deputirten der linken Seite u.a.m., sezt eine Leichtigkeit in der
Ausfuͤhrung voraus, die sich mit der bisherigen Weise kaum vertraͤgt.
Jedes Jahr auch wurden Brevets fuͤr einzelne Verbesserungen dieser
sinnreichen Vorrichtung verlangt.
Desto befremdender mag es seyn, daß noch nirgends diese Erfindungen beschrieben, daß
ihrer in deutschen Werken nur noch nicht gedacht worden. Zwar ist mir nicht
unbekannt, daß sie schon im Auslande, und auch in Deutschland hie und da Eingang
gefunden; sollte es indessen selbst uͤberfluͤssig seyn, den deutschen
Kunstweber auf diese Erfindung noch aufmerksam zu machenDieses
moͤchte aber um so weniger anzunehmen zu seyn, da die fruͤhern
auch bedeutenden Verbesserungen in dieser Weberei in so vielen Gegenden ganz
unbekannt geblieben sind., so verdient sie schon als ein eben so
sinnreiches als ein einfaches mechanisches Kunstwerk, so wie ihrer bewaͤhrten
Trefflichkeit wegen, eine Erklaͤrung und kurze Darstellung, in einer
Zeitschrift, in der alle
Fortschritte der Industrie und alle Erweiterungen der Kunstwissenschaft jeder Freund
derselben zu finden hofft.
–––––––––
Das Einweben einer Figur erheischt bekanntlich, daß die Kettenfaͤden, welche
die Figur einnimmt, in einer besondern kuͤnstlichen Ordnung nach einander
gehoben werden, bis das Bild vollendet ist. Ist dieses nicht lang, und ziemlich
einfach, so laͤßt sich dieß durch eine gehoͤrige Anzahl Fußtretten
bewirken. Fuͤr kuͤnstlichere Bilder hat man den Zug eingefuͤhrt. Ein Gehuͤlfe zieht nach jedem Schusse des
Schuͤzen, nach vorgeschriebener Ordnung diejenigen Faden in die Hoͤhe,
welche die Figur erfordert. Gewoͤhnlich werden Kinder dazu gebraucht. Dieses
Ziehen vermehrt aber nicht nur die Handarbeit, sondern ist auch sehr beschwerlich;
die meisten dieser Kinder sehen krank aus, und nehmen haͤufig Schaden. Zu dem
ist die Abhaͤngigkeit der Arbeit von dem Fleiße und der Gewandheit zweier
schon hinderlich. Mittel das Ziehen zu erleichtern, sind ohne Gluͤk versucht
worden; hingegen wurden mehrere Mechanismen erfunden, den Ziehjungen ganz zu
ersezen, und mit Vortheil bei der fassionnirten Zeug- und Bandweberei
angewandtSieh Bernoulli
uͤber Bandfabrikation im polytechnischen Journal B. 6. S. 103.. Sie fanden
aber nur hie und da Eingang, und boten noch immer manche Schwierigkeiten dar.
Einer derselben, der sogenannte Hochsprung hat indessen so
viele Aehnlichkeit mit der Jacquart-Maschine, daß diese wirklich nur als eine
Verbesserung oder Vereinfachung desselben angesehen werden koͤnnte. Wie oft
gibt aber eine einzige, oft geringscheinende Veraͤnderung, einer Maschine
eine ungleich groͤßere Brauchbarkeit? So auch hier. – Ohne indessen
eine, gleichsam historische, Entwikelung zu versuchen, werde ich sogleich zur
Beschreibung der eigentlichen Jacquart-Maschine, und zwar nach einer der lezten
Verbesserungen demselben uͤbergehen. Moͤge folgendes zur
vollstaͤndigen Erklaͤrung dieses sinnreichen Mechanismus, oder des
Jacquarts, wie derselbe auch heißt, hinreichen.
Es sey a
Fig. 19 die
Schnur, an der z.B. die Lizen aller 5ten Faͤden der Figurkette (in den
verschiedenen Bildrepetitionen eines Zeugs, oder den verschiedenen
Figurbaͤndern, die zugleich auf einem Stuhle sind) gehoben werden
koͤnnen. Diese Schnur ist an einem vertikalschwebenden, etwa 18 Zoll langen,
Drate, bc befestigt; der bei b eine 4 bis 5 Zoll hohe Umbiegung hat, mit welcher er
auf dem Loͤcherbrette x aufliegt. Die Schnur a geht durch eine Oeffnung dieses Brettes. Das obere
Ende c dieses Drates ist hakenfoͤrmig umgebogen.
Die Mitte dieses Hakendrates oder Hakens geht durch ein
Oehr eines andern wagerecht liegenden Drates ef,
des Stoͤffels, dessen Enden in zwei kleinen
Loͤchern der Stoͤsselwaͤnde oder Seitenbrettchen h und i aufliegen. So muß
der Haken in einer senkrechten Stellung erhalten werden.
Ueber c spielt nun vollkommen senkrecht ein Gatter P,
Griff genannt, der mir einer schiefliegenden messingenen
Schiene g, dem Messer,
versehen ist. Bei jedem Schuße oder Wurfe des Webers faͤllt nun dieses Messer
unter c und steigt sogleich wieder um einige Zolle. Es
ist klar, daß der Haken c uͤber das Messer
schlagen, oder von diesem ergriffen, und dadurch gehoben werden muß; und so werden
da, her alle 5te Kettenfaͤden in die Hoͤhe gezogen.
Haͤufig sollen aber jene 5te Faͤden nicht gehoben werden. Auch dieß
wird bewirkt werden, wenn naͤmlich der Stoͤssel ef vorher gegen e
etwas zuruͤckgestossen wird. Es weicht dann auch der Haken zuruͤk, und
das Messer spielt nun leer, oder ohne den Haken zu ergreifen.
Es ist aber auch leicht zu ersehen, daß, haͤtte ein Dessin z.B. 30 Kettenfaͤden, 80
solcher Stoͤssel und Haken noͤthig waͤren, nebst einer
Vorrichtung, die bei jedem Schuße alle diejenigen zuruͤkschoͤbe, die
nicht gehoben werden muͤssen.
Bis dahin kommt indessen der Jacquart so ziemlich mit den sogenannten
Hochspruͤngen uͤberein; es sey denn, daß diese blecherne oder
hoͤlzerne Platinen statt der Drathalen haͤtten, daß diese anders
eingehaͤngt waren u.s.w.
Das Ausgezeichnetste der neuen Erfindung besteht aber in dem Mechanismus, der jenes
Spiel der Stoͤssel eben so sinnreich als einfach und sicher bewirkt.
1. Sind hier, um an Raum zu gewinnen, die Stoͤssel und Haken in mehreren, 4
oder 6 Reihen uͤber- und hintereinander geordnet, wie Fig. 20 zu erkennen gibt.
Auch der Griff hat dann 4 oder 6 Messer. Fig. 21 zeigt wie die
Enden der Stoͤssel vorn aus dem Stoͤsselbrette hervorragen.
2. Geschieht das Zuruͤkstossen vermittelst eines Rektekes von Pappdekel. Fig. 22. – Dieses
hat runde Ausschnitte an allen denjenigen Stellen, die auf jene Stoͤssel
treffen, deren Haken wirklich gehoben werden, und die daher nicht
zuruͤckweichen sollen. Durch den Pappdekel, Fig. 22. werden z.B. nur
die Faden 1, 3, 4, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27 und 31, gehoben, denn nur auf
diese Stoͤssel treffen Ausschnitte. Diese Haken allein bleiben vertikal, und
werden von den Messern ergriffen und gezogen. Alle uͤbrigen druͤkt der
Pappdekel zuruͤck.
3. Bei jedem Schusse ist natuͤrlich ein neues anders durchbohrtes Pappblatt
erforderlich, bis das Bild vollendet ist. Alle diese Pappen muͤssen aber in
der naͤmlichen Ordnung immer wiederkehrend wirken. Nachdem daher alle
Pappblaͤtter, so viel ihrer sind, und so wie es das Muster oder die Patrone
erheischt, ausgeschnitten worden, werden sie so aneinander gebunden, daß sie ein
endloses Band bilden. (Das Ausschneiden geschieht sehr leicht und schnell, und ohne daß irgend ein
Abmesser noͤthig ist, indem man den Papprektangel zwischen 2 mit
Loͤcherreihen versehene Metallplatten einspannt, und dann die erforderlichen
Loͤcher der Patrone gemaͤß ausbohrt).
4. Damit nun bei jedem folgenden Wurfe auch das folgende Pappblatt gegen die
Stoͤssel druͤke, wird jenes endlos zusammengesezte Band uͤber
eine vierseitige hoͤlzerne Achse geschlagen. (S. Fig. 23. Jede Seile
dieser Achse oder des Wendelbaumes
Q, ist genau so breit als ein Blatt, und mit konischen
etwa 6 Linien tiefen Hoͤhlungen versehen, deren eben so viele sind als
Stoͤssel, und die eben so reihenweise geordnet sind. So gibt sie dem
Pappblatt eine hinlaͤnglich feste Unterlage, und gestattet doch fuͤr
jeden Ausschnitt den erforderlichen Durchgang des Stoͤsselendes. Jede
Walzenflaͤche hat an beiden Enden einen Zapfen y,
der in die Loͤcher zz (Fig. 22) eingreift, und
das Blatt fest haͤlt. Wendet sich daher der Wellbaum bei jedem Schusse umnm eine Seite oder um 1/4, so wird jedesmal wieder ein neues Blatt gehoben,
und dasjenige, das vorher oben lag, druͤkt jezt seitwaͤrts gegen die
Stoͤssel.
5. Nicht nur muß aber dieser Wendelbaum sich jedesmal um eine Seite drehen, sondern
er muß auch vorher etwas weggeruͤkt, und nachher wieder gegen die
Stoͤssel angeschoben werden; eben so muß die bruͤkende Seite
voͤllig senkrecht gegen dieselben anschlagen; und der Wendelbaum in einer
festen Stellung erhalten werden.
Diese etwas zusammengesezte Bewegung hat man durch verschiedene Vorrichtungen zu
erreichen gesucht. Ich gebe folgende: die beiden Zapfen des Wendelbaums ruhen in
einer Art Lade (battant) k
(Fig.
24.) die oben bei l aufgehaͤngt ist. Auf
der einen Seite der Lade druͤkt eine Spiraldratfeder mit einem flachen Fuße
p auf den Wendelbaum; das andere Ende dieses Baums ist an jeder
Eke mir einem kurzen eisernen Triebstoke o versehen. Am
Gestelle aber ist (Fig. 25.) ein eiserner Haken mit einer Schnauze m befestigt, der frei uͤber den Triebstoͤken liegt. So wie
nun die Lade weggedruͤkt wird, entfernt sich auch der Wendelbaum; bald
begegnet aber der aͤußere Triebstok o jener
Schnauze m; und so muß eine Viertelswendung erfolgen.
Die Feder p gestattet diese Wendung, druͤkt aber
nach derselben den Wendelbaum horizontal, und haͤlt ihn in dieser Lage
fest.
(Bei manchen neuen Maschinen ist auch wohl ein zweiter Wendehaken m' unten angebracht, der statt des obern von unten
angedruͤkt werden, und ein allmaͤhliges Wenden der Pappkette in
umgekehrter Ordnung bewirken kann. Dadurch wird es moͤglich das Muster
abwechselnd aufwaͤrts und verkehrt einzuweben).
Von dem Hin- und Herstossen des Wendelbaumes nachher.
6. Da eine recht genaue Ausfuͤhrung sehr wesentlich ist, so wird erforderlich,
daß alle Stoͤssel und Haken nach jedem Zuge wieder in ihre vorige Lage
zuruͤkkehren, ohne daß je ein einziger zuruͤkbliebe.
Dieses kann schon erzielt werden, indem die untere Haͤlfte der Haken eine
hinlaͤngliche Schwere haben. Sie fallen alsdann so wie der Pappdeckel weicht
von selbst zuruͤck. Soll indessen dieses Mittel sicher seyn, so wird das
Gewicht, und also die Last fuͤr die Messer betraͤchtlich
vergroͤßert. Andere bringen ein Brettchen an, das jedesmal alle verschobene
Stoͤssel wieder zuruͤktreibt. Zusammengesezter zwar, aber weit genauer
ist folgende Vorrichtung:
An der hintern Stoͤsselwand h (Fig. 26.) ist das
Gehaͤuse n, das eben so viele kleine Federn aus
spiralfoͤrmig gewundenem feinem Messingdrat enthaͤlt, als
Stoͤssel sind. Jeder Stoͤssel ist mit einem kleinen Knopfe oder Ringe
versehen: wird er demnach zuruͤckgedraͤngt, so druͤkt er die
ihm zugehoͤrige kleine Feder etwas zusammen, und diese bringt ihn, so wie der Druck
nachlaͤßt wieder in seine vorige Lage.
7. Eben so muͤssen die Haken sich ja nicht drehen koͤnnen, weil sie
sonst das Messer nicht ergreifen wuͤrde. Zu dem Ende sind die
Hakendraͤte unten umgebogen, und ein runder Stab liegt quer durch alle
Vertiefungen einer Reihe. (Fig. 1.) Zugleich
befoͤrdert dieser Stab das Wiederherabfallen der gehobenen Haken.
Nach dieser Erklaͤrung der einzelnen Organe des Jacquarts, werde ich nun
kuͤrzlich noch die Bewegungen der Maschinen im Ganzen zu erlaͤutern
suchen. (S. Fig.
26.)
Gewoͤhnlich steht die Maschine auf einem obern Boden A; auf dem sie nur wenige Quadratfuß Raum einnimmt. Die Schnuͤre
a gehen durch den Boden nach dem Theilbrette und den
Lizen des gerade unter demselben stehenden Stuhls.
B ist die Zugstange. So oft
der Weber das Schifflein durchwirft, macht die Stange eine Bewegung auf- und
niederwaͤrts. Dieß bewirkt entweder ein Pedal, oder eine Vorrichtung, welche
die Stange mit der Lade des Stuhls verbindet; oder, wie beim Bandstuhl, eine Kurbel
die an dem Schwungrade befindlich ist.
Diese Zugstange bewegt nun vermittelst des Hebels C den
Griff
P. Waͤhrend der Griff mit den Messern sich hebt,
soll der Wendelbaum sich drehen. Deshalb ist an dem Griff P die Frikzionsrolle q in gehoͤrigem
Abstande befestigt. Dieser Abstand kann durch die Schraube r veraͤndert werden. Die Rolle
q laͤuft in einem zwekmaͤßig gebogenen und
an der Lade befestigten Blechstreifen tt. Hebt
sich also der Griff, so steigt auch die Rolle, und diese draͤngt nothwendig
die Lade k zuruͤk – was, wie vorhin
gezeigt worden die Wendung des Wendelbaumes
Q zur Folge hat.
Mittlerweile kehren alle Stoͤssel und Haken, die verruͤkt worden, zuruͤk, weil die
Federn des Gehaͤuses n frei wirken
koͤnnen.
Steigt nun wieder die Stange B, so sinkt der Griff; Lade
und Wendelbaum naͤhern sich wieder, und ehe die Messer die Haken ergreifen,
sind durch das neue Pappblatt schon wieder diejenigen Haken zuruͤkgeschoben,
die bei den folgenden Einschuͤßen nicht gehoben werden sollen.
Da der Griff unverruͤkt senkrecht spielen muß, so laͤuft er in 2
messingenen, wohl geoͤlten Fugen.
Noch bemerke ich die Stellschraube s, die zur
Verruͤkung des Loͤcherbrettes x, wenn die
Schnuͤre schlaffer oder kuͤrzer werden, dient. Eine andere Schraube
wird dann auch zur Hoͤher- oder Niederstellung des Griffes gebraucht;
und eben daher ist der Hebel C mit der Zugstange B durch eine Schraube verbunden.
Die Vortheile, die der Jacquart gewaͤhrt sind unschwer zu erkennen.
Die laͤngsten Muster lassen sich ohne alle Schwierigkeit ausfuͤhren. Es
darf nur die Anzahl der Pappblaͤtter vermehrt werden. Wirklich werden oft
schon solche Pappketten von 300 und mehr Blaͤttern gebraucht.
Auch die Breite der Muster bietet kaum eine Beschraͤnkung dar. So viel
verschiedene Kettenfaden die Figur hat, so viele Haken und Stoͤssel
muͤssen spielen. Die compendioͤse Einrichtung und Anordnung derselben
laͤßt aber leicht 600, 800 und wehr zu. Eben so sind auch ganz schmale
Maschinen mit wenigen Duzend Stoͤsseln schon vortheilhaft.
Hauptsaͤchlich bietet aber die Veraͤnderung des Musters eine
ausnehmende Leichtigkeit dar. Hat dieses eine geringere Breite, so werden nun die
uͤberfluͤssigen Stoͤssel herausgenommen. Das Bohren der neuen
Pappblaͤtter ist sehr einfach, und wenig kostspielig (da bei den
Hochspruͤngen und Trommeln fast fuͤr jedes Dessin eine neue Walze etc.
gemacht werden mußte).
Selbst das Ablesen der Patrone ist weit leichter: das Pappblatt selbst gleicht einer
Patrone.
Ueber demselben Stuhl lassen sich ferner 2 oder doppelte Jacquart anbringen, um
zugleich 2 verschiedene Muster in einem Zeug, oder in mehreren Baͤndern
einzuweben. Endlich ist die Bewegung dieser Maschine mit ungleich geringerm
Kraftaufwand verbunden, und das Spiel derselben, wenn sie recht sorgfaͤltig
gebaut ist, so sicher und bestaͤndig, daß Maschinen in Jahren keine
Ausbesserungen bedurften, und nicht die geringste Unordnung veranlaßten.
Tafeln