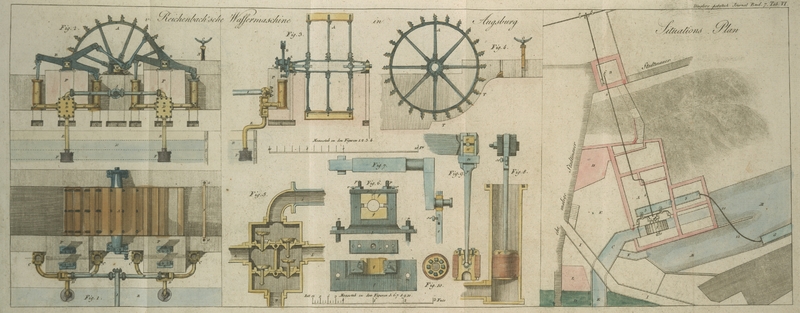| Titel: | Beschreibung der von Hrn. Ritter v. Reichenbach in Augsburg neuerbauten Wassermaschine. |
| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. XXXIX., S. 258 |
| Download: | XML |
XXXIX.
Beschreibung der von Hrn. Ritter v. Reichenbach in Augsburg neuerbauten Wassermaschine.
Mit illuminirten Abbildungen und einem Situations-Plan auf Tab. VI.
Beschreibung der von Hrn. Ritter v. Reichenbach in Augsburg neuerbauten Wassermaschine.
Die von dem Hrn. Ritter von Reichenbach, in Augsburg neu
erbaute Wassermaschine ist von mehreren Seiten zur oͤffentlichen Sprache
gekommen; auch wurde schon vielfaͤltig der Wunsch geaͤußert, daß davon
eine getreue Abbildung und Beschreibung gegeben werden moͤchte, dem wir durch
die gegenwaͤrtige Mittheilung derselben vollkommen zu entsprechen
glauben.
Im Spaͤtjahr 1820 wurden die einzelne Theile dieser Maschine auf dem
staͤdtischen Bauhofe ausgestellt, woran man den reinen Guß des Eisen, und die
Nettigkeit der Metallarbeiten bewunderte. Bei dieser Gelegenheit wurden die
Hauptdimensionen der Bestandtheile dieser Maschine genau gesammelt, und daraus die
Zeichnung zusammengestellt.
Diese Maschine besteht aus einem gewoͤhnlichen Saug- und Drukwerk. Die
vier Cylinder oder Stiefel sind in eine Linie gestellt, und je zwei und zwei durch
einen Ventilkasten, worin sich zwei Saug- und zwei Drukventile befinden,
verbunden. Die Kolben sind mit ihren Stangen an zwei, 11 1/2 Centner schwere,
eiserne Drukhebel befestigt, und das Ganze wird durch eine einfache Kurbel, welche
unmittelbar mit dem eisernen Wasserrade in Verbindung steht, in Bewegung gesezt. Das
Radgerinne und saͤmmtliche Unterstuͤzungen des ganzen Werkes sind von Stein.
Das Wasser wird von der Maschine in einer gemeinschaftlichen Steigroͤhre auf
eine senkrechte Hoͤhe von 100 Fuß gefoͤrdert, wo es sich in ein
großes, 6 Fuß langes 6 Fuß breites und eben so hohes Reservoir ausgießt. Dieses
Reservoir ist mit der Leitung, welche das Wasser in die Stadt fuͤhrt, durch
eine 7 Zoll im Durchmesser haltende Abfallroͤhre verbunden. Diese Leitung
theilt sich gleich unten in zwei Aeste, woran sich zwei große, 5 Zoll im Durchmesser
haltende, Hahnen befinden, um das Wasser nach Beduͤrfniß reguliren zu
koͤnnen. Die Fallhoͤhe des Wassers vom Reservoir bis da, wo die
Leitung horizontal fortzugehen anfaͤngt, ist 66 Fuß. –
Diese kurze Einleitung wird genuͤgen, um sich bei Beschauung der Zeichnung
einen deutlichen Begriff von der Construktion der ganzen Maschine zu machen. Auch
wurde dieser Zeichnung ein kleiner Situationsplan beigefuͤgt, um den Lesern
zugleich eine richtige Ansicht von der Roͤhren-Verbindung zu
geben.
Beschreibung der Maschine.
Fig. 1. ist
der Grundriß,
Fig. 2. die
Ansicht,
Fig. 3. der
Querdurchschnitt der Maschine,
Fig. 4. der
Durchschnitt des Wasserrades sammt dem Radgerinne.
In diesen Figuren bedeuten dieselben Buchstaben die gleichen Gegenstaͤnde.
A, ist das eiserne Wasserrad; es hat 14 Fuß im
Durchmesser ist 6 Fuß 6 Zoll breit, und hat 24 Schaufeln, welche von Holz und mit
eisernen Schrauben an dem Rade befestigt sind.
B, sind die zwei Drukhebel von Gußeisen.
C, die vier messingenen Cylinder oder Drukstiefel, 11
Zoll im Durchmesser.
D, die beiden Ventilkaͤsten.
E, die Saugroͤhren, 5 Zoll im Lichten weit, an
denen die kupferne Seiher F, befestigt sind.
G, die Roͤhren, welche die Cylinder mit den
Ventil-Kaͤsten verbinden; sie haben ebenfalls 5 Zoll im
Durchmesser.
H, die 5 Zoll weiten Roͤhren, welche das Wasser
von den Ventilkaͤsten dem gemeinschaftlichen Steigrohre zufuͤhren.
I, das gemeinschaftliche Steigrohr, von 7 Zoll inneren
Durchmesser.
K, ein großer Anwellblok von Gußeisen worin die Zapfen
des Wasserrades in messingenen Anwellen gehen.
L, kleinere Anwellbloͤke, ebenfalls von Gußeisen,
in welchen die großen Drukhebel gehen.
M, die geschmiedete eiserne Kurbe, sie hat 15 Zoll
Steigung. Der Zapfen, woran die zwei Zugarme befestigt sind, ist am vorderen Theil 3
Zoll, und am hintern 3 1/2 Zoll stark.
N, die Radfalle.
O, zwei Schrauben zur Regulirung der Radfalle.
P, große, maßive Steinbloͤke, auf denen die
Drukhebel ruhen.
Q, unten durch die Steinbloͤke gehende
Oeffnungen, um die Schraubenmuttern von den Schrauben, welche die Anwellen der
Drukhebel und Zapfen des Wasserrades, so wie die Cylinder festhalten, anziehen zu
koͤnnen.
R, das Reservoir, in welches das reine Quellwasser
geleitet, und von da durch die Maschine in das obere Reservoir geschaft wird.
S, die Zugstangen, an welchen die Kolben befestigt
sind.
T, die Ankroͤpfung des Radgerinnes.
Der eiserne Wellbaum ist hohl und besteht aus sieben Stuͤken. In den zwei
End- oder Kopfstuͤken sind die Zapfen befestigt und zwar auf folgende
Art: das Stuͤk, welches so wie die andern hohl ist, hat auf beiden Seiten
einen Boden a, a, in welchem sich vierekige
Loͤcher befinden, durch welche der Zapfen gestekt wird. Dieser Zapfen hat bei
b, einen Ansaz und wird bei c, mit einem eisernen Keil angezogen und befestigt. Vorne ist das
vierekigte Loch in dem Kopfstuͤke etwas groͤßer als der Zapfen dik
ist, um denselben mit hoͤlzernen und eisernen Keilen gehoͤrig ins
Zentrum richten zu koͤnnen.
Die zwei mittleren Stuͤke des Wellbaums sind gleich weite, mit Scheiben
versehene, Cylinderstuͤke, zwischen welchen noch ein Stuͤk zur
Befestigung der Radaͤrme geschraubt wird. Dieses Stuͤk hat die Form
eines Sternes, in welchen die Aerme hinein passen, und worin sie mit zwei Schrauben
befestigt werden. Der Stern selbst wird mittelst der Vertiefung d, in welche die Scheiben, der Kopf und die
Cylinderstuͤke passen, mit starken Schrauben an denselben befestigt, und so
die Theile zu einem Ganzen vereinigt. Fig. 3 und 4. geben davon eine
deutliche Ansicht.
Wie die Radfelgen an die Arme befestigt sind, zeigt die Zeichnung deutlich. Diese
Radfelgen sind mit den sogenannten Schaufelstielen, aus einem Stuͤk gegossen,
und durch Schrauben zusammengehaͤngt, siehe Fig. 4.
Um die Zeichnung von dieser Maschine moͤglichst vollstaͤndig zu machen,
wurden die einzelnen Theile nach einem groͤßeren Maaßstabe besonders
gezeichnet, die wir nun besonders beschreiben.
Fig. 5. ist
ein Ventilkasten, in dem die beiden Saug-Ventile e,
e, und die beiden Druk- oder Aufsteig-Ventile f, f, befindlich sind.
g, das Saugrohr.
h, h die Roͤhren, welche den Ventilkasten mit den
beiden korrespondirenden Cylindern verbinden.
i, das Rohr, welches das Wasser zu dem
gemeinschaftlichen Steigrohre fuͤhrt.
k, k, Loͤcher, in die die mittlern Schrauben der
Platte eingreifen.
Da das Spiel der Ventile jedermann bekannt ist, so duͤrfte eine naͤhere
Erklaͤrung derselben hier uͤberfluͤßig seyn.
Fig. 6. ist
ein eiserner Anwellblok.
l, die Grundplatte.
m, m, sind Schraubenloͤcher zu den Schrauben nn, welche durch den Stein gehen, und den
Anwellblok fest halten.
o, o, sind die aufrecht stehenden Stuͤke mit den
zur Befestigung der oberen Platte r dienlichen Schrauben
pp. Zwischen diesen Stuͤken befinden sich
die messingene Anwellen qq.
r, r, sind zwei Stellschrauben, um die Unwellen
gehoͤrig reguliren zu koͤnnen.
s ist eine in der oberen Platte und Anwelle angebrachte
Oeffnung, durch die man Fett auf den Zapfen lassen kann.
Fig. 7. stellt
die Kurbel nach einem groͤßern Maaßstabe dar. An dieser sieht man einen Theil
des daran befestigten Zugarmes t, dessen Construktion
mit den Zug- oder Kolbenstanzen gleich ist, und weiter unten beschrieben
wird.
Fig. 8. ist
der Durchschnitt eines Cylinders mit den darin befindlichen Kolben und der
Kolbenstange so wie das Endstuͤk eines Drukhebels. Die Bewegung an
saͤmmtlichen Theilen ist sehr sanft, und die des Zugkolbens sehr sinnreich
ausgedacht.
Fig. 9. zeigt
den Durchschnitt des Zugkolbens, der Kolbenstange und den Drukhebel.
Fig. 10.
zeigt den Grundriß oder die obere Ansicht des Kolbens.
Der messingene Zugkolben, aus einem Stuͤk gegossen, ist innen hohl, hat aber
ungefaͤhr in der Mitte einen starken Boden u,
welcher im Zentrum eine Vertiefung, in der Form eines halben Zirkels, hat. In dieser
Vertiefung wird die Kolbenstange, welche nach unten zu verjuͤngt und mit
einer Kugel versehen ist, gestellt, worauf sodann die beiden sogenannten
Bakenstuͤke v, v, gestekt werden. Hierauf wird
dann die obere Platte w, mit 8 starken Schrauben an den
Kolben befestigt, welche das Ganze zusammen haͤlt. Die Kolbenstange ist auf
diese Art vermittelst der Kugel mit dem Kolben verbunden, und kann so in demselben
jede Bewegung machen. Die Platte w, dient zugleich auch
dazu, um das Leder an den Kolben zu befestigen. Dieses wird von dem untern Rande x aufgehalten, und durch das Anschrauben der oberen
Platte fest zusammen gedruͤkt.
Die Kolbenstange besteht aus zwei Stuͤken, naͤmlich der Stange y, und der daruͤber gestetten Gabel z, zwischen welchen sich die messingenen Anwellen tt, tt, befinden. Ein eiserner Keil tz, welcher durch die Zugstange und die Gabel geht,
vereinigt die Theile zu einem Ganzen. Mit diesem Keil kann man die Anwellen so nahe
zusammen ziehen, als noͤthig ist, um eine sanfte Bewegung hervor zu bringen.
Die Stellschraube ss verhindert das
Zuruͤkgehen des Keiles. Auf diese Art sind auch die Zugaͤrme an der
Kurbel und an dem Drukhebel befestigt.
Die sinnreiche Construktion dieser Theile erfordert aber auch die
sorgfaͤltigste und fleißigste Ausarbeitung, damit alles aufs genaueste in
einander paßt, und nichts wakelt, weil sonst die Maschine ihrem Zweke nicht
entspraͤche. Bei dieser Maschine kann man nicht anders sagen, als daß alles
aufs reinste und vollkommenste ausgearbeitet ist. Bei den Kolbenstangen und Zugaͤrmen kommt
man dieser wegen in Versuchung, sie fuͤr ein ganzes Stuͤk zu halten,
und nur nach genauer Untersuchung nimmt man erst die Zusammenfuͤgung der
Theile wahr.
Das an dieser Maschine befindliche Wasserrad macht bei gegenwaͤrtigem Betriebe
in einer Minute 10 1/2 Umgaͤnge. Der Kolbenhub ist 29 Zoll, und liefert
beilaͤufig 1500 Maaß Wasser in einer Minute in die obere Reserve, oder 1500
baier. Eimer in einer Stunde1 baier.
Eimer haͤlt 60 Maaß, wovon 23 2/10 einen Kubikfuß fuͤllen.
12938 Fuß Baier. = 14400 Fuß Pariser. –.
Erklaͤrung des Situationsplans.
A, ist das Werkhaus. In diesem befindet sich:
1, das Wasserrad.
2, 2, 2, 2, die Drukstiefel.
3, 3, die Ventilkaͤsten.
4, 4, die Saugroͤhren.
5, 5, das untere Reservoir.
6, das gemeinschaftliche Steigrohr, welches zuerst diagonal einen Berg hinaufsteigt,
dessen senkrechte Hoͤhe 44 Fuß betraͤgt. Von hier aus steigt das
Wasser 66 Fuß senkrecht in den Thurm B hinauf, und gießt
sich dort in das obere Reservoir aus. Von da faͤllt es in dem, 7 Zoll im
Durchmesser haltenden Abfallrohre 7, wieder herunter, und theilt sich gleich unten
bei 8, 8, in zwei Aeste, an welchen sich zwei große Hahnen 9, 9, befinden, um das
Wasser reguliren zu koͤnnen. Unten an der Abfallroͤhre, bei 10, ist
ein Anstichhahnen, von welchem die Leitung, welche die Vorstadt noch mit Wasser
versehen soll, ausgeht. Diese Leitung ist auch schon eine Streke weit gelegt.
C, ist der steinerne Kanal, welcher dem Wasserrade das
Aufschlagwasser zufuͤhrt.
D, der Lechkanal, Stadtbach genannt; uͤber diesen
wird das Aufschlagwasser zum Betrieb der Wassermaschine in einem hoͤlzernen
Kanal E gefuͤhrt.
F, ist die leere Gasse, um das uͤbrige Wasser
ablassen zu koͤnnen.
G, die Quelleneinfassung, von welcher eine Roͤhre
11, 11, unter dem Wasserbette des Stadtgrabens geht, die der untern Reserve das
Trinkwasser zufuͤhrt.
H, die Werkstaͤtte.
I, der untere Neuegang.
K, der Hofraum,
L, die Waschkuͤche, zum
Brunnenthurm-Gebaͤude gehoͤrig.
M, der Stadtgraben.
Durch diese kurze Beschreibung wird man in den Stand gesezt seyn, sich einen
deutlichen Begriff von dieser Wasser-Maschine zu machen. –
Tafeln