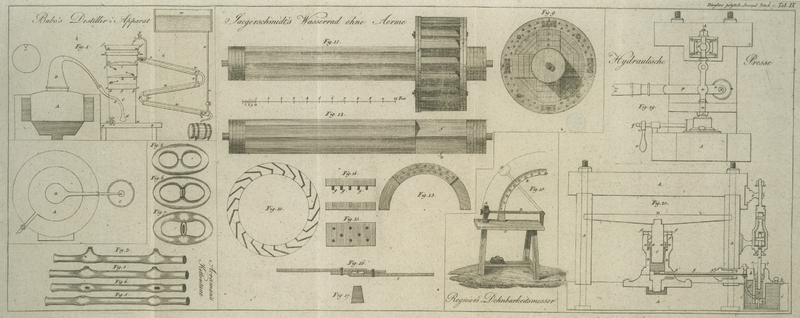| Titel: | Beschreibung eines verbesserten Branntwein-Destillir-Apparates von Lambert v. Babo in Weinheim an der Bergstraße. |
| Autor: | Lambert Babo [GND] |
| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. LXI., S. 420 |
| Download: | XML |
LXI.
Beschreibung eines verbesserten Branntwein-Destillir-ApparatesMan vergleiche
hiemit die Beschreibungen und Abbildungen der verbesserten Brenn-Apparate
im polytechnischen Journal Band 2. S.
377. Bd. 3. S. 436. Bd. 4. S. 386. Bd. 5. S. 156. D. von Lambert v. Babo in Weinheim an der Bergstraße.
Mit Abbildungen auf Tab. IX.
v. Babo's verbesserter Destillir-Apparat.
Der Preis des Branntweins ist in gegenwaͤrtiger Zeit so
sehr gesunken, daß er, bei der gewoͤhnlichen Art zu brennen, die
Produktionskosten nicht mehr dekt. Um nun doch wenigstens ohne Schaden die
Branntwein-Fabrikation fortsezen zu koͤnnen (die bei vielen
Landwirthen so wesentlich in ihr Gewerbe eingreift), koͤmmt alles darauf an,
den Branntwein mit moͤglichst geringen Kosten darzustellen, und ein Mittel dazu ist die
Vereinfachung der Destillation, wodurch Zeit und Feuermaterial erspart wird. Aus
dieser Ursache entstanden vielerlei zum Theil sehr zwekmaͤßige Vorrichtungen,
um den Branntwein aus der Maische gleich in der ersten Destillation und in
gehoͤriger Starke zu erhalten. Die meisten sind aber fuͤr kleinere
Landwirthe zu kostbar, und werden schon deßwegen nicht so allgemein angewendet
werden, als sie es verdienten. Deßwegen ließ ich mir einen Apparat verfertigen, der
Zwekmaͤßigkeit mit Wohlfeilheit verbindet, und war auch so gluͤklich,
nach mehreren vergeblichen Versuchen den hier beschriebenen auszufinden. Obschon ich
nicht behaupten will, daß mein vorgesezter Zwek auch auf eine andere Art zu
erreichen sey, so hat es sich doch durch zweijaͤhrigen Gebrauch in meiner
Brennerei gefunden, daß er ein reines Fabrikat von gehoͤriger Staͤrke
ohne großen Holzaufwand lieferte, und daher den an ihn gemachten AnordnungenAnodrungen vollkommen Genuͤge leistet.
Er besteht aus folgenden Theilen:
Fig. 1. Tab.
IX. A. der Kessel, bei mir eine rheinischer Ohm
haltend.
B. der Hut, beide in gewoͤhnlicher Form, nur daß
der Schnabel des Huts etwas laͤnger und mehr gekruͤmet ist.
C. der Refrigerator, ein kupferner Cilinder, in welchem
die Absonderung des Branntweins von den bei der gewoͤhnlichen ersten
Destillation mit uͤbergehenden waͤsserigen Theilen geschieht, welche
hier zuruͤkbleiben. Dieser besteht:
a) aus der untern Haͤlfte aa, bb, und ist
bestimmt, das sich niederschlagende Wasser aufzunehmen, welches nach geendigter
Operation durch den Krahn c abgelassen wird. In diesen
Theil des Cilinders senkt sich ein Rohr d.d.d bis
ohngefaͤhr einen Zoll an den Boden desselben. Es ist mit dem Schnabel des
Helms in Verbindung, und erweitert sich an seinem untern offenen Ende, um das
Verstopfen desselben bei
etwaigem Uebergehen der Maische zu verhindern. Seine Bestimmung ist, die aus der
Blase steigenden Daͤmpfe, den moͤglichst weiten Weg zu fuͤhren,
so daß sie durch die ganze Hoͤhe des Cilinders streichen muͤssen.
b) Aus der obern Haͤlfte ee, ff, welche,
auf der untern festgeloͤthet, sich in 3 Absaͤzen g, h, i gegen oben etwas erweitert. Auf dem Absaz g liegt ein Gitter von hoͤlzernen Staͤben,
bestimmt die zur Reinigung des Branntweins noͤthigen Kohlen zu tragen. Auf
den Absaͤzen h und i
befinden sich auf jedem ein gegen oben gewoͤlbter kupferner Dekel, der auf
seinen Seiten so genau als moͤglich auf dem durch den Absaz gebildeten Rand
aufliegen muß. Von diesen Dekeln hat jeder am Rande einen dreiekigen,
ohngefaͤhr 1 1/2 Zoll breiten Einschnitt r. Diese
Einschnitte werden von einander abgekehrt gelegt, und zwar in solcher Richtung, wie
die auf der Zeichnung befindlichen Pfeile es anzeigen. Die Buchstaben k und l bezeichnen die
Stellen, wo bei dem Gebrauche die Einschnitte liegen muͤssen.
Der Raum oder dem Dekel bei ni wird durch eine
kupferne Schuͤssel nn, oo ausgefuͤllt, welche in die obere
Oeffnung des Cilinders bei mm, wie der Helm in die
Blase genau eingepaßt, damit sie eben so luftdicht wie dieser mit Lehm verkittet
werden kann. Diese Schuͤssel senkt sich in den Raum auf diese Art, daß
zwischen ihr, dem unter ihr befindlichen Dekel und den Waͤnden des Cilinders
ein Zwischenraum von ohngefaͤhr 4 Linien bleibt, durch welchen die
aufsteigenden Daͤmpfe zu streichen haben, ehe sie in das mit dem
Schlangenrohr oder sonstigem Kuͤhlapparat in Verbindung stehende Rohr n anlangen koͤnnen. Auf diese Schuͤssel
geht ein etwas hoͤher angebrachtes, mit einem Krahn verschlossenes Rohr s, vermittelst welchem das noͤthige
Abkuͤhl-Wasser aus dem Kuͤhlfaß, oder einem sonst dafuͤr
eingerichteten Gefaͤß in die Schuͤssel geleitet wird. Aus der
Schuͤssel selbst
wird das uͤberschiessende Wasser durch ein am oberen, vorstehenden Rande
angebrachtes Roͤhrchen wieder abgeleitet.
Der Cilinder selbst steht auf einem starken Diel qq, und muß uͤberall luftdicht verschlossen seyn.
Die Behandlungsart dieses Apparates ist einfach und leicht zu finden, erfordert aber
dennoch etwas mehr Aufmerksamkeit, als die gewoͤhnliche Art von Destillation.
Hier die Hauptsache davon.
Vor jeder andern Arbeit wird das Gitter bei g eingesezt,
und so hoch mit Kohlenstuͤken angefuͤllt, daß diese den Dekel von h beruͤhren. (Will man den Branntwein nicht
besonders rein, so koͤnnen die Kohlen auch wegbleiben). Die Dekel h, i werden alsdann eingesezt, so daß die in denselben
befindlichen Einschnitte, wie oben beschrieben, einander gegenuͤber stehen.
Zulezt wird die Schuͤssel eingelassen, und an dem oberen Rande, wie der Helm
in die Blase genau eingekittet. Die Schuͤssel selbst fuͤllt man
ungefaͤhr 1 1/2 Zoll hoch mit kaltem, oder hat man heißes Wasser in der
Naͤhe, ganz mit solchem an, und nun ist der Cilinder zum Empfange der
Daͤmpfe aus der Blase bereit.
Zu bemerken ist, daß wenn man den Cilinder einmal eingerichtet, und die
Schuͤssel aufgekittet hat, derselben drei bis vier Monate stehen kann, ohne
auseinander genommen werden zu muͤssen. Eben so ist das Einfuͤllen von
warmen Wasser in die Schuͤssel nur bei dem ersten Abtreiben der Blase
erfoderlich, indem bei dem spaͤtern Einfuͤllen der Maische in den
Kessel, besonders wenn man mit einem Vorwaͤrmer arbeitet, das Wasser sich
selbst warm erhaͤlt.
Das Antreiben der Blase geschieht ganz auf die gewoͤhnliche Art. Ist der
Schnabel des Helms so beiß geworden, daß er mit der Hand nicht mehr beruͤhrt
werden kann, so muß man die Feuerung vermittelst der Schieber etwas sperren, um das Uebergehen der
Maische in den Cilinder zu verhindern, wodurch die Roͤhre d.d.d sich etwa eben verstopfen, und der Helm abspringen
koͤnnte. – Nach und nach erwaͤrmt sich der Refrigerator bis
oben hin, und der Branntwein geht alsdann in das Schlangenrohr uͤber. Wenn er
anfaͤngt abzurinnen so wird der Krahn bei 5 geoͤffnet, und zwar nur so
viel Wasser eingelassen, als moͤglich ist, die Schuͤssel nach und nach
zu fuͤllen, ohne daß sich das darin bereits erwaͤrmte Wasser wieder
erkalte, indem sonst der an der Schuͤssel sich reinigende Branntwein zu
kuͤhl, und statt in das Schlangenrohr uͤberzugehen, in den Cilinder
zuruͤkfallen wuͤrde.
Da die Einrichtung des ganzen Apparates nur zum Zweke hat, die aus der Blase
tretenden, aus Alkohohl und waͤsserigen Theilen bestehenden Daͤmpfe
sowohl durch die verschiedenen, in dem Cilinder angebrachten Hindernisse, als auch
durch das Vorbeistreichen an dem in der Schuͤssel befindlichen warmen Wasser
in soweit von ihren waͤsseringen Theilen zu befreien, als es noͤthig
ist, um den fuͤr den Branntwein erforderlichen Alkohohlgehalt hervor zu
bringen, so wird man einsehen, daß eine zu heftige Feuerung und daraus entstehende
schnellere Dampfentwikelung vermoͤgend ist, die an der Schuͤssel
vorbeiziehenden Dampfe zu schnell uͤberzutreiben, und dadurch das
noͤthige Verdichten und Zuruͤkfallen der Wasserdaͤmpfe zu
verhindern. Diese treten dann mit in die Schlange, und truͤben und
schwaͤchen den gewonnenen Branntwein.
Bei zu schwacher Feuerung hingegen, oder wenn das in der Schuͤssel befindliche
Wasser sich zu sehr erkaltet hat, geschieht das Gegentheil. Die Daͤmpfe haben
nicht Trieb genug, um das Schlangenrohr zu erreichen, oder sie schlagen sich an der
Schuͤssel zu stark nieder und fallen in den Cilinder zuruͤk, dadurch
erhaͤlt man freilich an der Muͤndung der Schlange ein dem Weingeist
aͤhnliches Produkt; jedoch zu langsam, und nur tropfenweis.
Aus diesen Gruͤnden ergibt sich, daß der Brenner im Verlaufe der Destillation
hauptsaͤchlich darauf zu merken habe, daß die Schlange nie zu stark ablaufe
oder nur tropfe, und muß darnach die Feuerung einrichten. Durch die Uebung von
einigen Tagen findet er hierbei leicht den Mittelweg.
Bei regelmaͤßiger Feuerung lauft nun der Branntwein im Anfange in der
Staͤrke von Weingeist, wird im Verlaufe der Destillation nach und nach von
geringerem Alkoholgehalt, und koͤmmt endlich auf die Staͤrke von
Lutter. Man laͤßt daher den Branntwein, (wie bei dem gewoͤhnlichen
Wein- oder Zartbrand.) bis auf das gewuͤnschte Gewicht ablaufen,
wendet ihn alsdann ab, und sammelt den Nachlauf, um ihn bei der folgenden
Destillation wieder in die Blase zuruͤkzufuͤllen.
Bei dem Ausleeren des Spuͤhlings, wird auch der Cilinder durch den Hahn c abgelassen. Ist die Maische nicht
uͤbergegangen, so erhaͤlt man eine wasserhelle Fluͤssigkeit,
wie bei dem gewoͤhnlichen Zartbrennen, oder Weinen. Man kann sie
wahrscheinlich zu Essig verwenden.
Bei unbefangener Pruͤfung aller dieser Angaben wird man leicht einsehen, wie
viel Muͤhe, Zeit und Feuermaterial durch diesen Apparat bei gehoͤriger
Behandlung erspart wird, ohne daß man bei der Einrichtung großen Kostenaufwand
noͤthig habe. Denn in jeder wohl eingerichteten Brennerei befinden sich 2
Kessel mit eben so viel Schlangenroͤhren und Kuͤhltonnen. Der
Refrigerator soll nun so viel kosten, als der zweite Kessel, so ist doch der Betrag
der Schlange und des Kuͤhlstaͤnders erspart.
Da bei dieser Einrichtung der Maischwaͤrmer als mitwirkender
Kuͤhlapparat gar nicht noͤthig ist, so habe ich ihn bei dieser
Beschreibung nicht angefuͤhrt. In meiner Brennerel steht er fuͤr sich, auf
der Fortsezung des Blasenfeuers, und wird durch dasselbe erwaͤrmt. –
Wenn er auf diese Art auch nicht auf den hohen Grad von Hize gebracht wird, wie
diejenigen, durch welche das aus dem Helm in die Schlange fuͤhrende
Zwischenrohr geleitet ist, so habe ich das gegen den Vortheil, daß die Maische,
obwohl hinlaͤnglich erwaͤrmt, doch lange nicht so leicht ins Kochen
koͤmmt, und im Maischwaͤrmer ihren Alkoholgehalt verliert, wie dieß
bei der gewoͤhnlichen Einrichtung derselben oft der Fall ist. Wollte man
jedoch bei dem beschriebenen Refrigerator auf dieser Art bestehen, so koͤnnte
der Vorwaͤrmer zwischen der Blase und dem Cilinder angebracht werden.
Die beigefuͤgte Zeichnung ist ruͤksichtlich der Verhaͤltnisse,
nach den in meiner Brennerei aufgestellten Geraͤthschaften genommen. Da der
Kessel eine rheinische Ohm haͤlt, so wird jeder Kupferschmied darnach die
noͤthigen Maaße finden koͤnnen. Liebhabern zu diesem Apparat, welche
nicht zu weit von Mannheim entfernt wohnen, wuͤrde ich jedoch rathen, sich
mit Kupferschmiedmeister Hr. Hug, daselbst zu benehmen, der denselben nach meiner
Angabe fertigte, und waͤhrend der Arbeit technische Erfahrungen machte, durch
welche er in den Stand gesezt ist, manche Verbesserungen bei der Bearbeitung
anzuwenden. Ich komme nun zur
Beschreibung des Kuͤhlapparates.
p das Schlangenrohr fuͤr den Durchgang der
Brandweindaͤmpfe;
t die Oeffnung, worin das aus der Maschine kommende Rohr
befestigt ist;
u die uͤber das Kuͤhlrohr laufenden etwa
3'' im Durchmesser haltenden, und beilaͤufig 4 Fuß langen Roͤhren, die
durch die kleinern Roͤhrchen vv in
Verbindung stehen;
w ein Wasserkasten, woraus das zum Kuͤhlen noͤthige Wasser durch das
Rohr xx in den Raum zwischen dem eigentlichen Kuͤhlrohr
und der daruͤber laufenden weiteren Roͤhre geleitet wird;
y der Hahn, durch welchen das erwaͤrmte
Kuͤhlwasser abfließt, welches hier zum Theil in den Einsaz des Cilinders
geleitet ist;
z ein Krahn zum Ablassen dieses Wassers, wenn nicht
gearbeitet werden soll.
Beim Gebrauch wird w mit Wasser gefuͤllt, und der
Krahn y, je nachdem die Kuͤhlung stark oder
schwach seyn soll, geoͤffnet. Das Wasser steigt durch die Roͤhren uu und v hindurch,
kuͤhlt die in der innern Roͤhre streichenden Brands
weindaͤmpfe, und fließt bei y wieder ab. Die
Wirkung dieses Kuͤhlapparats ist hier so groß, daß schon die zweite Biegung
des inneren Rohres bei x immer durchaus kalt bleibt, daß
also die Daͤmpfe schon in den obern zwei Drittheilen des Apparats genug
gekuͤhlt werden.
Die ganze Vorrichtung haͤngt im Brennhause an der Wand, und braucht weit
weniger Raum, als die gewoͤhnlichen Kuͤhlapparate.
Tafeln