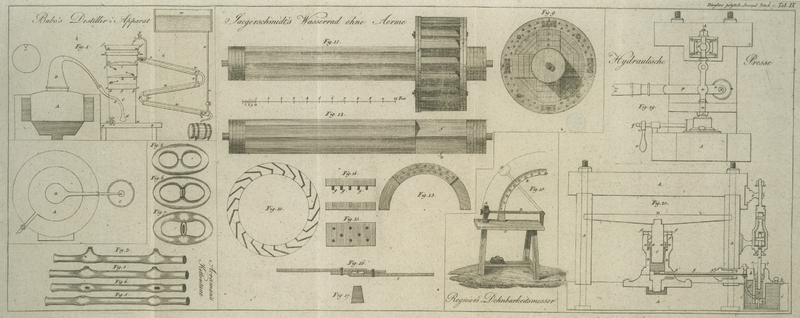| Titel: | Bericht des Hrn. Tarbé de Vauxclairs, im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste, über ein Wasserrad ohne Arme, welches Hr. Jägerschmidt, Marktscheider zu Muzig im Oprt. des Niederrhein erfunden, und der Gesellschaft mitgetheilt hat. |
| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. LXIV., S. 433 |
| Download: | XML |
LXIV.
Bericht des Hrn. Tarbé de Vauxclairs, im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste, über ein Wasserrad ohne Arme, welches Hr. Jägerschmidt, Marktscheider zu Muzig im Oprt. des Niederrhein erfunden, und der Gesellschaft mitgetheilt hat.
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. Dezember 1821. S. 347.
Mit Abbildungen auf Tab. IX.
Tarbé de Vauxclairs Bericht über ein Wasserrad ohne Arme.
Hr. Jaͤgerschmidt bemerkt, daß die Wasserraͤder nach der
gewoͤhnlichen Bauart zu wenig Festigkeit besizen, zumal wenn sie, wie bei
Hammerwerken, einen großen Widerstand zu uͤberwinden haben. Die
Wellbaͤume dieses Rades gehen gewoͤhnlich an den zur Aufnahme ihrer
Arme gemachten Zapfenloͤchern zu Grunde, und oͤfters brechen diese Arme selbst,
weil sie nicht stark genug sind. Diese bedeutenden Nachtheile veranlaßten ihn
uͤber eine zwekmaͤßigere Bauart solcher Raͤder nachzudenken,
und er glaubt, dieselbe in einem Rade ohne Arme, und folglich ohne
Zapfenloͤcher gefunden zu haben. Er versichert, daß ein solches von ihm
gebautes Rad durch 17 Monate Tag und Nacht ununterbrochen ohne die mindeste
Stoͤrung fortging. Nach seiner Zeichnung und Beschreibung wird dasselbe auf
folgende Weise verfertigt.
Nachdem der Wellbaum in gehoͤrigem Verhaͤltnisse zur Groͤße des
Rades vierekig zugehauen wurde, befestigt Hr. Jaͤgerschmidt auf jeder Flaͤche
desselben 5–6 Zoll starke Pfosten, die uͤber einandergelegt, und mit
Nageln unter sich befestigt werden. Er erhaͤlt auf diese Weise die Figur
eines Kreuzes, dessen Winkel gleichfalls mit anderen diagonal laufenden Pfosten
ausgesezt sind. Auf diese Weise entsteht ein hoͤlzerner Cilinder ohne alle
Hoͤhlung, auf welchem die Schaufeln oder Schoͤpfer so angebracht
werden, daß sie das Wasser langer als die gewoͤhnlichen Wasserraͤder
halten. Die Seiten dieser Schaufeln bestehen aus krummen Flaͤchen, welche
durch eiserne Bolzen und Baͤnder gehalten werden, und noch uͤberdieß,
wie die Felgen eines Kutschenrades, mit einem eisernen Reife versehen sind.
Ohne uͤber die Art und Weise der Ausfuͤhrung dieses Baues, welche die
Zimmerleute nach Verschiedenheit des ihnen zu Gebote stehenden Materiales
abaͤndern koͤnnen, sich weiter einzulassen, glaubt der Ausschuß sich
vorzuͤglich auf die Grundsaͤze beschranken zu muͤssen, auf
welchen das Sistem dieses Rades beruht. Er erkennt die Richtigkeit der Bemerkung des
Hrn. Jaͤgerschmidt, daß
man die Einzapfung der Arme in Zapfenloͤcher an Wasserraͤdern nicht
genug mißbilligen koͤnne; wie man indessen diesen Nachtheil, selbst mit
Beibehaltung der Arme, durch Kreuzung derselben um den Baum umher, statt daß sie
durch denselben durchgingen, beseitigen kann, ist bereits an mehreren großen
Trommelraͤdern praktisch dargestellt worden. Eine dieses neue Sistem eines
Wasserrades vorzuͤglich auszeichnende Einrichtung desselben ist der Umstand,
daß das Rad dicht und voll, und nicht hohl ist: allerdings ist ein solches dichtes
Rad, das eigentlich nur einen Holzblok bilden soll, weit fester als ein durch große
Weitungen in seinem Inneren leichter gebautes Rad; man muß indessen bemerken, daß
wenn ein solches dichtes Rad einen bedeutenden Durchmesser haben soll, es auch eine
bedeutende Schwere erhalten muß, wodurch folgende Nachtheile entstehen: 1) kann der
Wellbaum dadurch gebogen, ja sogar gebrochen werden; 2) wird die Reibung auf dem
Zapfenlager dadurch gar sehr vermehrtWenn man das
Rad aus sehr leichtem, durch seine Zusammenfuͤgung darob nicht minder
festen Holze, selbst aus Kork bauen wuͤrde, wurden diese
Einwuͤrfe beseitigt werden. In unseren Alpen sind bei manchem
Hammerwerke seit undenklichen Zeiten solche volle Raͤder, wie man sie
nennt, im Gange. A. d. Ueb.: auch hat Hr. Jaͤgerschmidt nur ein Hammerrad von 7 Fuß
im Durchmesser erbaut. Der Ausschuß glaubt daher, daß dieses Sistem eines Raderbaues
bei Raͤdern von 12–20 Fuß im Durchmesser weniger Vortheile als
Nachtheile bringen wuͤrde; und da ferner kleine Raͤder
verhaͤltnißmaͤßig staͤrker sind, als groͤßere, so muß
man bedauern, daß die hier erreichte Vermehrung der Staͤrke nur an jenen
Raͤdern benuͤzt werden kann, die derselben gewoͤhnlich am
wenigsten beduͤrfen.
Es gibt indessen einzelne Faͤlle, wo der von Hrn. Jaͤgerschmidt vorgeschlagene Bau
vortheilhaft werden mag; und daher schlaͤgt der Ausschuß vor, denselben
oͤffentlich, jedoch mit der Bemerkungen, daß er nicht allgemein angewendet werden kann, bekannt
zu machen.
Erklaͤrung der Abbildung des Wasserrades ohne Arme und ohne Einzapfungen.
Fig. 9. zeigt
das Rad vom vorderen Ende des Baumes aus gesehen.
a) Pfosten, welche den Raum zwischen dem
Baume und dem Umfange des Rades ausfuͤllen;
b) eiserne Schwanzzapfen, welche die
krummen Seitenflaͤchen an ihren Verbindungen zusammenhalten, und das
Auseinanderweichen derselben hindern: sie befinden sich an beiden Seiten
derselben, sind 6 Linien stark, in das Holz verdenkt, und mittelst Bolzen unter
einander verbunden;
c) kleine Keile rings um das Rad, an
beiden Seiten desselben, wodurch die Pfosten desto staͤrker an die
krummen Seitenflaͤchen angetrieben werden.
Fig. 10.
stellt die Abtheilungen der Schaufeln, oder Schoͤpfer nach einer neuen
Vorrichtung dar. Hr. Jaͤgerschmidt versichert, daß das Wasser in denselben
laͤnger, als nach der gewoͤhnlichen Methode, verweilt.
Fig. 11. das
Rad von vorne. Die Seite d wird durch zwei Stellreife
(cercles à clavette) befestigt, welche, wenn
dieses Wasserrad einen Hammer treiben soll, 4–5 Linien dik seyn
muͤssen. Auch die Seite e muß von zwei solchen
Reifen umgeschlossen werden; man ließ sie aber hier unbedekt, um die zwei Lagen der
krummen Seitenflaͤchen zu zeigen, welche durch hoͤlzerne
Naͤgel, Fig.
13., unter einander verbunden sind.
Fig. 12.
zeigt, daß der Theil f des Baumes, auf welchem das Rad
ausgezimmert ist, vierekig ist, auf diesem Viereke, durch welches die Groͤße
des Rades bestimmt wird, sind die Pfosten aufgesezt, welche den Raum des Rades bis zu dem Umfange desselben
hin ausfuͤllen.
Fig. 13.
zeigt zwei, durch eine dritte verbundene, Seitenflaͤchen, welche dritte
Seitenflaͤche mittelst hoͤlzerner Naͤgel zur
Verstaͤrkung der Verbindung derselben auf der Zusammenfuͤgung der
beiden anderen, x, aufgesezt ist.
Fig. 14.
zeigt die Weise, wie die Pfosten aFig. 9., vom
Wellbaume an bis zum Umfange des Rades uͤber einander befestigt werden. Diese
Vereinigung oder Befestigung geschieht naͤmlich mittelst großer
hoͤlzerner Naͤgel g.g.
Fig. 15.
Loͤcher, welche obige hoͤlzerne Naͤgel aufnehmen.
Fig. 16.
Theil der Reife, welcher zeigt, wie dieselben vorgerichtet sind, um die krummen
Seitenflaͤchen des Rades, Fig. 11. zu
verbinden.
Fig. 17.
Stellplatte, welche, in die Oeffnung h eingetrieben, den
Reif sowohl rechts als links anzieht, indem sie wie ein Keil wirkt.
Tafeln