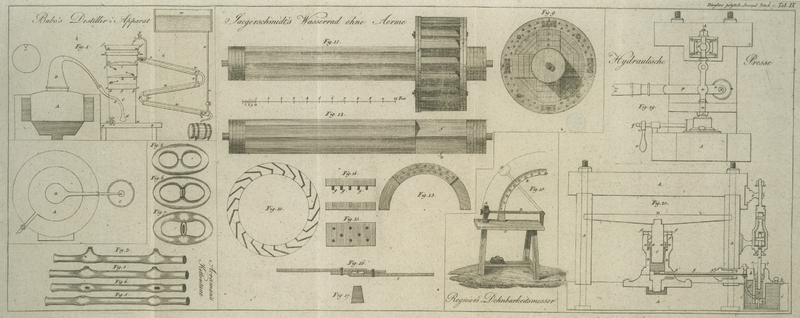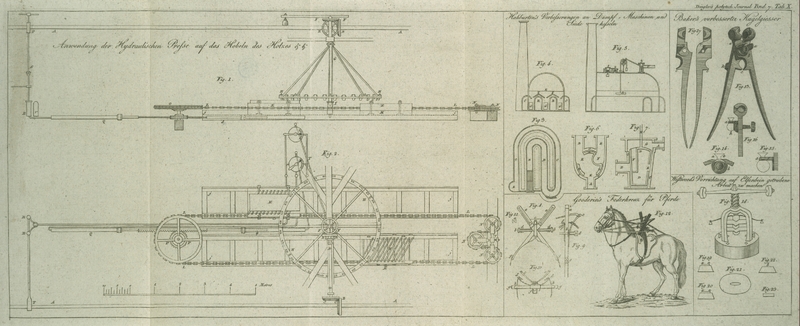| Titel: | Anwendung der hydraulischen Presse auf Zeughäuser, Pulverfabrikation, Abhobeln des Holzes, Bohren der Metalle etc. |
| Autor: | Hauptmann Franz Georg Friedrich Kausler [GND] |
| Fundstelle: | Band 7, Jahrgang 1822, Nr. LXVI., S. 440 |
| Download: | XML |
LXVI.
Anwendung der hydraulischen Presse auf Zeughäuser, Pulverfabrikation, Abhobeln des Holzes, Bohren der Metalle etc.
Auszug aus des Ingenieurs Dupin Reisen in England. 4 Baͤnd. 1821. Vom k. w. Artillerie Hauptmann v. Kaußler.
Mit Abbildungen auf Tab. IX. und X.
v. Kaußler über Anwendung der hydraulischen Presse.
Die aͤußerst sinnreichen Maschinen, deren die
Englaͤnder sich in ihren Zeughaͤusern bedienen, erhalten ihre raschen
Bewegungen durch
Dampfmaschinen, ihre langsamen dagegen durch hydraulische Pressen.
Diese lezten sind in England sehr gebraͤuchlich. Bramah, der Erfinder derselben, benuzte sie anfaͤnglich zum Abdruk
der geschriebenen Briefe in Copiermaschinen. Jezt dienen sie zur Auspressung des
Oels, sie wirken vortheilhafter, als andere in den Papiermuͤhlen, besonders
zu allen Gegenstaͤnden, die einen langsam und gleichfoͤrmig
fortschreitenden Druk erfodern.
Hier wollen wir uns bloß mit ihrer Anwendung auf die Fabrikation des Pulvers
beschaͤftigen.
Die hydraulischen Pressen erfodern ungeachtet der großen Wirkung, die sie
hervorbringen, keine besonders feste Gebaͤude; sie brauchen sogar weder Mauer
noch Zimmerwerk, indem sie auf kleine Wagen gestellt, uͤberall transportirt
werden koͤnnen.
Fig. 19. auf
Tab. IX. stellt eine Seitenansicht solcher Presse vor. Fig. 20. ist ein
verticaler Schnitt der Laͤnge nach.
A.A.A das Gebaͤlke. Es wird vermittelst Bolzen
von geschmiedetem Eisen, und Schrauben festzusammengezogen.
B.B Preß-Cilinder.
C Preß-Kolben.
D Scheibe von gegossenem Eisen, welche gegen die zu
pressenden Gegenstaͤnde druͤkt, wenn der Preß-Kolben sich im
Preß-Cilinder erhebt.
E Stifte, die in dem Preß-Cilinder eingelassen
sind, x.x.x die Liederung, sie besteht aus einem
doppelten Leder, von einem metallenen Ring umspannt, und durch die Stifte E in ihrem Lager festgehalten.
f durchgebohrte Huͤlse, durch welche der
Preß-Kolben geht. Vermittelst dieser Huͤlfe wird die Liederung fest an
den Preß-Cilinder angedruͤkt. Nach oben zu erweitert sich der Raum in derselben.
Dieser Raum wird mit in Oel getauchtem Werg angefuͤllt, und es wird darin
durch eine duͤnne Randleiste festgehalten. Diese Vorrichtung hat den
doppelten Zwek, den Cilinder mit Oel zu versehen, und das Einfallen jedes fremden
Koͤrpers zu beseitigen. g Roͤhre, welche
den Preß-Cilinder mit dem Druk-Cilinder verbindet.
g' Oeffnung in dem Preß-Cilinder, mit einer
Mutter versehen; hier wird das eine Ende der Roͤhre fest eingeschraubt.
y'' das andere Ende der Roͤhre mit ihrer zur
wasserdichten Befestigung versehenen Vorkehrung.
h Ventil, welches sich oͤffnet, wenn das Wasser
aus dem Druk-Cilinder in den Preß-Cilinder geht. ef ist in Form eines Nagelkopfes mit einem Stifte.
Eine Schraube uͤber demselben bestimmt den Raum, innerhalb welchem ef sich bewegen soll, und gestattet zugleich, wenn
man sie ganz herausschraubt, eine Untersuchung und Reparatur des Ventils.
i Behaͤlter, mit Wasser angefuͤllt.
k koͤgelfoͤrmiger Stoͤpser, den
Wasserbehaͤlter zu schließen. Durch diese Oeffnung kann das Wasser,
vermittelst eines Hebers heraus gelassen werden.
l Ventil, wodurch das Wasser aus dem
Wasserbehaͤlter in den Stiefel s dringt.
m Vorkehrung, in welcher das Ventil l sich befindet.
n der Druk-Kolben. In dessen Mitte ist ein Loch,
durch welches ein Hebel p geht, der an dem einen Ende in
u befestigt ist, und an dem anderen einen Handgriff
hat.
Das obere Ende dieses Druk-Kolbens bewegt sich in der Huͤlse t, die am Zimmerwerk befestigt ist.
o Huͤlse, vermittelst welcher die Liederung des
Kolbens n zusammengedruͤkt ist. Wo sie auf die
Liederung druͤkt, ist sie ausgehoͤlt, um das zur Liederung
noͤthige Oel zu fassen.
p Hebel, durch welchen der Kolben n in Bewegung gesezt wird.
q Hahn, der eine Roͤhre, die den Cilinder B mit dem Wasserbehaͤlter i verbindet, schließt. Wenn man diesen Hahn oͤffnet, so fließt
Wasser an den Preß-Cilinder in den Behaͤlter zuruͤk.
Das ist die einfache Konstruktion dieser Presse, dessen Mechanismus keiner weiteren
Beschreibung mehr bedarf. – Wir gehen daher auch zur Anwendung derselben auf
die Pulverfabrikation uͤber.
Es ist bekannt, daß die Kraft des Pulvers vermehrt wirkt, wenn die vollkommen
gemischten Theile desselben stark zusammengedruͤkt werden.
Um die Arbeiter vor der verderblichen Wirkung einer Explosion zu schuͤzen,
sind die beiden Cilinder, der Preß- und der Druk-Cilinder, in zwei
verschiedenen Zimmern, und von einander durch eine starke Mauer getrennt. Unter
dieser Mauer durch geht die Roͤhre g.
Die Mauer ist flach gebaut, der Verfasser wuͤrde vorschlagen, sie in Form
eines Cilinders zu bauen, weil sie bei einer Explosion, wie ein Gewoͤlbe,
besser widerstehen wuͤrde.
Die Pulvermaße, welche zusammengepreßt werden soll, wird in einen rechtwinkligen
hoͤlzernen, mit Blei gefuͤtterten, und mit kupfernen Baͤnden
umfaßten Kasten geschuͤttet. Der Dekel, und die vordere Seite desselben
koͤnnen weggenommen werden; wenn diese eingesezt ist, so wird sie durch
kupferne Riegel in ihrer Stelle befestigt.
Dieser Kasten faßt 150 Kilogr. Pulver. Statt das Pulver in Maße zu pressen, theilen
es die Englaͤnder in duͤnne Lagen, welche sie durch horizontal gelegte
kupferne Scheiben von einander trennen. Hiedurch wird das Zusammenpressen leichter und
vollstaͤndiger bewerkstelligt, und nachher das Pulver leichter
gekoͤrnt.
Soll der Kasten auf die Scheibe der Presse gebracht werden, so naͤhert man
dieser Scheibe ein kleines Geruͤst. Dieses Geruͤst ist mit zwei Falzen
versehen, in welchen der Boden des Troges laͤuft. Auf diesem Geruͤste
wird er gefuͤllt, mit seinem Dekel versehen, und dann auf die Scheibe der
Presse geschoben, die nun in Thaͤtigkeit gesezt wird.
Der Preis einer solchen Presse, an welcher alle Theile von Kupfer sind,
betraͤgt 400 Pfund St. Alle noͤthigen Handwerkzeuge sind mitbegriffen,
und man gibt auch noch die noͤthigen Zeichnungen mit dazuDer
kunstgemaͤße Bau einer solchen Presse, und die genaue Beschreibung
aller ihrer Theile werden in einem der folgenden Hefte umstaͤndlich
nachgetragen werden. D..
Anwendung der hydraulischen Presse auf das Abhobeln des Holzes.
Der merkwuͤrdigste Gebrauch, den man bis auf den heutigen Tag an der
hydraulischen Presse gemacht hat, ist, daß man diese Maschine zum Abhobeln des
Holzes anwendet, (Planning machine). Dabei hat man eine
Menge Schwierigkeiten zu uͤberwinden, und eine große Anzahl wesentlicher
Bedingungen zu erfuͤllen. Im Artillerie-Zeughaus zu Woolwich gelang es
Bramah, seinen Zwek in dieser Hinsicht auf die gluͤklichste Weise zu
erreichen.
Ein horizontales eisernes Rad von etwa 3 Mêtres im Durchmesser, ist durch
Querhoͤlzer, und eiserne Zugbaͤnder, unter einem Winkel von 45°
geneigt, mit seiner Achse fest verbunden. Dieses Rad ist in 32 gleiche Theile
getheilt. In jedem Theilungspunkt befindet sich ein Zapfenloch, durch welches der
obere Theil einer Schneide oder eines Meissels geht. Die Schneiden sind halb
cilinderfoͤrmig gekruͤmmt, so, daß die Achse dieses Cilinders etwa einen
Winkel von 30 Graden mit den Horizont macht; eigentlich sind es sehr starke schiefe
Meissel.
Auf jeder Seite der Achse des Rades befindet sich ein verlaͤngerter Schlitten,
dessen parallele Waͤnde in horizontaler Richtung das zu hobelnde Holz tragen,
welches vermittelst Stellschrauben an diese Waͤnde befestigt ist. Nicht alle
Meissel sind dergestalt gestellt, daß sie im Holz einen Falz von gleicher Tiefe
machen, je fuͤnf oder je sechs derselben sind zusammengerichtet, so, daß der
erste der 5 oder 6, welcher am weitesten von der Achsendrehung entfernt ist, den
mindest tiefen Einschnitt macht; der zweite geht schon etwas tiefer, der dritte noch
mehr, und so fort. Dadurch erhaͤlt man den Vortheil, von den
hervorstehendsten Theilen der Oberflaͤche des zu ebnenden Holzes
noͤtigenfalls bis auf zwei Centimetres, wegnehmen zu koͤnnen.
Wenn die 32 Meissel ihre Umdrehung gemacht haben, so geben die auf dem Holze
befindlichen 32 Vertiefungen zusammen der Breite nach einen Raum, der gleich der
Groͤße ist, um welche der Schlitten waͤhrend einer Umdrehung des Rades
vorgeruͤkt ist. Ist daher die Bewegung des Rades sehr beschleunigt, die des
Schlittens dagegen sehr langsam, so werden jene 32 Vertiefungen oder
Meissel-Spuren einen sehr kleinen Raum einnehmen, und gleichsam eine bis auf
weniges ebene Oberflaͤche darstellen.
Um das Holz vollkommen glatt zu machen, ist ein Hobel auf der Peripherie des Rads
befestigt. Wenn alle Meissel ihre Furchen sehr enge auf einander gezogen haben, so
werden alle Erhabenheiten dieser Furchen auf einmal durch den Hobel weggenommen.
Diese Wirkung ist sehr augenscheinlich; jeder Hohlmeisel, wirft, wenn er
uͤber das Holz hingeht, durch die Wirkung der Centrifugalkraft
faͤcherfoͤrmige Spaͤne auf; die Holzstreifen
vervielfaͤltigen sich immer mehr, bis endlich der Hobel alle in einem Augenblik wegnimmt, und
nur noch eine geometrisch richtige Oberflaͤche uͤbrig
laͤßt.
Haͤtte das Rad, dessen Durchmesser 3 Metres betraͤgt, nicht eine so
aͤußerst genaue Bewegung, so wuͤrden theils die Hobel tiefer
schneiden, als die Meissel, und daher einen ungeheuren Widerstand erleiden, theils
wuͤrden sie uͤber die Streifen weggehen, und die Unebenheiten
derselben nicht hinwegnehmen. Dann wuͤrde das Holz nach der Bearbeitung noch
Vertiefungen und Erhoͤhungen darbieten; es muͤßte daher durch die
gewoͤhnlichen Mittel aufs Neue abgehobelt werden.
Die Achse des Rades dreht sich in zwei Hohlcilindern, von denen der eine in dem
Fußboden, der andere an der Deke des Gebaͤudes unveraͤnderlich
festgemacht ist. Sie geht etwas uͤber den oberen Cilinder hinaus; auf ihren
obern Theil ruht ein Hebel, der seine Unterlage auf der einen Seite hat, und auf der
andern ein Gewicht traͤgt, um dadurch einen bestimmten Druk auf die Achse
auszuuͤben. Hiedurch sind die Meisel mit einem Gewicht beschwert,
vermoͤg dessen sie im Stande sind, den Widerstand des Holzes, das sie
abhobeln, zu uͤberwinden. Da aber die Tiefe der Meisselstreifen das Resultat
eines Gleichgewichts zwischen dem bestaͤndigen Druk der Meissel, und dem
veraͤnderlichen Widerstand der rohen Oberflaͤche des Holzes ist, so
kann diese Tiefe etwas kleiner seyn beim ersten Gang der Meissel, die das zweitemal
die hervorstehenden oder sehr harten Theile vollends wegnehmen; dadurch wird das
Zerbrechen oder Absprengen der Meissel vermieden.
Aus diesem Grunde sind die 32 Meissel, statt alle gleichlang zu seyn, je zu 5 bis 6
nach einer Stufenfolge gerichtet, so daß sie von 1 bis 6 immer, jedoch nur um sehr
wenig, laͤnger werden, und daher das vollenden, was die ersten nicht
bewerkstelligen konnten. Oft soll Holz abgehobelt werden, dessen Dike sehr
verschieden ist, waͤhrend die Hoͤhe des Schlittens so wie die Lage der
Seitenwaͤnde, in welcher dieser laͤuft, bestaͤndig, d.h.
unveraͤnderlich ist; die Ebene der Meissel muß sich daher der obern
Flaͤche des Schlittens naͤhern oder von ihr entfernen, und zwar um
einen Abstand, der der Dike des jedesmahl abzuhobelden Stuͤks Holz gleich
ist; dieß wird durch die hydraulische Presse bewerkstelligt.
Die Achse des mit Meisseln versehenen Rades dreht sich in einem conischen Loch auf
der Spitze eines Stempels, der in dem Cilinder einer hidraulischen Presse befindlich
ist. Laͤßt man Wasser in diesen Cilinder eindringen, so erhebt dieses die
Achse des Rades, und mit diesen zugleich die horizontale Ebene der Meissel. Die
entgegengesezte Wirkung kommt zum Vorschien, wenn man das Wasser ablaͤßt. Ein
Zeiger, der laͤngs eines in Grade eingetheilten Maaßstabes auf einen der
aufrechten Pfaͤhle neben dem Rade sich bewegt, bezeichnet die Dike des zu
bearbeitenden Holzes, welche aus den verschiedenen Erhoͤhungen des Rades
erfolgen. Dadurch also, daß man den Hahn, der Wasser in die hidraulische Presse
aus- und einlaßt, oͤffnet oder schließt, kann man das Holz in
diejenige Lage bringen, welche es je zu der betreffenden Arbeit haben soll.
Wir haben gesagt, daß sich zwei aͤhnliche Schlitten an der Maschine befinden,
und auf jeder Seite der Achse einer. Sie bewegen sich in entgegengesezter Richtung.
Wenn sich die Schlitten zu gleicher Zeit bewegen, so muͤssen die
Hoͤlzer von gleicher Dike seyn; oder es muß unter das duͤnere eine
Unterlage gelegt werden. Gewoͤhnlich hobelt man Laffetenwaͤnde,
Raͤder von einerlei Kaliber zu gleicher Zeit ab. Die Holzstuͤken
werden durch Schrauben auf den Schlitten fest gehalten.
Vermittelst der Hydraulischen Presse wird nicht nur die Hoͤhe des arbeitenden
Rades bestimt, sondern es wird auch die vor und ruͤkgaͤngige Bewegung der
Schlitten durch die Wirkung einer aͤhnlichen Presse ausgefuͤhrt. Eine
Kette ohne Ende laͤuft durch die beiden Seitenwaͤnde, in welchen die
Schlitten sich bewegen, und dann nach Belieben vermittelst einer einfachen
Vorrichtung an jeden derselben befestigt werden. Sollen nehmlich beide Schlitten
sich zu gleicher Zeit bewegen, so wird die Kette ohne Ende an beide befestigt; soll
sich nur ein Schlitten bewegen, so wird die Kette nur an diesen befestigt, von dem
andern aber los gemacht. Diese Kette liegt an ein grosses horizontales Rad an, das
auf seiner Achse ein 2 bis 3 mal kleineres gezahntes Rad traͤgtDamit die
Kette ohne Ende weder nachlassen, noch durch den Gebrauch oder die Hize sich
verlaͤngern kann, wodurch die Bewegung der Schlitten gehemmt werden
wuͤrde, so ist es noͤthig, sie in immerwaͤhrender
Spannung zu erhalten. Am aussersten Ende der Seitenwande, in denen die
Schlitten laufen, lauft die Kette in der Hehlkehle von 3 Raͤdern, von
denen je eines in der Verlaͤngerung jeder Seitenwand und das dritte
in der Mitte befestigt ist. Die Achse bei dem ersten ist unbeweglich, die
des dritten Rades aber ist beweglich, und kann vermittelst einer Schraube
vor oder zuruͤk bewegt werden.. Der Preß-Kolben
einer hydraulischen Presse ist mit einer geraden gezahnten Stange versehen, welche
in das kleine gezahnte Rad, von den oben die Rede war, eingreift. Wird nun Wasser in
den Cilinder der Presse gelassen, so treibt dieses den Kolben, die gezahnte Stange
dreht das Rad, uͤber welches die Kette ohne Ende gespannt ist, und beide
Schlitten bewegen sich gleichfoͤrmig, der eine, um sich der Presse zu
naͤhern, der andere, um sich davon zu entfernen.
Die gezahnte Stange bewegt an ihrem entgegengesezten Ende einem zweiten Kolben in
einem Cilinder, dessen entgegengesezte Wirkung den Schlitten
ruͤkwaͤrts bewegt. Da dieser zweite Cilinder von kleinerem
Durchmesser, als der erste ist, so geht, bei uͤbrigens gleichen Umstaͤnden
die ruͤkgaͤngige Bewegung des Schlittens um vieles schneller von
statten, als die Bewegung vorwaͤrts; dieß ist sehr natuͤrlich, da bei
der ruͤkgaͤngigen Bewegung die Messet nicht arbeiten, und daher von
den Stempel nur der Widerstand, den die Reibung verursacht, zu uͤberwinden
ist.
Da die Geschwindigkeit des mit den Messeln versehenen Rades als bestaͤndig
angenommen wurde, so werden die Meissel um so mehr zu arbeiten haben, je breiter und
haͤrter das abzuhobelnde Holz ist, und je mehr ihm von seiner Dike genommen
werden soll. Um daher die Reibung der Meissel bestaͤndig zu machen, muß man
den Gang der Schlitten mehr oder weniger beschleunigen, je, nach den Dimensionen und
der Beschaffenheit des Holzes, welches abgehobelt werden soll.
Ein Hahn laͤßt eine groͤßere oder kleinere Menge Wassers in den
Cilinder der hidraulischen Pressen eindringen, und von dieser Menge Wassers
haͤngt die Geschwindigkeit der Schlitten bei ihrer Bewegung vorwaͤrts
ab. Der Griff dieses Hahns hat die Gestalt eines Zeigers, der sich auf einem in
Grade eingetheilten Kreise bewegt. Ist der Hahn vollkommen geschlossen, so wird das
Maximum der Geschwindigkeit erreicht; ist der Hahn
ganz aufgedreht, so fließt das Wasser in den Behaͤlter ab, und die
Geschwindigkeit ist Null. Auf aͤhnliche Weise befindet sich auch ein Hahn,
ein Zeiger und ein Quadrat an der Leitungsroͤhre, welche das noͤthige
Wasser zur Ruͤkbewegung der Schlitten liefert.
Die urspruͤngliche bewegende Kraft des ganzen Sistems ist eine Dampfmaschine,
welche mit der Kraft von 6 Pferden arbeitet. An der Mauer, welche den von der
Dampfmaschine und von der Hobelmaschine eingenommenen Raum trennt, ist eine eiserne
horizontale Stange, die an einem Ende ein kreisfoͤrmiges Loch hat, in einen
halberhabenen Kreis von gleichem Durchmesser eingelassen. Dieser Kreis ist auf
exzentrische Art an der
horizontalen Achse befestigt, die unmittelbar durch die Dampfmaschine bewegt wird.
Das andere Ende der Stange ist durch einen Bolzen an dem einen Arm eines umgebogenen
Hobels befestigt, dessen zweiter Arm den Stempel eines Saugewerks in Bewegung sezt.
Durch diese Bewegung kommen zwei Saugewerke in Thaͤtigkeit; Das erste dient
zur horizontalen Bewegung des Schlittens, das andere zur verticalen Bewegung des mit
Meisseln versehenen Rades.
Aus dieses Beschreibung geht hervor, daß jede Umdrehung der horizontalen Achse eine
Umdrehung der vertikalen Achse erzeugt (wenn man die Mittel-Raͤder,
welche einander die Bewegung mitheilen, als gleich annimmt); in der nehmlichen Zeit
hebt und senkt die horizontale Stange den Stempel einmal, der die Schlitten in
Bewegung sezt; die Menge des in die hydraulische Presse eindringenden Wassers steht
daher im Verhaͤltniß mit dem Raum, den die Meissel an dem arbeitenden Rade
durchlaufen. Welches daher auch die Geschwindigkeit der Dampfmaschine, die die
bewegende Kraft ertheilt, seyn mag, so haben die durch die Meissel gezogenen Furchen
die nehmliche Breite, so lange der Zeiger, der den Lauf der Schlitten bezeichnet,
auf dem nehmlichen Punkt des Quadranden bleibt.
Die eben beschriebene Maschine ist in jedem ihrer einzelnen Theile einfach und leicht
zu unterhalten. Ein kleiner Keil oder eine Schraube reichen hin, um jedes
Schneidzeug einzeln zu befestigen, oder heraus zu nehmen. Die beiden einfachen
Verzahnungen arbeiten, ohne sehr zu erleiden. Gleichwohl muß man, wenn das Hauptrad
in Bewegung gesezt werden soll, Sorge tragen, es vorher mit der Hand zu drehen, weil
sonst leicht Zaͤhne an den Raͤdern durch die Gewalt, mit der die
Dampfmaschine arbeitet, abgebrochen werden.
Diese Maschine ist zwar beim ersten Ankauf allerdings kostspielig; betrachtet man
jedoch die geringen Unterhaltungskosten, welche sie erfodert, und die außerordentliche
Schnelligkeit, mit welcher sie arbeitet, so findet man, daß es oͤkonomisch
ist, sie anzuwenden; denn im Augenblik des Bedarfs muß eine Maschine
unermaͤßliche Resultate geben, die in 1 bis 2 Minuten jede Laffetenwand vom
groͤßten Caliber mit groͤßter Vollkommenheit abhobelt.
Hydraulische Presse zum Bohren der Metalle.
In dem Zeughaus zu Woolwich dient eine kleine hydraulische Presse zum Bohren der
Metalle. Eine Dampfmaschine sezt den senkrechten Bohrer in Bewegung, der nach Unten
arbeitet. Mit der einen Hand legt der Arbeiter das Stuͤk Metall, in welches
er ein mehr oder minder tiefes Loch bohren will, unter den Bohrer, und auf die
Unterlage der hydraulischen Presse, mit der andern Hand druͤkt er auf den
Hobel der Wasser einlassenden Pompe und ordnet die Bewegung dergestalt an, daß sich
das Stuͤk Metall dem Bohrer nach Maasgabe seiner Arbeit nuͤhert.
Beschreibung der Zeichnung der Maschine zum Abhobeln des Holzes. (Planing-Machine.)
Fig. 1. und
2. Tab. X.
Vertikale und horizontale Projection der Maschine. Urspruͤngliche bewegende
Kraft, einer Dampfmaschine; Achse A. –
Winkel-Raͤder B.C. – Achse D. – Winkelraͤder E.F.; – Achse G. – Rad, das mit
Meisseln und Hobeln versehen ist, H. – I. Cilinder einer hydraulischen Presse, um das Rad HH zu senken oder zu erhoͤhen; II. Seitenwaͤnde, die eine vor, die andern
hinter der Achse F; K, Schlitten, welche in jeder der
Seitenwaͤnde laufen, und das abzuhebelnde Holz tragen. L, L, Kette ohne Ende, welche die Schlitten bewegt; M, Schraubenkopf, vermittelst dessen die Ketten ohne Ende an den Schlitten
befestigt ist, und ohne welchen sich dieser nicht bewegen kann. N. drei Raͤder, von denen zwei an ihner Achse
befestigt, das dritte
beweglich ist, die Kette lauft uͤber diese drei Raͤder, sie wird
staͤrker angespant, wenn man das mittlere Rad vermittelst einen Schrauben V vorwaͤrts bewegt; O
grosses Rad am andern Ende der Kette; P gezahntes Rad,
das eine und dieselbe Achse mit dem Rad O hat, und seine
Bewegung durch eine gezahnte Stange erhaͤlt, die sich in 2 Stempel endigt,
von denen der eine in dem Cylinder Q, der andere in den
Cilinder q laͤuft; Qq arbeitende Cilinder eine hydraulischen Presse, deren Wasser aus der
Roͤhre R kommt; RR zwei Pumpen; r Luftbehaͤlter zum
Behuf der Fortdauer der Wirkung der Pumpen; S, Schaft
der Pumpe.