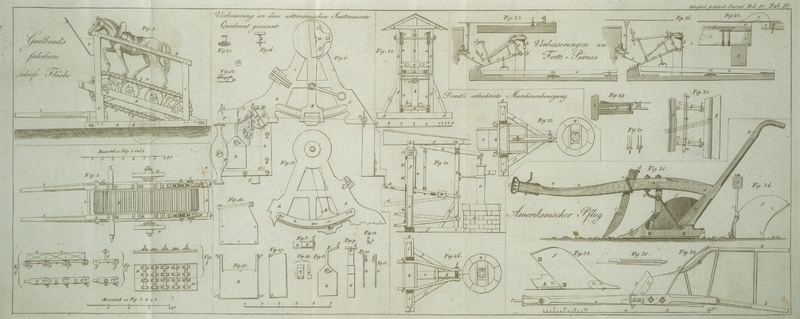| Titel: | Ueber eine neue Verbindung mechanischer Kräfte, wodurch die Schwere und die Muskelkraft des Menschen zum Treiben einer Maschine, welche Wasser oder was immer in die Höhe hebt, vortheilhafter als bisher verwendet werden kann, und worauf Alphons Doxat, Esqu. in London, Bishopsgatestreet, dd. 27. Jänner 1821 ein Patent erhielt. |
| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. XX., S. 136 |
| Download: | XML |
XX.
Ueber eine neue Verbindung mechanischer Kräfte, wodurch die Schwere und die Muskelkraft des Menschen zum Treiben einer Maschine,
welche Wasser oder was immer in die Höhe hebt, vortheilhafter als bisher verwendet werden kann, und worauf Alphons Doxat, Esqu. in London, Bishopsgatestreet, dd. 27. Jänner 1821 ein Patent erhielt.
Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXLVII. December 1822. S. 9.
Mit Abbildungen auf Tab. IV.
Doxat über eine neue Verbindung mechanischer Kräfte.
Herrn Doxat's Erfindung besteht in
einer neuen und vortheilhaften Verbindung von Hebeln und Rollen, wodurch ein Mensch
sowohl das Gewicht seines Koͤrpers als seine Muskelkraft so anwenden kann,
daß die verschiedenen Haltungen seines Koͤrpers waͤhrend des Umtriebes
der Maschine weniger muͤhevoll und ermuͤdend fuͤr ihn sind, als
bei gewoͤhnlichen Maschinen, die durch Menschenkraft getrieben werden.
Hr. Doxat beschrieb seine Maschine in Anwendung auf eine
Pumpe, durch welche das Wasser aus einem tiefen Brunnen gezogen werden soll.
Fig. 21
stellt einen Seiten-Aufriß der ganzen Maschine neben dem Brunnen dar. Fig. 22 zeigt
sie von Vorne.
Fig. 23 zeigt
den Grundriß eines Theiles der Maschine, um die Form des Hebels darzustellen, auf
welchen der Arbeiter, der die Maschine treiben will, sich sezt, weßwegen auch dieser
Hebel der Sizhebel, A, heißt.
Der Arbeiter druͤkt hier durch das Gewicht seines Koͤrpers den Hebel nieder, und
hebt das Wasser aus dem Brunnen.
Fig. 24 zeigt
einen anderen Grundriß unter dem vorigen, um die Lage und Form des Fußhebels
B zu erlaͤutern, auf welchen der Arbeiter mit
seinen Fuͤßen tritt, wenn er sich niedersezt. Der Hebel B ist mit dem Hebel A
mittelst Ketten oder Strike, nn, verbunden, die
uͤber Rollen, CC, in Fig. 21 und 22 laufen, so
daß, wenn der Sizhebel niedersteigt, der Fußhebel sich hebt, und wenn dieser
niedergetreten wird, der Sizhebel sammt dem daran angebrachten Gewichte, W, Fig. 21, so in die
Hoͤhe gezogen wird, daß dieser durch das Gewicht des Koͤrpers und des
Gewichtes W selbst wieder sinken muß. Das Gestell der
Maschine besteht aus einem starken Balken, dd, in
dessen Mitte ein Pfosten, ee, senkrecht
eingefalzt, und durch zwei diagonale Sparren gestuͤzt ist. Vergl. Fig. 23 u.
24. gg sind zwei senkrechte Pfosten, die an ihrem
unteren Ende in den Grundbalken, dd,
eingeschlossen und oben durch ein Querstuͤk, hh, verbunden sind. Sieh Fig. 21 und 22. Die
Pfosten, gg, sind an der Seite durch die
Querhoͤlzer, ii, gestuͤzt, die von
den Grundbalken, dd, aufsteigen: die senkrechten
Pfosten. gg, dienen zur Leitung der Siz- und
Fußhebel, A und B, und auch
zur Stuͤzung der Achsen der Rollen, CC. k ist ein aufrechter Pfosten, welcher unten in den
Grundbalken, ee, eingelassen, und oben durch das
Stuͤk m befestigt ist, welches unter rechten
Winkeln auf den Querhoͤlzern, hh, steht.
Der obere Theil des Gestelles wird durch diagonale Arme, p, verstaͤrkt, welche man in Fig. 21 von der Kante
sieht, und der senkrechte Pfosten ist durch den Diagonalarm, q, gestuͤzt, und dient als Stuͤze fuͤr die
Drehepuncte des Fußhebels, b, des Sizhebels, a, und des Pumpenhebels, D.
Der Sizhebel ist mit dem Pumpenhebel mittelst einer Verbindungs-Stange, E, verbunden, welche an ihren beiden Enden an diesen
Hebeln befestigt ist, so daß der Sizhebel bei seinem Niedersteigen das
laͤngere Ende des Pumpenhebels mit sich hinabzieht, und das kuͤrzere
Ende, an welchem die Pumpenstange, F,
Im Originale heißt es E. A. d. Ueb. angebracht ist, in die Hoͤhe zieht. G ist
die Pumpe von
gewoͤhnlicher Bauart im Brunnen H, dessen Wasser
durch die Roͤhre J entleert wird. Die Maschine
ist in dem Augenblike dargestellt, wo der Arbeiter mit der Gewalt seiner Schenkel
und Arme sich aufgehoben hat, und wartet bis der Sizhebel das oberste Ende seiner
Laufbahn erreicht, und den Staͤmpel in den Brunnen getaucht hat,
waͤhrend der Fußhebel an den Ketten, nn,
uͤber die Rollen, CC, hinabsteigt, und auf
dem Puncte ist, einen kraͤftigen Zug an der Pumpe zu thun.
Die Maschine wird auf folgende Weise in Thaͤtigkeit gesezt. Man nehme an, die
Hebel A und B befanden sich
in der in Fig.
1 durch die punctirten Linien angedeuteten Lage; naͤmlich der
Sizhebel sey unten am Ende seiner Laufbahn, und der Fußhebel sey von den Striken,
nn, hinaufgezogen, so daß die Pumpenstange F am Ende ihres Zuges ist. Nun sezt sich der Arbeiter
auf den Siz A, indem er seine Kniee hinaufzieht, so daß
seine Fuͤße auf dem Ende des aͤußersten Fußhebels, B, ruhen; er strekt jezt seine Arme aus, und ergreift
den Querbalken, K, der an den Striken, nn, befestigt ist, und in Falzen in den Leisten,
LL, laͤuft, welche an den senkrechten
Pfosten, gg, angebracht sind, so daß ex mit dem
Fußhebel auf- und niedersteigt. In dieser Lage ist der Arbeiter gerichtet, auf die
Maschine zu wirken, indem er seinen Koͤrper mittelst der Muskelkraft seiner
Arme an dem Querbalken, K, in eine senkrechte Stellung
erhebt, und zugleich seine Schenkel mit seinen Fuͤßen auf den Fußhebel B thaͤtig seyn laͤßt, welcher hinabsteigt,
und den Sizhebel, A, sammt dem Gewichte, W, mittelst der Strike, nn, in die in Fig. 21 dargestellte Lage
bringt, wo dann der Koͤrper des Arbeiters in einer beinahe senkrechten
Stellung ist, und in dieser beinahe bis an das untere Ende seiner Laufbahn
hinabsteigt und die Pumpenstange F zugleich mit der
geschoͤpften Wassersaͤule mit einer Kraft in die Hoͤhe zieht,
welche dem Gewichte seines Koͤrpers und dem Gewichte, W, am Sizhebel gleich ist. Nun sezt er sich wieder auf den Sizhebel, A, laͤßt den Fußhebel frei aufsteigen, und auch
den an den Striken, nn, befestigten Querbalken,
K, wo dann die vorige Wirkung wiederholt wird. Auf
diese Weise kann ein Mensch, ohne zu ermuͤden, eine
verhaͤltnißmaͤßig groͤßere Kraft anbringen, als auf die
gewoͤhnliche Weise mittelst Kurbeln, Hebel etc. Das Gewicht, W, kann nach Belieben an dem Hebel A hin und hergeschoben, und naͤher oder weiter von dem Mittelpuncte
der Bewegung b,Im Originale heißt es, a. A. d. Ueb. angebracht werden, je nachdem naͤmlich der Arbeiter mehr oder minder
schwer ist.
Diese Maschine kann auf verschiedene Weise abgeaͤndert werden; die Siz- und
Fußbretter koͤnnen in senkrechten Falzen in den aufrechten Pfosten, gg, auf- und niedersteigen, und in diesem Falle
kann der Pumpenhebel D, und die Verbindungsstange E, wegbleiben, und die Pumpe mittelst eines Strikes oder
einer Kette getrieben werden, welche um ein Rad laͤuft, das an der Achse der
Rollen, CC, befestigt ist, und entweder
unmittelbar an der Pumpenstange angebunden wird, oder uͤber Rollen
laͤuft, je nachdem es die Umstaͤnde erfodern. Die obere Oeffnung des
Brunnens kann auch nahe an der Erde angebracht, und der Pumpenhebel dann
laͤnger gemacht werden, so daß, wenn der Arbeiter am Ende desselben sizt, er
seine Fuͤße auf die Erde aufstellen kann. Man kann Handhaben an dem Gestelle
der Maschine anbringen, an welchen der Arbeiter sich halten kann, wenn er aufstehen
muß, und Riemen oder eine andere Vorrichtung uͤber seine Schultern laufen
lassen, damit er das Gewicht, W, welches in diesem Falle
auf dem Brunnenhebel angebracht seyn muß, eben so, wie vorher am Sizhebel, dem
Mittelpuncte der Bewegung naͤhern, oder von demselben entfernen kann. Hier
fallen dann die Rollen, CC, der Sizhebel, A, und der Fußhebel, B,
sammt der Verbindungs-Stange E weg, und bloß der
Pumpenhebel mit Siz und Handhaben sind noͤthig. Indessen empfiehlt Hr. Doxat doch das bewegliche Fußbrett.
Form, Verhaͤltniß und Materiale der Maschine uͤberlaͤßt Hr. Doxat dem Ermessen des WerkmeistersIn so fern wir nicht aus Erfahrung wissen, ob und wie lang und mit welchem
Erfolge diese Maschine irgendwo in England angewendet wurde, wird uns Hr.
Doxat erlauben zu zweifeln, daß der Arbeiter,
der an dieser Maschine angespannt ist, und mit Haͤnden und
Fuͤßen und mit den Gefaͤßmuskeln arbeiten muß, nicht
muͤder wird als derjenige, der bloß mit den Haͤnden oder bloß
mit den Fuͤßen arbeitet. Daß das oft wiederholte Aufstehen und
Niedersizen sehr ermuͤdet, daruͤber haben wir sogar eines
Tages einen Praͤlaten klagen hoͤren. Wie erst, wenn dieß den
ganzen Tag uͤber so fort gehen muß! Daß hier wenigstens die Kleider
sehr leiden muͤßen, ist offenbar. A. d. Ueb..
Tafeln