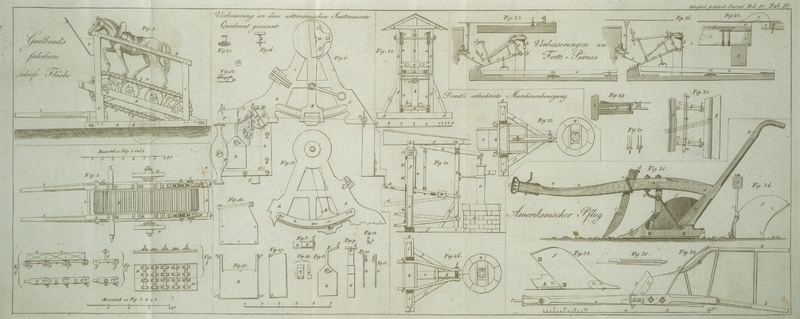| Titel: | Ueber gewisse Verbesserungen an Forte-Pianos und anderen musikalischen Tasten-Instrumenten, worauf Herr Pierre Everard im Junius 1822 ein Patent erhielt. Diese Verbesserungen wurden von einem Ausländer mitgetheilt. |
| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. XXI., S. 140 |
| Download: | XML |
XXI.
Ueber gewisse Verbesserungen an Forte-Pianos und anderen musikalischen Tasten-Instrumenten, worauf Herr Pierre Everard im Junius 1822 ein Patent erhielt. Diese Verbesserungen wurden von einem Ausländer mitgetheilt.
Aus dem Londoner Journal of Arts et Sciences. November 1822. S. 230.
Mit Abbildungen auf Tafel IV.
Everard, über Verbesserungen an Forte-Pianos.
Diese Verbesserungen bestehen in verschiedenen Abweichungen
von dem gewoͤhnlichen Baue der Forte-Pianos. Die erste derselben ist
„eine neue und verbesserte Einrichtung jenes Mechanismus, der unter
dem Namen des Abfalles (echappement) bekannt ist.
Gewoͤhnliche Forte-Pianos, ohne Abfall, oder wo die Heber der
Haͤmmer unbeweglich sind, haben zwar den Vortheil, daß sie sich leicht
spielen lassen; sie haben aber den Nachtheil, daß der Hammer, nachdem er die
Saite beruͤhrte oder anschlug, leicht wieder zu derselben auffliegt, und
sie in ihrer freien Schwingung hindert, ja sogar selbst oft den Ton verdirbt. Um
diesem Uebel abzuhelfen, hat man an diesen Hebern einen Abfall angebracht,
wodurch der Hammer frei von der Saite abfallen kann, nachdem er dieselbe
angeschlagen hat. Allein durch diese Vorrichtung entsteht wieder ein großer
Nachtheil fuͤr den Spieler, naͤmlich der, daß er immer den Finger
aufheben muß, damit die Taste sich wieder bis zur Hoͤhe der
uͤbrigen Tasten heben kann, ehe der Hammer wieder anzuschlagen oder einen
Ton zu weken im Stande ist: denn, ohne daß die Taste sich bis dahin erhebt, kann
der Heber nicht unter den Hammer herab gelangen.“
Diesen Schwierigkeiten soll nun durch gegenwaͤrtige Erfindung abgeholfen
werden, welche vier Stuͤke bei der Wirkung der Taste vereinigt.
„Das erste ist die Anwendung einer Feder zur Stuͤzung der
Schwere des Hammers, nachdem derselbe seinen Schlag vollbracht hat, und von
seinem Stuͤzpuncte auf dem Heber abgefallen ist. Das zweite, eine
Beruͤhrung, welche zwischen dem Hammer in der Naͤhe des
Mittelpunktes seiner Bewegung und der Feder oder des Hebels, der mit einer solchen
Feder verbunden ist, und von derselben gestuͤzt wird. Statt hat zu
erzeugen, um den Fall des Hammers vorzubereiten, wo sein Abfall eintritt. Das
dritte, ein Hebel, welcher, waͤhrend er sich um seinen Mittelpunct dreht,
den Abfall des Hebers unter den Hammer bewirkt. Das vierte ein, mit einer
Stellschraube so vorgerichtetes Stuͤk, daß es den Hammer in seinem Falle
auffaͤngt, und so lang haͤlt, als man die Taste nieder
druͤkt, damit es demselben durchaus unmoͤglich wird, wieder an die
Saite anzuschlagen, waͤhrend die Taste durch das leiseste Heben der
Fingerspize emporsteigt.“
Fig. 25 Taf.
IV zeigt die Einrichtung nach dem neuen Mechanismus an einer Forte-Piano Taste,
waͤhrend dieselbe in Ruhe ist. Fig. 26 zeigt dieselbe in
Thaͤtigkeit, d.h., die Taste niedergedruͤkt und den Hammer hinauf
getrieben. Dieselben Buchstaben bezeichen dieselben Gegenstaͤnde. a ist die Taste. b, der
Hammer, welcher mittelst eines Zwischen-Hebels, c, durch
den Heber, d, in Bewegung gesezt wird, der sich an
seinem unteren Ende in einem Gelenke bewegt. Bei e ist
ein Buͤgel an dem Schwanze des Hammers, und der Hammer wird durch eine Feder
gestuͤzt, welche mit dem Stuͤke f mit
einer Schraube um die Spannung zu regeln, verbunden ist. Der Heber, welcher gegen
den Schwanz des Hammers wirkt, hebt denselben jedesmal, wenn die Taste
niedergedruͤkt ist, wie Fig. 26 zeigt, und macht
auf diese Weise, daß er an die Saite anschlaͤgt. Waͤhrend dieß
geschieht, kommt das Ende des Hebels, f, in
Beruͤhrung mit dem Schwanze des Hammers nahe an seinem Drehepuncte, und da
der Hammer nun nicht mehr weiter herabsteigen kann, faͤllt er durch seine
eigene Schwere, und treibt das Stuͤk f in
Gegensaz mit der Feder. In dieser Lage hat die Feder keine Kraft oder Wirkung auf
den Hammer, welcher durch den an ihm ruhenden Heber gestuͤzt wird. Der
hervorstehende Schweif, g, des Hebers kommt jezt in
Beruͤhrung mit dem stellbaren Hemmer h, und wird,
indem er gegen denselben druͤkt, niedergedruͤkt, und macht den Heber
unter dem Buͤgel abfallen. In demselben Augenblike faͤllt der Hammer
unter die keilfoͤrmige Spize des stellbaren Stuͤkes i, welches denselben hindert, wieder an die Saite hinauf
zu fliegen, und so lang ruhig haͤlt, als die Taste unten bleibt.
Verbunden mit obigem Mechanismus kommt hier eine neue Art von Daͤmpfung vor,
welche bedeutende Vorzuͤge vor der bisher gebraͤuchlichen besizt;
naͤmlich, die Schwingungen der Saiten mittelst einer Feder auf einmal zu
unterbrechen. k und l sind
zwei kleine Hebel, welche sich um denselben Mittelpunkt bewegen, und mittelst einer
Feder und des kleinen Hakens, m, in gehoͤriger
Entfernung von einander gehalten werden. An dem Ende des Hebels k befindet sich das Staͤbchen n, welches den Daͤmpfer an die Saite hinauf
bringt. o ist ein anderes an dem Hebel c angebrachtes Staͤbchen, welches sich zugleich
mit demselben bewegt, und den Daͤmpfer stuͤzt. Wenn die Taste
niedergedruͤkt wird, steigt der Daͤmpfer herab, und erlaubt der Saite
sich frei zu bewegen. Um das Forte mittelst des Pedales hervorzubringen, oder die
Daͤmpfung von der Saite zu entfernen, ist ein Stuͤk, p, angebracht, welches, mittelst der
gewoͤhnlichen Pedal-Vorrichtung, auf die Hebel k
herabgebracht wird, und die Daͤmpfung niederzieht; die kleine Feder zwischen
den Hebeln gestattet dem Hebel k niederzusteigen, ohne
daß die uͤbrigen Theile des Mechanismus dadurch gestoͤrt
wuͤrden. Um die Stellung der Haͤmmer unter den Saiten gehoͤrig
richten zu koͤnnen, bildet ein Schieber q das
Angel-Gelenk des Hammers, welcher mittelst einer Schraube an den Zapfen befestigt
ist, so daß er nach Belieben gestellt werden kann. Der Mittelpunkt der Bewegung des
Hebels, c, ist mit einer aͤhnlichen Vorrichtung
zum Stellen versehen.
Fig. 27 zeigt
zwei neue Arten, die Saiten auf dem Stege zu halten, die statt des
gewoͤhnlichen Steges neben den Ruhestiften, wie r, in Fig.
25, an einem Ende angebracht sind. Diese Vorrichtungen koͤnnen
fuͤr zwei, drei oder fuͤr mehrere Saiten benuͤzt werden:
fuͤr die staͤrkeren Saiten verdient jedoch die Rolle, wie bei r, den Vorzug.
Es ist hoͤchst wichtig, dem Werfen oder Verziehen des Kastens sowohl als des
Resonanz-Bodens durch die Spannung der Saiten vorzubeugen, was durch folgende
Vorrichtung geschieht. a in Fig. 28 ist ein metallner
Bogen aus einer Reihe solcher Boͤgen, welche als Stuͤze dient, um den
Ruhe-Stift-Balken mit dem Hindertheile oder dem Nahmen des Instrumentes an der
Stelle zu verbinden, wo der Hammer zu den Saiten heraufkommt. Diese Bogen sind an
einem Ende mittelst einer Schraube, b, mit dem Ruhe-Stift-Balken verbunden:
statt daß aber das andere Ende der Bogen auf einer Querleiste ruhte, die, wie
gewoͤhnlich, quer uͤber den Kasten laͤuft, sind sie mittelst
Platten aufgezogen, welche auf eine Art kammfoͤrmigen Gelaͤnders c aufgeschraubt sind, dessen Leisten
Zwischenraͤume zwischen jeder offen lassen, und an dem Hinteren Theile des
Kastens des Instrumentes befestigt sind. Alle diese Leisten c ruhen auf dem Querbalken d, auf welchem
Streber oder Pfloͤkchen e, wie die punctirten
Linien andeuten, zwischen den Leisten c angebracht sind,
die den Resonanz-Boden f tragen. Auf diese Weise stehen
die Stuͤke frei von einander, und weder die Pfloͤkchen noch der
Resonanz-Boden beruͤhren die Leisten c, und
folglich kann die Spannung der Saiten den Resonanz-Boden nicht verziehen.
Fig. 29 ist
eine neue Art von Fassung des gekruͤmmten Theiles des Kastens eines
Forte-Piano's zwischen dem Stege g und dem Kasten h. Es besteht aus zwei Stuͤken Holz i, i, welche zu jeder Seite des Resonanz-Bodens f, und eben so des Kastens h
angeleimt sind, wodurch der Resonanz-Boden sich frei schwingen kann. Diese
Stuͤke Holzes werden in der Hoͤhe des Steges g mittelst Schrauben j zusammengehalten,
welche mit Roͤhren versehen sind, die durch Oeffnungen in dem Resonanz-Boden
laufen.
Fig. 30
stellt noch eine besondere Hemmung dar, welche durch ein Pedal bewegt werden kann,
und eine neue Wirkung in dem Tone und in den Schwingungen des Instrumentes
hervorbringt. Sie wirkt durch eine Reihe von Hebeln, welche in gehoͤriger
Entfernung von einander gestellt sind, auf den Resonanz-Boden zwischen dem Stege g und dem aͤusseren Kasten h. Zwei dieser Hebel, kk, sind
dargestellt, wie sie sich um ihren Mittelpunct l, l
bewegen, und ihre gegenuͤberstehenden Enden gegen den Steg g druͤken, wenn die Pedale mittelst der
Staͤbe m, m, m, oder der daran angebrachten
Zuͤge auf sie wirken. Wenn diese Hebel in Ruhe sind, werden sie in der durch
die punctirten Linien angezeigten Lage mittelst Federn oder Gewichte erhalten,
welche an irgend einem schiklichen Theile des Mechanismus angebracht sind. Wenn sie
in Thaͤtigkeit gesezt werden sollen, dritten ihre Reibungs-Rollen, wie die
Figur zeigt, an den Steg. Von der Wirkung, die hiedurch entsteht, geschieht in der Erklaͤrung des
Patentes keine MeldungWir haben diesen Aufsaz, ehe wir ihn uͤbersezen ließen, einem großen
Kenner der Musik-Kunst vorgelegt. Er fand den hier beschriebenen Mechanismus
„sinnreich und schoͤn, aber etwas
complicirt“, und glaubt, daß, abgesehen von einer Probe mit
„einem solchen Instrumente, welche allein ein richtiges
Urtheil erlaubt, die Idee die Aufmerksamkeit des Publikums
verdient.“ A. d. Ueb..
Tafeln