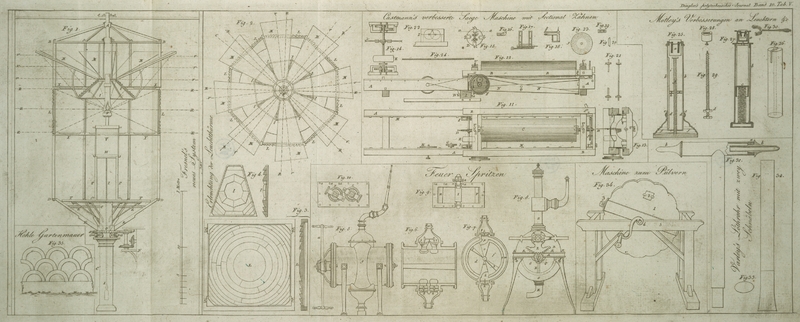| Titel: | Auszug einer Abhandlung über ein neues System zur Erleuchtung der Leuchtthürme; von Herrn A. Fresnel, Ingénieur des Ponts et Chaussées. |
| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. XXII., S. 144 |
| Download: | XML |
XXII.
Auszug einer Abhandlung über ein neues System zur Erleuchtung der Leuchtthürme; von Herrn A. Fresnel, Ingénieur des Ponts et Chaussées.
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement N. 219. S. 274 im Auszuge uͤberseztObschon diese Art von Beleuchtung zunaͤchst fuͤr
Leuchtthuͤrme bestimmt ist, so scheint sie doch auch zu anderen Zweken
anwendbar. A. d. Ueb..
Mit Abbildungen auf Tafel V.
Fresnel's neues System zur Erleuchtung der Leuchtthürme.
Das von Herrn Fresnel angegebene
Apparat besteht aus 8 großen vierekigten linsenfoͤrmigen Glaͤsern von
0,76 Metre Hoͤhe, und 0,92 Metre Brennweite, welche so zusammengestellt
werden, daß sie ein achtseitiges Prisma bilden, dessen Mittelpunct der
gemeinschaftliche Brennpunct dieser Linsen ist. In diesem Puncte wird das einzige
Licht angebracht, das den Leuchtthurm erleuchtet, und das aus einer Lampe mit vier
konzentrischen Dochten besteht, welche 17 Cariel'schen Lampen in Hinsicht des
Lichtes und Oelbedarfes gleich kommt: Die Lampe braucht 1 1/2 Pfund Oel
waͤhrend einer Stunde, wenn sie stark brennt. Ueber die Dochte dieser Lampe
befindet sich N. CCIV, 1821, eine eigene Abhandlung, in welcher erwiesen ist, daß
solche vielfache Dochte immer mit mehr Oel befeuchtet werden muͤssen, als sie
verbrauchen. Dieß uͤberfluͤssige Oel wird hier dem vierfachen Dochte
mittelst eines Wagner'schen Uhrwerkes zugefuͤhrt,
und wieder weiter benuͤzt.
Alle Lichtstrahlen, die aus dem gemeinschaftlichen Brennpuncte ausfahren, und von der
horizontalen Flaͤche sich mehr als 22 1/2 Grad auf- oder abwaͤrts
entfernen, werden von den 8 Linsen gebrochen, und in parallele Richtungen mit ihren
Achsen gebracht: denn man weiß, daß die Linsen, wie die parabolischen Spiegel, die
Eigenschaft besizen, die aus dem Brennpuncte ausfahrenden Lichtstrahlen in parallele
Lage zu bringen, und daß sie durch Refraction dasselbe bewirken, was die Spiegel
durch Reflexion. Wenn hier der leuchtende Punct im Brennpuncte der 8 Linsen ein
Punct, und die Convexitaͤt und Brechungskraft der Lichtstrahlen optisch genau
seyn koͤnnten, so wuͤrden die Lichtstrahlen alle parallel seyn; da
dieß aber nicht ist, so entsteht, statt eines cylindrischen Lichtbuͤndels,
ein Lichtkegel von 6 1/2 bis 7° bei einem vierfachen Dochte von 0,09 Metre im
Durchmesser; und diese 8 Lichtkegel lassen einen Raum von 38 bis 38 1/2°
zwischen sich. Wenn nun dieser Linsen-Apparat sich um den leuchtenden Punct dreht,
so werden die Lichtkegel so wie die unbeleuchteten Zwischenraͤume auf alle
Puncte des Horizontes umher geworfen, und zeigen folglich dem Auge des Beobachters
in der Ferne eine Reihe von Beleuchtungen und Verfinsterungen, wovon die lezteren
aber kaum den sechsten Theil der Zeit der ersteren dauern.
Man koͤnnte leztere noch sehr verkuͤrzen, wenn man die Lampe
groͤßer machen wollte, was aber mehr Oel kosten wuͤrde, oder wenn man
die Linsen ihrem Brennpuncte naͤher ruͤkte, oder davon entfernte,
wodurch aber im lezteren Falle die Staͤrke des Lichtes mehr vermindert werden
wuͤrde, als man an der Dauer desselben gewinnt. Und wenn man diese
verdoppelte, so wuͤrde die Intensitaͤt um ein Viertel vermindert. Um
die Dauer des Glanzes ohne alle Vergroͤsserung des leuchtenden
Koͤrpers zu verlaͤngern, faͤngt Herr Fresnel die uͤber die großen Linsen wegfahrenden, und folglich
verloren gehenden, Lichtstrahlen mit 8 kleinen Zusaz-Linsen von 0,50 Metre auf,
welche (Figur
4) uͤber der Lampe eine Art von Dach in Form einer achtseitigen
abgestuzten Pyramide bilden. Die Lichtstrahlen, welche sie brechen und in acht
Lichtkegel concentriren, werden durch die Reflexion der uͤber diesen Linsen
angebrachten Spiegel in horizontale Richtung gebracht. Die Horizontal-Projection der
Achse einer jeden dieser
kleineren Linsen bildet mit der Achse der correspondirenden Linse einen Winkel von
7°, und geht dieser bei der Umdrehung des Apparates voraus, so daß, selbst in
einer Entfernung von 16,000 Toisen, die Dauer der Lichterscheinung der
Haͤlfte der Dauer der Verdunkelung gleich war. Was die Intensitaͤt des
Lichtes, welches die großen Linsen geben, betrifft, so sahen die Herren Arago und
Mathieu bei ihren Messungen an den Kuͤsten von Frankreich und England dieses
Licht selbst am Tage in einer Entfernung von 50 englischen oder 17
franzoͤsischen Meilen mittelst eines Fernrohres, und bei der Nacht
glaͤnzte es eben so hell, wie die fest stehende Leuchte an einem englischen
Leuchtthurme in einer Entfernung von 15 englischen oder 5 franzoͤsischen
Meilen. Man koͤnnte auch die unter der Linse hinfallenden Lichtstrahlen
benuͤzen; allein die Vorrichtung, die hiezu noͤthig waͤre,
wuͤrde vielleicht der Leuchte hinderlich seyn, und Herr Fresnel laͤßt sie in's Meer fallen, da sie beim Landen doch
nuͤzen koͤnnen.
Die Lampe F,
Fig. 1, ruht
auf einer fest stehenden Tafel, TT, welche von
einer gegossenen Saͤule C getragen wird, die auf
dem Gesimse ihres Knaufes die ganze Last des Linsen-Apparates traͤgt. Auf
diesem Gesimse laufen die Scheibchen GG welche die
Umdrehung erleichtern, die hier, wie bei allen Leuchten mit sich drehendem Feuer,
mittelst eines Gewichtes und einer Uhr bewirkt wird. Die Pumpen der Lampe werden
durch ein viel geringeres Gewicht bewegt, welches innwendig in der gegossenen
Saͤule hinabsteigt. Eine der vorigen aͤhnliche, aber mit einer Feder
versehene, Sicherheits-Lampe auf dem Tische kann auf der Stelle angezuͤndet
und der Lampe mit dem Gewichte substituirt werden, wenn die Pumpen der lezteren
durch irgend einen Zufall in Unordnung geriethen.
Da das Licht unbeweglich in der Mitte steht, so lassen sich an demselben alle
moͤglichen Ersparungs-Vorrichtungen, und durch die hohle Saͤule,
leicht eine Gasbeleuchtung anbringen.
Es war hoͤchst noͤthig, die Dike der Glas-Linsen zu vermindern, damit
ihr Gewicht der Drehungs-Maschine, die das ganze System umtreibt, nicht zu sehr zur
Last faͤllt. Daher werden die Linsen hier stufenweise (en échelons) aufgestellt, d.h. die concentrischen Ringe, aus
welchen sie bestehen, bilden Vorspruͤnge oder Stufen statt einer
staͤtigen sphaͤrischen Woͤlbung, und die Kruͤmmung, so
wie die Neigung der aͤusseren Oberflaͤche dieser Ringe gegen die
innere an der Seite des Brennpunctes, welche flach ist, ist so berechnet, daß die
aus dem Brennpuncte ausfahrenden Lichtstrahlen parallel mit der Achse der Linse
werden. Buffon hatte, der erste, die Idee, solche
treppenfoͤrmige Linsen verfertigen lassen; er wuͤnschte sie aber aus
einem Stuͤke, was beinahe unmoͤglich ist, waͤhrend die Ringe
des Herrn Fresnel sich leicht einzeln verfertigen, und
dann an den Raͤdern an einander sezen lassen. Ja selbst diese Ringe bestehen
aus 2, 3 bis 4 großen Kreisstuͤken, je nachdem sie naͤmlich groß sind,
indem man solche krumme Prismen, wenn sie uͤber 18 Zoll lang sind, nicht
leicht gießen kann.
Die Wirkung dieses Leuchte ist dreimal staͤrker, als jene einer Leuchte von 8
Reflectoren mit 30 Zoll Oeffnung, ohne daß man mehr Oel noͤthig
haͤtte, und das Gewicht betraͤgt nur ein Achtel mehr: sie ist
uͤberdies nur um 2/3 theurer, und man erspart waͤhrend der Zeit des
Gebrauches unendlich durch die Dauerhaftigkeit der Politur des Glases, durch die
Leichtigkeit der Reinigung und Unterhaltung, waͤhrend die Reflektoren so
schwer rein zu halten sind, und so oft mit englisch Roth uͤbergangen, ja
sogar neu uͤbersilbert werden muͤssen.
Der Nuzen, den Physik und Chemie durch solche ungeheure Brennspiegel erhalten
muͤssen, laͤßt sich nicht berechnen.
Erklaͤrung der Figuren.
Fig. 1.
Senkrechter Durchschnitt des Linsen-Apparates nach der Richtung seiner Achse. Man
hat nur die Fassung, die Linsen und die Spiegel durchschnitten: Lampe und
Saͤule sind im Aufrisse.
Fig. 2.
Horizontal-Projection, unmittelbar unter den Spiegeln. Man hat hier die Querstangen
weggelassen, welche die Fassungen der großen Linsen tragen und deken, um sie desto
deutlicher darzustellen, und die Zeichnung nicht zu uͤberladen.
Fig. 3. Aufriß
und Durchschnitt einer der großen linsenfoͤrmigen Ringe in ihrem Rahmen, nach
doppeltem Maßstabe von Fig. 1.
Fig. 4.
Durchschnitt und Ansicht von der Vorderseite einer kleinen Zusaz-Linse.
A, Achse der Fassung von Eisen: ihr oberes Ende dreht
sich zwischen zwei horizontalen Scheibchen gg.
BB, DD, Fassung von Eisen, welche die großen und
kleinen Linsen mit ihren Spiegeln traͤgt.
CC, hohl gegossene Saͤule, auf welcher der
ganze Apparat ruht. Das untere Ende dieser Saͤule laͤuft durch das
Gewoͤlbe der Deke der Laterne, und ist daselbst eingekittet.
EE, Entladungs-Schenkel der Fassung.
F, gemeinschaftlicher Brennpunct der großen und kleinen
Linsen, der mit dem Mittelpuncte des vierfachen Schnabels correspondirt, dessen
obere Raͤnder 3 Centimeter unter diesem Puncte stehen muͤssen.
GG, Vertikale Scheibchen, auf welchen der Apparat
sich dreht. Diese Scheibchen laufen auf einer gegossenen Platte, welche von einem
Vorsprunge des Knaufes der hohlen Saͤule CC
getragen wird.
H, Theil des Apparates, welcher die Vorrichtungen
enthaͤlt, die die zur Aufziehung des Oeles bestimmten Pumpen in Bewegung
sezen.
II, Schnur, die in das Innere der hohlen
Saͤule durch ein Loch hinabsteigt, das in der Mitte des Tisches angebracht
ist, und an welcher das bewegende Gewicht haͤngt.
LL, große stufenfoͤrmige Linsen, die aus
concentrischen Kreisen mehrerer Stuͤke Glas, die auf einander
aufgeloͤthet sind, bestehen; die mittlere Linse allein besteht aus einem
einzigen Stuͤke.
Fig. 3.
MMM, belegte Spiegel, welche die durch die kleinen
Linsen gebrochenen Lichtstrahlen in horizontale Richtung sammeln.
N, Drehungs-Baken, welcher den Apparat in Bewegung sezt.
Man hat diese Maschine nicht ganz gezeichnet, sondern bloß gezeigt, wie sie die
Bewegung mittheilt.
O, Aermel, auf welchem sich die Entladungs-Schenkel
stuͤzen.
PP, Fuß von Eisen, der die Lampe
stuͤzt.
RR, Lichtstrahlen von den großen Linsen.
TT, Tisch, auf welchem die Lampe ruht.
V, Oelbehaͤlter.
XX, Querstangen, welche die Rahmen der großen
Linsen deken.
YY, andere Querstangen zu demselben Zweke.
ZZ, Bindebalken, welche die Entladungs-Schenkel
der Fassung binden, und das Nachgeben derselben hindern.
a, Zahnrad, an welchem der Aermel O befestigt ist, und welches sich auf die Scheibchen gg stuͤzt.
b, ein anderes Zahnrad, das in das vorige eingreift, und
auf einer Achse aufgezogen ist, welches einen Theil des Mechanismus N bildet.
gg, horizontale Scheibchen, zwischen welchen das
obere Ende der Achse der Fassung sich dreht.
U, kleine Zusaz-Linsen, die eine Art von achtseitiger
abgestuzter Pyramide, als Dach, uͤber dem Schnabel der Lampe bilden, deren
Schornstein uͤber die obere Oeffnung der Pyramide emporragt.
rr, Strahlen der kleinen Linsen, die in
horizontale Richtung von den Spiegeln MM gebracht
werden.
Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde.
Tafeln