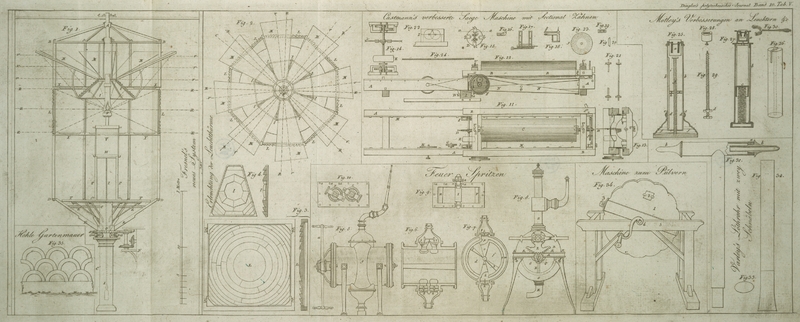| Titel: | Vergleichung zweier ähnlichen Feuersprizen. Von Aug. Voit, der Baukunst Beflißener. |
| Autor: | Richard Jakob August Voit [GND] |
| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. XXVIII., S. 167 |
| Download: | XML |
XXVIII.
Vergleichung zweier ähnlichen Feuersprizen. Von Aug. Voit, der Baukunst Beflißener.
Mit Abbildungen auf Tab. V.
Voit's Vergleichung zweier ähnlichen Feuersprizen.
Kurz kam mir ein Werk unter die Hand, das den Titel
„Tromba Napoleone o sia nuova macchina
idraulica destinato al vario sollevamento dell' aqua Milano, 1808. 8.
Von Carlo Castelli Canonico ordinario“
– fuͤhrt, und die Abbildung einer besondern Art von Feuersprize
enthaͤlt. Sie war nicht neu; denn ich sah schon eine aͤhnliche bei Mechanikus
Hoͤschel in Augsburg in Modell, welche dessen Vater arbeitete und erfand. Die
Vergleichung dieser beiden Maschinen scheint mir vorzuͤglich deßwegen nicht
uninterressant zu seyn, weil ich leztere, die noch nie oͤffentlich bekannt
wurde, fuͤr besser halte. Zudem ist sie von einem beruͤhmten deutschen
Kuͤnstler verfertigt, und um so mehr einer Wuͤrdigung werth. Jeder
urtheile und pruͤfe selbst aus den Zeichnungen, denen ich nur eine kurze
Erklaͤrung beifuͤge. –
Erstere unter dem Namen tromba napoleone bekannt, ist im
Aufriß Fig. 5
Tab. V, Laͤngen- und Querdurchschnitt, Fig. 6, und 7 dargestellt.
– Durch einen hohlen Cylinder geht eine Walze, an der sich, nach
entgegengesezten Richtungen, zwei Fluͤgel b und
l, Fig. 7, befinden, die mit
der Wand t hermetisch schließen, und sammt der Walze
vermittelst des Hebels a, Fig. 5, in Bewegung gesezt
werden. Bei jedem Auf- und Niedergange des Hebels lehnen sich diese Fluͤgel
an die kegelfoͤrmigen Waͤnde c und n, welche den Cylinder in zwei Theile d und f theilen, an.
– Um den Cylinder geht ein Wulst g,
Fig. 5,
welcher hohl ist, und den Kanal m,
Fig. 7,
bildet, der durch die Oeffnungen h und p in Verbindung mit den Raͤumen d und f steht. Zieht man den
Hebel auf der einen Seite herab, und der Fluͤgel b lehnt sich an die Wand c, der Fluͤgel
l an die Wand n an, so
werden die Raͤume d und f luftleer, und das Wasser dringt durch die Ventile kk, Fig. 6, in dieselben; in
den Raum d durch die Oeffnung h,
Fig. 7, und in
den Raum f durch den Kanal m, der mit demselben durch die Oeffnung p in
Verbindung steht. Erhaͤlt nun der Hebel eine entgegengesezte Bewegung, so
druͤken beide Fluͤgel zu gleicher Zeit das Wasser in den
Raͤumen d und f durch
die Ventile qq, Fig. 6, in die
Lenkungsroͤhre x. – Da also beide
Fluͤgel Gleiches zur selben Zeit verrichten, so ist es klar, daß der
Wasserstrahl nicht stetig ist, sondern stoßweise erfolgt. Diesen Fehler hat die
zweite Maschine nicht, und daher verdient sie unstreitig den Vorzug. Die
Beschreibung diene als Beweis.
Es ist ein kurzer hohler Cylinder, den ein Zwischenstuͤk A in eine obere und untere Haͤlfte B und C theilt. In diesem
Zwischenstuͤke, welches durch Schrauben aaa
an den untern und obern Theil befestigt ist, liegen die Ventile P und Q, welche in Fig. 10 im
Grundriß zu sehen sind. – Die untere Haͤlfte des Cylinders ist im Innern durch
die Wand D abgetheilt, so daß der Kanal S entsteht, welcher mit der Saugroͤhre E in Verbindung steht. Diesen Kanal bedekt auf jeder
Seite eine Klappe F, R, Fig. 8 und 9. – In dem innern
Raum G der untern Haͤlfte des Cylinders geht ein
Fluͤgel H hin und wieder, welcher vermoͤge
einer Walze J, eines Stirn- und Steigrades K und L,
Fig. 8 und
9, und des
Hebels m in Bewegung gesezt wird. Steigt nun der
Fluͤgel H nach der Klappe T so wird der Raum G luftleer, und das Wasser
dringt durch die Klappe R in denselben, faͤllt
aber der Fluͤgel H, und steigt dann gegen die
Klappe R, so druͤkt er das in dem Raum G befindliche Wasser durch das Ventil P,
Fig. 10, in
den obern Theil des Cylinders B. Zu gleicher Zeit aber
dringt das Wasser durch die Klappe F in den Raum C und wird, bei dem Ruͤkgange des Fluͤgels
durch das Ventil Q ebenfalls in den oberen Theil des
Cylinders gedruͤkt. – Daraus geht hervor, daß in die Maschine zu
gleicher Zeit Wasser eingeht und ausgeht; und daß demnach der Wasserstrahl stetig
ist. Seine Stetigkeit wird noch dadurch befoͤrdert, daß der obere Theil des
Cylinders als Luftkessel dient, indem die Steigroͤhre Z beinahe bis zu den Ventilen herab geht. –
Wer verkennt nun den Vorzug dieser Maschine vor der erstem. – Die Aehnlichkeit
beider liegt in den Fluͤgeln, welche das Pumpwerk entbehrlich machen, und
eine sehr einfache Construction gestatten.
Das Modell der lezten Feuersprize, welche achtmal so groß ist als die Zeichnung,
treibt den Strahl ungefaͤhr 24 Fuß hoch.
Tafeln