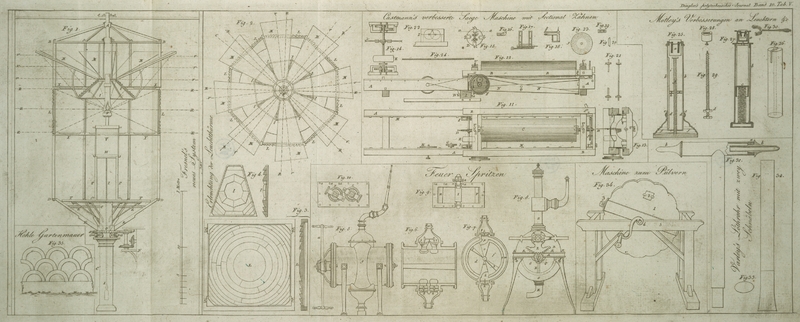| Titel: | Miszellen. |
| Fundstelle: | Band 10, Jahrgang 1823, Nr. LXVI., S. 369 |
| Download: | XML |
LXVI.
Miszellen.
Miszellen.
Verzeichniß der vom 11ten bis 18ten Februar zu London ertheilten Patente.
Dem Wilh. Glossage,
Chemiker und Spezereihaͤndler zu Leamington-Priors, Warwickshire, auf
einen tragbaren Weker, den man an allen Stok- und Sakuhren anbringen und wieder
abnehmen, und auf jede beliebige Stunde stellen kann. Dd. 11. Februar 1823.
Dem Nathaniel
Partridge, Faͤrber zu Bowbridge bei
Stroud, Gloucestershire; auf Verbesserungen beim
Einsezen der Dampf- oder anderer Kessel, wodurch bedeutende Ersparung an
Brennmaterial bewirkt und der Rauch kraͤftiger verzehrt wird. Dd. 14. Februar
1823.
Dem Thom. Fuller,
Kutschenbauer zu Bath, Sommersetshire; auf gewisse
Verbesserungen bei Verfertigung der Schaͤfte und Befestigung derselben an
zweiraͤdrigen Fuhrwerken. Dd. 18. Februar 1822.
Dem Philipp Chell,
Mechaniker zu Carles-court, Kinsington, Middlesex; auf gewisse Verbesserungen an
den Maschinen zur Zubereitung und zum Spinnen des Hanfes, Flachses und der
Filet-Seide. Dd. 18. Februar 1823.
Dem Aug. Applegath,
Druker in Duke-street, Stamford-street, Blakfriars, Surrey; auf gewisse
Verbesserungen an Drukmaschinen. Dd. 18. Februar 1822.
Dem Thom. Bury,
Faͤrber zu Salford, Manchester, Lancashire; auf
Verbesserungen im Faͤrben der Nankinfarbe auf Baumwolle, Wolle, Seide und
gewisse andere Artikel. Dd. 18. Februar 1823.
Dem Franz Deakin,
Schwertfeger zu Birmingham, Warwickshire; auf Verbesserungen an
Forte-Pianos und anderen Saiten-Instrumenten. Dd.
18. Februar 1822.
Dem Wilh. Church,
Gentleman in Nelson-square, Surrey; auf einen verbesserten Drukapparat
fuͤr Buch-Zeug-Kupferdruker. Dd. 18. Februar 1823.
(Aus dem Repertory of Arts, Manufactures etc.
Maͤrz 1823. Nro. 250. S. 253.)
Notiz uͤber eine Explosion eines Dampfkessels an der Branntweinbrennerei zu Lochrin. Von Herrn Stevenson, Mitglied der koͤnigl. Gesellschaft zu Edinburgh.
In den Annales de Chimie, December 1822. S. 362, ist ein
Bericht aus dem Edinb. philos. Journal uͤber die
Explosion des Dampfkessels an der Brantweinbrenneres zu Lochrin, welche, woͤchentlich, die auf dem festen Lande
unerhoͤrte Summe von 15,000 Pfund Sterling, sage 155,000 fl. Tranksteuer
bezahlt. Man wollte in dieser Brennerei die Fluͤßigkeit in ungeheuren Blasen
mittelst Dampfes von hohem Druke zum Sieden bringen, weil man dieß wohlfeiler, als
die gewoͤhnliche Methode, fand. Man hatte nichts gespart, dem Kessel die
noͤthige Staͤrke zu geben, und die Arbeit sing am 21ten Maͤrz
an. Nachdem das Werk ungefaͤhr 12 Tage lang im Gange war, bemerkte man, daß
an dem Queksilber-Luftverdichtungsmesser etwas in Unordnung gerathen ist. Man ging
sogleich zu dem Mechaniker, allein, ehe dieser kommen konnte, hatte die Explosion
Statt. Der Kessel war nicht weniger als 37 Fuß lang, am Boden 3 Fuß, unmittelbar
unter dem Dekel 2 Fuß, weit, und ungefaͤhr 4 Fuß hoch. Der Boden war
halbmondfoͤrmig convex, um die Beruͤhrungspuncte der Flamme und des
Kessels zu vermehren. Das Gewicht des Kessels betrug ungefaͤhr 120 Tonnen:
der obere Theil und die Seiten mochten 7 Tonnen betragen, und diese Masse wurde von
dem Boden losgerissen, und mit solcher Gewalt in die Hoͤhe
geschlaͤudert, daß sie nicht bloß das Gewoͤlbe des Brennhauses aus
Ziegelsteinen, und das Dach durchschlug, sondern noch ungefaͤhr 70 Fuß hoch
in die Luft fuhr. An der Seite war das Brennhaus gegen Suͤden von einer Masse
anderer Gebaͤude umgeben, gen Norden aber frei; dieser Umstand trieb nun die
ausgeworfene Masse auf diese Seite hin, wo sie in einer Entfernung von 150 Fuß auf
eines der Gebaͤude der Brennerei niederfiel, dieses von unten bis oben
durchschlug, und darin einen ungeheueren Gaͤhrungs-Bottich aus Gußeisen
zertruͤmmerte. Der Kessel war mit 8 Zoll breiten, und 3/8 Zoll diken Reifen
aus geschlagenem Eisen umgeben, und stand auf 36 Gußeisen-Stangen, die 6 Zoll tief,
und 2 1/2 Zoll dik waren, und eben so viele Baͤnder oder Kreise um den
halbkreisfoͤrmigen Boden bildeten. Es verdient bemerkt zu werden, daß der
Boden des Kessels 14–15 Fuß gehoben wurde, und mitten unter den
Truͤmmern außer dem Brennhause lag, und in entgegengesezter Richtung seiner
Woͤlbung nach Außen gebogen ward, also jezt dort concav war, wo er ehevor
convex gewesen ist. Gluͤklicher Weise waren nur zwei Arbeiter als Opfer
gefallen: von einem fand man den Kopf entzwei gerissen; von dem anderen lagen die
Fuͤße im Brennhause, waͤhrend man seinen Leib aussen unter dem Schutte
begraben fand. Im Augenblike der Explosion stieg eine ungeheure Menge Dampf auf,
wovon ein Theil sich an den Mauern der benachbarten Gebaͤude verdichtete, die
davon wie geweißt erschienen. In der Ferne hoͤrte man wie einen Donnerschlag,
im Innern des Gebaͤudes war die Explosion nicht besonders knallend. Eine
englische Meile von dieser Brennerei weg verspuͤrte man deutlich
waͤhrend der Explosion einen Erdstoß.
Die Waͤnde und der Dekel des Kessels waren in horizontaler Richtung
laͤngs den Nietloͤchern so regelmaͤßig weggerissen, als
haͤtte man sie mit der Schere weggeschnitten, und es ist wahrscheinlich, daß
man zu viele Nietnaͤgel eingelassen hat. Die Reifen, die nur 8 Zoll breit
waren, dekten sich wechselsweise 4 Zoll weit, und waren so uͤbernietet, daß
nur vier Zoll breite Ringe davon allein loͤcherfrei blieben, an den
uͤbrigen Theilen waren die Nietloͤcher nur fuͤnfviertel Zoll
von einander entfernt, so daß also eben so, viel durchloͤchert, als ganz war. Waͤre dieß
nicht geschehen, und waͤren die Querbaͤnder unten am Boden
gehoͤrig mit den Hoͤrnern des Halbmondes, den seiner Woͤlbung
bildete, verbunden und vernietet worden, so wuͤrde wahrscheinlich der Kessel
einer groͤßern Kraft, als derjenigen fuͤr welche er berechnet war,
widerstanden seyn. Die Reifen haͤtten so aufgelegt werden sollen, daß die
Raͤnder des einen auf die Mitte der beiden zunaͤchst stehenden
gefallen waͤren. Auch die Bildung der Nietloͤcher verdient alle
Aufmerksamkeit; der Bohrer, der sie bohrt, muß vollkommen walzenfoͤrmig, oder
kaum merklich konisch seyn, damit die Eisenfaser so wenig als moͤglich in
Unordnung gebracht wird; denn wo dieß der Fall ist, wird das Eisen weniger
zaͤhe, und, wie die Englaͤnder sagen, kalt-kurz (colds hort). Ueberdieß muͤssen die Locher immer
in Zigzag, und nie in einer Linie fortlaufen.
Man glaubte, in Hinsicht auf die Veranlassungs-Ursache, daß der obere Rand des
halbzirkelfoͤrmigen Bodens ungeschikt bis zur Gluͤhhize gebracht
wurde, und dann ein Wasserfaden aus dem Behaͤlter zufaͤlliger Weise
auf denselben stroͤmte, wodurch zu ploͤzliche Entwiklung des Dampfes
entstand. Bei den ersten Versuchen schon bemerkte man, daß der Boden ungeachtet
seiner Schwere von 9 Tonnen, bei der Entwikelung des Dampfes so zitterte, als wenn
60 ℔ auf ein □ Zoll druͤkten. Dieser Druk wurde auf 40 ℔
reducirt, und die Sicherheitsklappe unter Schluͤssel gethan, und dem
Inspector anvertraut: indessen, man hat durch irgend eine Nachlaͤßigkeit
einen hoͤheren Druk entstehen lassen, der, der Wirkung nach zu urtheilen,
weit uͤber 215 ℔ auf den □ Zoll betragen haben muß. An den Watt- und Bolton'schen
Dampfmaschinen ist der Druk zwischen 2–5 ℔ auf 1 □ Zoll; an
jenen der Hrn. Frevethick und Woolf mit hohem Druke betraͤgt er 80 ℔ und daruͤber:
es ist also dabei mehr Vorsicht noͤthig. Wuͤnschenswerth waͤre
eine Sicherheitsklappe, die so frei als moͤglich spielte, und so wenig als
moͤglich von den Arbeitern abhinge. Hr. Adie
schlaͤgt dazu an irgend einer Stelle des Dekels eine Scheibe aus
gehaͤmmertem Kupfer von bekannter aber geringerer Zaͤhigkeit als jener
des Dekels vor, welche Scheibe alsogleich der Expansivkraft des Dampfes
nachgaͤbe, sobald diese uͤber die Haͤlfte der berechneten
Staͤrke der Maschine steigt. Zur groͤßeren Sicherheit der Arbeiter
koͤnnte man diese Scheibe mit einer hoͤlzernen oder metallenen
Roͤhre umfangen, die 12–14 Fuß uͤber den Kessel
emporsteigt.
Bei einer zweiten Untersuchung fand man, daß an dem von dem Ofenthuͤrchen am
weitesten entfernten Theile das Eisen braͤunlich war, so wie das
gluͤhende Eisen allzeit wird, wenn man es schnell abkuͤhlt, und dann
fand man, nicht weit vom Eingange zum Herde, einen Theil eines Bleipfropfens, mit
welchem man ein Nietloch verrannte, ungeschmolzen, was also nicht vermuthen
laͤßt, daß der Boden wie man glaubte, uͤberhizt war: indessen kann an
einem so langen Kessel die Hize auch ungleichmaͤßig vertheilt gewesen seyn.
Was diese Vermuthung, und die Wahrscheinlichkeit, daß der Boden dennoch
uͤberhizt war, bestaͤtigt, ist der Umstand, daß man den Koͤrper
des einen der beiden Todtenopfer dicht neben dem Hahne fand, durch welchen frisches
Wasser zugelassen wurde. Eine Sicherheitsklappe wurde, in entgegengesezter Richtung
von dem oberen Theile des Kessels, sehr weit weggeschleudert, und durchschlug, wie
eine Bombe, das Dach eines ziemlich weit entfernt stehen, den Hauses, und
haͤtte bald einen Einwohner desselben getoͤdet. Wir wollen diese
Notiz, so wie Hr. P. S. Girard, mit der kleinen
Abhandlung
uͤber den Widerstand des Gußeisens, in Anwendung auf Roͤhren und Dampfkessel
in denselben Annales d. Chim. S.
351. verbinden, und nur einige Thatsachen aus dieser, der Pruͤfung der
Physiker und Techniker werthen, Abhandlung des Hrn. Girard ausheben. Hr. Girard fand das Maximum
Staͤrke der Waͤnde eines hohlen Cylinders, wenn der aͤußere
Durchmesser sich zu dem innern wie 11:5 verhaͤlt. Er nimmt mit Hrn. Samuel
Brown und Georg Rennie, in
den Philosoph. Transact. 1818 an, daß ein Prisma, dessen Grundflaͤche 1/4
□ Zoll ist, bei 1200 avoir du poids Gewicht
bricht. Will man also, sagt er, die Dike einer horizontalen Roͤhre aus
Gußeisen, die ein Metre
im Durchmesser hat, und die eine Wassersaͤule von der Schwere der
Atmosphaͤre auf derselben Basis zu tragen hat, bestimmen, so wird sie
ungefaͤhr 41/100 oder, in runder Zahl, ein halbes Millimetre seyn. Ein
walzenfoͤrmiger Kessel aus Gußeisen von einem Metre im Durchmesser und 15
Linien Dike, wird also einem Druke von 67 Atmosphaͤren zu widerstehen
vermoͤgen, d.h. einem 10–11 mal groͤßerem Druke, als der Dampf
in einer Maschine, die einen Druk von 6–7 Atmosphaͤren erzeugt. Sezt
man die Laͤnge des Kessels gleich zwei Metres, und die beiden Boden eben so
dik, = 34 Millimetres so wird jeder derselben einem Druke von 450
Atmosphaͤren zu widerstehen vermoͤgen. – Dieß scheint uns
indessen nicht ganz praktisch richtig, und noch weniger die Idee, daß die
Boͤden unter diesem Verhaͤltnisse unendlich stark sind, wie Hr. Girard gefunden haben will.
Ueber einige Eigenschaften des Queksilbers und des Glases, und uͤber die Schwierigkeiten, die man bisher bei Bestimmung der
Ausdehnung derselben fand,
hat Herr Angelo Bellani in dem Giornale di Fisica, Chimica, Storia Naturale, Medicina et Arti. T. VI. Decad. II. I. Bimestre
(Februar 1823) S. 20 eine fuͤr den Physiker, und wohl auch fuͤr den
feineren Techniker sehr interessante Abhandlung geliefert, die als Fortsezung der
von uns bereits fruͤher wiederholt angezeigten Abhandlung eben desselben
Herrn Verfassers uͤber die Schwierigkeiten der Bestimmung des Frierpunctes
angesehen werden kann. Nicht bloß Thermometer- und Barometer-Macher, sondern auch
Glasfabrikanten und Glasschleifer werden diese Abhandlung, die wahrscheinlich Herr
Professor Gilbert dem deutschen Publikum bald mittheilen
wird, mit Vergnuͤgen und gewiß auch mit Nuzen studieren, so wie auch die
Abhandlung des Herrn Ambros Fusinieri.
uͤber die Abstoßungskraft, welche sich an Theilchen von
Koͤrpern entwikelt, die auf den kleinsten Umfang gebracht wurden, oder
uͤber den Warmestoff der selbststaͤndigen Ausdehnung in sehr feine
Blaͤttchen. Ebendas. S. 34.
Ueber Wetter-Ableiter, und ihren wohlthaͤtigen Einfluß auf den Akerbau
las Herr Le Normand im November
1822 eine Abhandlung in der Sizung der koͤnigl. Akademie der Wissenschaften
zu Paris, welche im Mercure technologique, Januar 1823.
S. 72 abgedrukt ist. Die schnell abwechselnden Minister des Innern in Frankreich
erhalten nach der Reihe Auftrage, die Kirchen und Kirchenthuͤrme dieses
Landes mit Wetter-Ableitern zu versehen, und entladen sich dieser ihrer
Auftraͤge bei allen Akademien und physikalischen Gesellschaften Frankreichs.
Herr Le Normand nimmt in seiner Abhandlung nicht bloß auf
die Kirchthuͤrme, sondern auch auf die Huͤtten des armen Landmannes
Ruͤksicht, und findet die Ursache, warum die Wetter-Ableiter in Frankreich so
wenig und so selten benuͤzt werden, (was in der That jedem Fremden
auffaͤllt, der aus irgend einem protestantischen Lande zu dieses
allerchristlichste Land kommt) vorzuͤglich in der fehlerhaften Methode der
Anlage der franzoͤsischen Wetter-Ableiter. In Frankreich kommt ein
Wetter-Ableiter auf irgend einem etwas groͤßeren Gebaͤude auf
beilaͤufig 300 Franken, waͤhrend er in England, wo doch alles dreimal
theurer ist als in Frankreich, kaum auf 50 Franken zu stehen kommt (vergl. S. 79).
Es scheint, das sicherste Mittel zur hoͤchst noͤthigen Verbreitung der
Wetter-Ableiter waͤre dieses, wenn die Feuer-Assecuranz-Anstalten kein Haus
garantirten, das nicht mit einem Wetter-Ableiter versehen ist.
Herr Le Normand erwartet von den Wetter-Ableitern eben so
großen Nuzen fuͤr die Felder durch Ableitung des Hagels, als sie fuͤr
die Gebaͤude durch Ableitung des Blizes gewaͤhren, und glaubt der
Erste gewesen zu seyn, der im Jahre 1802 (im Annuaire
statistique du Dptt. du Tarn pour l'an XI). Die Wetter-Ableiter als
Hagel-Ableiter empfahl (paratonnerres comme paxagreles).
Wenn es uns leid thut, dem Herrn Le Normand diese Ehre
anstreiten zu muͤssen, so freut es uns, dem Namen eines Mannes Gerechtigkeit
wiederfahren laͤssen zu koͤnnen, der 50 Jahre lang die Gerechtigkeit
mit seltener Gewissenhaftigkeit an den hoͤheren und hoͤchsten
Tribunalen in Oesterreich verwaltete. Der sel. Hofrath der k. k. obersten
Justiz-Stelle, Jos. von Froidvaux, schlug im Jahr 1801 in
einer kleinen SchriftEinladung zu einem Versuche die Elektricitaͤt
von den Wolken abzuleiten. 8. Wien 1801. 20 S. im Ghelen'schen Zeitungs-Comptoir. Der sel. Hofrath
von Froidvaux, der aus dem ehemaligen Porentru zu
van Swieten's (des Arztes) Zeiten nach Wien kam, war, man darf es wohl laut
sagen, der Erste, der, in Oestreich, in den wenigen Nebenstunden, die ihm
seine gehaͤuften Geschaͤfte uͤbrig ließen, den Weinbau
aus Grundsaͤze zuruͤkfuͤhrte, und den Seidenbau mit
Erfolg trieb. In seinem Garten in der Rossau zogen seine Toͤchter
jaͤhrlich zu ihrer Unterhaltung,
fuͤr beilaͤufig 600 fl. Seide, und sein Wein, der fast aller
nach Polen ging, war der beßte in ganz Oestreich. Sein Sohn, Jos. von Froidvaux, Med. Dr.,
der den hellen und rechtlichen Geist seines wuͤrdigen Vaters erbte,
wuͤrde vielleicht einer der ersten Agronomen Deutschlands geworden
seyn, wenn nicht ein fruͤhzeitiger Tod ihn in der Bluͤthe
seiner Jahre dem Dienste der Menschheit entrissen haͤtte. vor, den Hagel durch Wetter-Ableiter von Weinbergen und Feldern abzuleiten.
Man achtete nicht bloß dieses Vorschlages nicht, sondern man lachte uͤber die
Ideen dieses ehrwuͤrdigen Greises, den man freilich damals in Oestreich nicht
verstehen konnte, weil er seinem Zeitalter um 50 Jahre voraus war. Wir wissen nicht,
ob man spaͤter Froidvaux's Vorschlaͤge in
Oestreich beachtete, und begnuͤgen uns, aus Herrn Le
Normand's Abhandlung bloß zwei Thatsachen anzufuͤhren, daß
naͤmlich, nach den Beobachtungen des Herrn de
Rochegude zu Alby, Dptt. du Tarn, die Hagelwetter an diesem Orte seit der
Zeit, als man Wetter-Ableiter daselbst errichtete, sehr selten geworden sind; und
daß, nach den an der Schule zu Sorèze angestellten Beobachtungen, (an einem
Orte, wo ehevor der Hagel jaͤhrliche Plage war), seit Errichtung der
Wetter-Ableiter daselbst, der Hagel sich zu dem fruͤheren Hagelschaden wie 1
zu 5 verhielt.
Herr Tollard, Professor der Physik zu Tarbes (Hautes-Pyrénées) schlaͤgt zu
solchen Wetter- oder Hagel-Ableitern eine hoͤlzerne Stange von 30 Fuß
Hoͤhe mit einer Metallspize von Messing vor, die, bis zu dieser hinauf, mit
Weizenstroh umflochten ist, in dessen Mitte eine duͤnne Flaschsschnur (Hanf
entladet nach ihm nicht, wie der Flachs, die Leydener Flasche ohne
Erschuͤtterung, und taugt hiezu nicht) hinlaͤuft, die aus 10–12
Faden Garn besteht. Diese Hagel-Ableiter stellt er ungefaͤhr 850 Fuß (200
Metres) weit von einander entfernt.
Es fragt sich aber am Ende doch noch immer, ob es rathsam ist, der Atmosphaͤre
ihre Elektricitaͤt so habsuͤchtig zu entziehen, und ob wir nicht am
Ende (außer in den Gegenden, wo Hagelschlag zur Landplage gehoͤrt) das
Capital der Interessen, welche der Hagel verwuͤstet, an Mißwachs und
Krankheit, und so vielleicht gar mit der Haut bezahlen? Diese Gewissensfrage hat
Herr Le Normand nicht beruͤhrt.
Corrections Methode der Local-Abweichungen des Schiffs-Compasses.
Ueber diesen fuͤr die See-Schiff-Fahrt so hoͤchst wichtigen Gegenstand
findet sich ein sehr lehrreicher Aufsaz des Herrn Peter Barlow, Professor an der k. Militaͤr-Akademie zu Woolwich, sowohl
in den Transactions of the Society
for the Encouragement of Arts, Manufactures and
Commerce, als in dem Repertory of Arts, Manufactures and
Agriculture. N. 250. Maͤrz. S. 206, auf welchen wir, da der Raum
unserer Blaͤtter die Aufnahme desselben nicht gestattet, unsere deutschen
Seefahrer aufmerksam machen zu muͤssen glauben. Herr Barlow erhielt fuͤr diese Mittheilung an die Society die große goldene Medaille und die vollstaͤndige Sammlung
aller ihrer Werke.
Ueber die Unsicherheit des 0 Punctes am Thermometer
haben wir im polytechn. Journal, B. IX. S. 135, unsere Leser auf die Versuche
des Herrn Bellani aufmerksam gemacht. Diese Beobachtungen
und Versuche finden sich in den Annales de Chimie etc.
November 1822 S. 330 bestaͤtigt mit der Bemerkung, daß an guten geschlossenen
Thermometern der 0 Punct nach Jahren oft um 2° abweicht. Man muß daher alte
geschlossene Thermometer von Zeit zu Zeit rectificirenrectifiren. Nicht geschlossene Thermometer, so wie man sie in den aͤltesten
Zeiten hatte, und Weingeist Thermometer scheinen
dauerhafter.
Ueber Reinigung der Luft in Schauspielhaͤusern
findet sich in der Revue
Encyclopédique und aus dieser im Repertory of
Arts etc. Maͤrz 1823. S. 250 ein Aufsaz, aus welchem wir nur
folgende Thatsachen anfuͤhren wollen; daß naͤmlich 1tens die Luft in
den Schauspielhaͤusern, chemisch untersucht, eben so rein befunden wurde, als
auf freier Straße; daß aber 2tens wegen Erhoͤhung der Temperatur die Luft in
denselben viel trokener, als gewoͤhnlich, sich zeigte, und daher sich die
Beschwerlichkeiten erklaͤren sollen, die einige Personen bei dem Athemholen
in Schauspielhaͤusern finden. Man preiset den Bau des Opernhauses in Paris,
das des Winters mit warmer Luft gehizt wird, die außer dem Hause (wegen
Feuers-Gefahr) erhizt wird, als Muster aͤhnlicher Gebaͤude,
vorzuͤglich in Hinsicht der Ventilation, die durch eigene Waͤrmer (Caloriféres) unterhalten wird, theilt aber keine
planmaͤßige Beschreibung hieruͤber mit.
Fortin's Marmite evasineptique.
Ueber diese Art von Papinian'schen Kochtopf, den Herr Fortin sehr unverstaͤndlich Marmite evasineptique nennt, hat Herr Bouriat
im Bulletin de la Société d'Encouragement de
l'Industrie nationale N. 219. S. 280 Bericht erstattet. Die gegebene
Beschreibung, obschon die Vorrichtung des Topfes sehr einfach ist, ist zu kurz, als
daß sie ohne Abbildung deutlich seyn koͤnnte. Man kann in laͤngstens
3/4 Stunden Fleisch in diesem Topfe gar kochen, die Temperatur, welche das Wasser
darin erhaͤlt, ist 111° Reaum.; hoͤher kann sie nicht gebracht
werden. Ehe man den Topf oͤffnet, muß er eine halbe Stunde lang
abgekuͤhlt worden seyn. Da die Commissaire fanden, daß man in diesem Topfe
nicht so schmakhaft kocht, wie in anderen, und daß er in jedem Falle wegen
moͤglicher Gefahr bei der Anwendung Vorsicht erfodert, so glauben sie, daß er
in Fabriken, wo man Knochen, Horn, Schildpad, Holz etc. schnell erweichen muß,
allenfalls auch in Apotheken, bei der Armee im Kriege und aus Schiffen, mit Vorsicht
angewendet werden koͤnnte. Sie schlagen, statt der eisernen Griffe am Dekel,
Stahl-Federn zu groͤßerer Sicherheit vor. Um diese Toͤpfe kennen zu
lernen, scheint kein anderes Mittel, als im Dépôt des marmites de Monsieur Fortin bei Herrn Longuemare jeune, rue St. Honoré, N. 176 près celle Croix-des-Petits-Champs einen solchen
zu kaufen. Ein Taps der 4 Litres1 Litre ist etwas mehr als 7/10 Wien. Maß. A. d. Ueb. faßt, kostet 36 Franken; mit 6 Litres 42 Franken; mit 8 Litres 48; mit 12
Litres 60 Franken.
Ueber die wohlfeilste Heizung der Treibhäuser
hat Herr Th. Andr. Knight, Esq.,
Praͤsident der horticultural Society of London,
in den Transactions dieser Gesellschaft, eine kleine
Abhandlung mitgetheilt, welche sich auch im December-Stuͤke des Repertory of Arts, Manufactures and Agriculture S. 34
befindet, und aus welcher Folgendes das Wesentlichste ist:
Er laͤßt Steinkohlen-Staub oder Abfaͤlle derselben, die nicht
zusammensintern, wenn sie erhizt werden, sehr naß mit einem Drittel Thon oder
Schlamm (dem Umfange nach) mengen, Und diese Mischung, nachdem sie aus einem flachen
Steine fest und gehoͤrig dik geschlagen wurde, in vierekige Stuͤke von
halber Ziegel Groͤße schneiden. Ein Rost von gewoͤhnlichem Baue, aber
von groͤßerem Umfange (ungefaͤhr 2 Fuß im Gevierte) wird in dem Ofen
vorgerichtet, indem eine groͤßere Masse dieses langsam verbrennenden
Brennmateriales noͤthig ist, und da die nasse Kohle schlechter brennt, ist
ein etwas staͤrkeres vorlaͤufiges Feuer von Holz noͤthig, in
welches die kuͤnstlichen Steinkohlen-Ziegel auf einer gewoͤhnlichen
Ofen-Schaufel eingelegt werden. Sir Knight verbrauchte in
den kaͤltesten Tagen waͤhrend 24 Stunden nicht mehr als 70–80
Pfund Kohlenstaub, (à 10 Schilling die Tonne oder
20 Ztr.) der ihm auf 7 Pence (25 1/2 Pfennig Saͤchsisch) zu stehen kommt. Der
gebrannte Schlamm dient als Duͤnger, und bezahlt sich reichlich. Das Feuer
ward bei ihm an den kaͤltesten Tagen vor 5 Uhr Abends angeschuͤrt,
ohne daß man vor 7 Uhr am naͤchsten Morgen bei demselben nachzusehen
noͤthig hatte: das Haus war 40 Fuß lang, und 12 breit, und hatte nur einen
Herd. Nur in sehr stuͤrmischen Naͤchten wurden einige Buͤndel
Holz oder Erbsen-Staͤngel nachgelegt.
Sir Knight glaubt, daß der Thon oder Schlamm nicht, wie es bei'm ersten Anblike
scheinen moͤchte, bloß dadurch nuͤzt, daß er die Verbrennung langsamer
macht, sondern daß hier, indem diese Steinkohlen-Ziegel immer naß in das Feuer
kommen, eben dasjenige Statt hat, was dann geschieht, wenn man gruͤnes und
trokenes Holz zugleich mit einander brennt. Bekanntlich erhaͤlt man auf diese
Weise mehr Licht und Waͤrme, als wenn man gleich viel trokenes Holz brennt,
was von der Zersezung des Wassers herruͤhrt, dessen Sauerstoff in
Beruͤhrung mit der atmosphaͤrischen Luft flammend verbrennt. Diese
Erklaͤrung hatte auch den Beifall der Herren Humphrey Davy und Pepys. Ein
Theil des Wassers dieses nassen Brenn-Materiales bleibt uͤberdieß immer im
Dampfzustand, und dieser Dampf verdichtet sich an den kuͤhleren Stellen der
Zuͤge, wo er von den Ziegeln eingesogen und als Dampf in das Haus
abgeschieden wird, welches er dadurch feucht erhaͤlt, und zugleich auch das
Gedeihen der Gewaͤchse bei einer hoͤheren Temperatur so sehr
foͤrdert.
Neue Methode, Pflanzen in Orangerien und Treibhaͤusern zu begießen. Von Jos. Sabine, Esq. F. R. S. etc.
Herr Georg Loddiges, Teilnehmer an her Firma Loddiges und Soͤhne (der beruͤhmten Besizer
eines der groͤßten und reichsten Handelsgaͤrten in Europa) erfand
folgende einfache und Zeit und Muͤhe ersparende Methode, seine Pflanzen in
den Haͤusern zu begießen, welche weit wohlthaͤtiger auf die
Gewaͤchse wirkt, als das gewoͤhnliche Begießen derselben mit der
Gießkanne.
Eine bleierne Roͤhre von einem halben Zoll im Lichten wird an einem Ende des
Treibhauses in dasselbe geleitet, und so gelagert, daß der Hahn, der das Wasser
absperrt und zufließen laͤßt, leicht gedreht werden kann. Von dem Hahne aus
laͤuft sie entweder oben oder an der hinteren Wand des Hauses hin oder
innerhalb an den Fenstern, und zwar horizontal und gerade durch das Haus. Sie ist an
der Wand oder an der Deke mittelst eiserner in gehoͤriger Entfernung
angebrachter Haͤlter befestigt. Von dem Puncte an, wo diese Roͤhre
horizontal zu werden beginnt, ist sie mit sehr feinen Loͤchern versehen,
durch deren jedes, wenn der Hahn geoͤffnet wird, das Wasser in einem feinen Strome
herausquillt, waͤhrend es herabfaͤllt, sich bricht, und so in Gestalt
eines schoͤnen Sommer-Regens auf die Pflanzen herabrieselt. Die
Loͤcher werden mittelst einer feinen Nadel, welche wie eine Ahle an einem
hoͤlzernen Griffe befestigt ist, in die Roͤhre eingebohrt, und da man
diese Loͤcher nicht fein genug machen kann, so muß man die allerfeinsten
Nadeln hiezu waͤhlen, von welchen dann auch viele waͤhrend der
Operation abspringen. Die Loͤcher muͤssen so eingebohrt werden, daß
das Wasser in jeder erfoderlichen Richtung sich vertheilen kann, und in dieser
Hinsicht muß die jedesmalige Lage der Roͤhre und die Stellung der zu
wassernden Pflanzen bei den Einbohren dieser Loͤcher genau erwogen werden.
Die Loͤcher muͤssen im Durchschnitte, zwei Zoll von einander entfernt
und horizontal seyn: am Anfange der Roͤhre sollten sie etwas weiter von
einander, am Ende derselben etwas naͤher an einander stehen, wegen des
verhaͤltnißmaͤßig groͤßeren und geringeren Drukes des Wassers,
welches gleichfoͤrmig durch das ganze Haus vertheilt werden muß. Eine
Roͤhre ist fuͤr ein mittelmaͤßig langes Haus genug: eines der
Haͤuser der HH. Loddiges, welches auf diese Weise
gewaͤssert wild, ist 60 Fuß lang. Wo das Haus laͤnger ist, muß
nothwendig die Roͤhre weiter seyn. Der Wasserbehaͤlter, aus welchem
die Roͤhre ihr Wasser erhaͤlt, muß so hoch uͤber dem Niveau der
Roͤhre liegen, daß das in dieselbe aus ihm einstroͤmende Wasser
Schnelligkeit genug erhaͤlt, um rasch genug fortzulaufen, indem es sonst bei
den Loͤchern nur tropfenweise heraus kommen wuͤrde. Da man
uͤbrigens die Gewalt des einstroͤmenden Wassers durch den Hahn nach
Belieben regeln kann, so kommt alles darauf an, daß man dem Wasser Gewalt genug zu
verschaffen wisse.
Allerdings gehoͤrt zur gluͤklichen Anlage dieser Vorrichtung einige
Genauigkeit; wenn man aber diese nicht scheut, so ist der Vortheil, den man von
derselben erhaͤlt, wie man bei den HH. Loddiges sich uͤberzeugen kann,
auch wirklich ganz außerordentlich. (Aus den Transactions of
the London Horticultural Society.)
Ueber hohle GartenmauernHohle Gartenmauern werden bereits im Koͤnigreich Wirtenberg und nun
auch die Steine hiezu vom Baurath B. v. Hoͤßlin in Louisensruhe bei
Augsburg auf Bestellung verfertigt. Fig. 33. Tab. V. haben wir eine solche Gartenmauer
abbilden lassen. D..
Hr. Henry Silverlock beschreibt in den Transactions der Londoner Horticultural Society (aus welchen das Repertory of
Arts, Manufactures et Agriculture December 1822. S. 37. diesen Aufsaz
entlehnte,) die hohle Gartenmauer des Carl of Arran zu
Bognor in Sussex, und lobt dieselbe aus Erfahrung an seinem eigenen Garten und an
den Gaͤrten derjenigen, bei welchen er solche Mauern baute. Er findet sie
nicht bloß hinlaͤnglich fest und dauerhaft, sondern um ein ganzes Drittel
wohlfeiler, und bemerkt, daß sie nach anhaltendem Regen fruͤher troken wird,
als die gewoͤhnlichen Mauern. Die Mauer wird aus guten flachen
gleichfoͤrmigen Ziegeln, neun Zoll dik, gebaut, und die Ziegel werden auf die
Kante gestellt, sorgfaͤltig in einander gepaßt, und mit dem beßten
Moͤrtel belegt. Die Ziegel werden abwechselnd mit ihren Flaͤchen und
Enden gegen die Aussenseite der Mauer gelegt, so, daß diejenigen Ziegel, welche mit
ihren Enden hervorstehen, die Flaͤchen der Mauer binden. So wie die Mauer
aufgebaut wird, kommen abwechselnd die Ziegel, welche mit ihren Enden hervorstehen,
auf die Mitte des der Laͤnge nach in der untern Reihe hin liegenden Ziegels
zu stehen. Auf diese Weise entsteht ein hohler Raum in der Mitte der Mauer von vier
Zoll Weite, der nur dort unterbrochen wird, wo die Verbindungs-Ziegel denselben
durchkreuzen: uͤbrigens kann die Luft von oben bis unten frei durch die
Mauer. Oben bekommt die Mauer, als Dach, eine Reihe schuͤzender Ziegel, die
mit einer Schichte Portland-Steinen bedekt ist, welche 2 Zoll weit hervorragen, und
alle 20 Fuß weit mit 14 Zoll breiten Pfeilern gestuͤzt sind, die auf aͤhnliche
Weise mit auf die Kanten gelegten Ziegeln in Einem fort mit der Mauer laufend erbaut
werden.
Fruͤhe Erdaͤpfel in Gaͤrten im Freien zu ziehen.
Der beruͤhmte Sir Thom. Knight, Esqu., theilt in einem Aufsaze in den Transactions of the London Horticultural Society,
welcher sich auch im Repertory of Arts, Maͤrz
1823. N. 250 S. 245 befindet folgende Beobachtungen
hieruͤber mit: „Es ist allgemein bekannt“ sagt er,
„daß, wenn man spaͤte Erdaͤpfel haben will, man nur sehr
kleine Stuͤke von den Knollen der Erdaͤpfel legen darf, welche
lange Zeit brauchen, bis sie wieder Knollen bilden. Eben so werden umgekehrt die
groͤßten Knollen wieder am fruͤhesten andere junge Knollen
erzeugen.“ Er schlaͤgt daher vor, um fruͤhe
Erdaͤpfel zu bekommen, im Spaͤtherbste die groͤßten und
staͤrksten Knollen auszulesen, und diese im naͤchsten
Fruͤhlinge so bald als moͤglich zu legen. Diese staͤrkeren
Knollen werden zugleich auch staͤrkere Triebe bilden, und dadurch auch im
Stande seyn, dem Froste im Fruͤhjahre kraͤftiger zu widerstehen, als
die Schwaͤchlinge aus den kleinen Knollen. Die Knollen muͤssen ferner
so in die Erde gelegt werden, daß die Leitungsknospen nach Aufwaͤrts stehen,
und nicht nach Abwaͤrts gekehrt sind, indem sie dank nicht bloß
fruͤher treiben, sondern auch staͤrkere Triebe bilden. Er fand es auch
oͤfters sehr zutraͤglich, die Pflanzen, so wie sie in ihren Reihen
erschienen, zu haͤufeln, wodurch sie gegen den Frost geschuͤtzt, und
nichts weniger als verspaͤtet werden. Hr. Knight
findet nicht, daß dadurch, daß man große Knollen legt, uͤbel gewirthschaftet
wuͤrde, wo man eine mehr Ertrag gebende fruͤhe Ernte dabei gewinnt. Er
zeigt uͤbrigens durch Versuche, daß die gewoͤhnliche Idee, als ob der
alte Knollen nichts zur Erzeugung der jungen und der Triebe von seiner eigenen
Substanz hergaͤbe, ganz falsch ist.
Tuͤrkisches Korn oder Mais als Viehfutter.
Ein Landwirth macht in Tillochs
Mag. und Journ. S. 433 den
Vorschlag, den Mais, oder das sogenannte tuͤrkische Korn (in Tirol Tuͤrken, in Niederoͤsterreich, Kukurus), da er in England (so wie bei uns in Alt-Baiern
und in jedem Hopfenlande, wo die Rebe nicht mehr gedeiht) nur selten reift, und nie
mit Vortheil gebaut werden kann, als Gruͤnfutter oder zu trokenem Futter, zu
Haͤkerling zu ziehen, indem wenige andere einjaͤhrige Pflanzen so
schnell und uͤppig wachsen, und keine Grasart, Zukerrohr ausgenommen, soviel
Zukerstoff enthaͤlt. Er versichert, gehoͤrt zu haben, daß man in
Amerika hier und da wirklich Zuker aus demselben bereitet; wahrscheinlich war es ihm
unbekannt geblieben, daß Baron v. Meidinger, im Anfange
dieses Jahrhundertes, und noch vor der großen Zukertheurung als Folge der
Continental-Sperre, in Oesterreich aus Mais wirklich Zuker gemacht und eine eigene
Abhandlung uͤber Bereitung des Zukers aus
Maisstaͤngeln geschrieben hat; auf jeden Fall ist das Daseyn des
Zukerstoffes in den Staͤngeln oder Halmen dieser Pflanze erwiesen. Er
raͤth, unter den vielen Varietaͤten dieser Pflanzenart, in Hinsicht
auf Gruͤnfutter und ohne alle Ruͤcksicht auf die Frucht, diejenige zu
waͤhlen, welche die hoͤchsten Staͤngel und die breitesten
Blaͤtter treibt; und diese, im vollsten Wuchse und Safte geschnitten, dem
Hornviehe, so wie man es in Amerika zu thun pflegt, als Haͤkerling im Winter
zu verfuͤttern. Der Versuch, den der Hr. Verfasser anstellte, geschah bloß im
Kleinen, auf 3 Quadrat Yards (der Yard ist 3 engl. Fuß), auf welchen er 126
Pflanzen, 42 auf jedem □ Yard, im Junius baute. Im August hatte ein mittlerer
Staͤngel ungefaͤhr 3 Fuß Hoͤhe, und wog 24 Loth. Bis in den
October hinaus wogen mehrere dieser Staͤngel 5 Pf. Er glaubt hieraus den
mittlern Ertrag eines mit Mais bepflanzten Aker-Landes, wenn derselbe im August
geschnitten wird, auf 60 Tonnen, im Oktober geschnitten, auf 120 Tonnen berechnen zu
koͤnnen: wir wollen, weil der Versuch sehr im Kleinen angestellt wurde,
einstweilen ein Drittel
fuͤr Reibung abziehen, und waͤhrend der Hr. Verfasser das Mittel von
60 + 120 Tonnen = 90 Tonnen per Acre nimmt, (einen
hoͤheren Ertrag, als kein anderes Gruͤnfutter gibt) nur von 40 + 80
das Mittel, also 60 Tonnen, oder 1200 Ctr. rechnen: es wird dieß genug, und mehr als
jeder andere Ertrag an Gruͤnfutter seyn.
Als Beweis, wie gern auch die nicht bloß Pflanzenfressenden Thiere dieses Futter
selbst noch troken gern fressen, fuͤhrt er eine Erfahrung an, die er an
seinen Mastschweinen machte, welche er mit soviel Korn und Erdaͤpfeln, als
sie fressen mochten, maͤstete, und auch noch auf die Wiese ließ. Er gab ihnen
zur Ruhezeit einen Arm voll Mais Staͤngel, und sie frassen sie mit Gierde.
Als in der spaͤteren Jahreszeit dieselben zu holzig wurden, nagten sie den
holzigen Theil weg, und frassen nur das suͤße Mark aus denselben. Unsere
Nachbarn, die Tiroler, werden in diesem Verfahren keine Neuigkeit finden; wir
koͤnnten aber ihr Beispiel nachahmen.
Der Boden, auf welchem dieser Versuch angestellt wurde, war an sich schlecht, nasser
Thon-Boden, aber gut geduͤngt.
Handelsgarten der Gebruͤder Audibert zu Tonelle bei Tarascon.
Da die großen und herrlichen Obstbaumschulen, und die zahlreiche Sammlung von
auslaͤndischen Baͤumen, Gestraͤuchen und Zierdepflanzen des
Suͤdes, welche die Gebruͤder Audibert zu
Tonelle besizen, in Deutschland nur wenig bekannt sind, so halten wir es fuͤr
Pflicht, deutsche Gartenfreunde, und vorzuͤglich solche, welchen die
Fruͤchte des Suͤdes lieb und werth sind, auf die selben aufmerksam zu
machen. Fuͤr sehr billige Preise und gewissenhafte Bedienung haftet die
Redaction des polytechnischen Journals, welche Bestellungen fuͤr die Hrn. Audibert annimmt, und bei welcher der Catalogue des arbres, arbrisseaux, arbustes et plantes,
cultivés dans les pépiniéres et sérres des
frères Audibert, propriètaires Pépiniéristes,
à Tonelle, près Tarascon (Departement
des Bouches du Rhone) Avignon 1822. 3.
einzusehen ist.
Wasser-Wagen.
Man hat mit diesem Wagen, welcher in der Bay von Dublin bei Gelegenheit der lezten
Reise des Koͤnigs nach Irland seine Kuͤnste machte, nun auch zu London
Versuche angestellt, und gefunden, daß er auf dem Wasser drei englische Meilen in
einer Stunde zuruklegt. Mercure technologique Jan. 1823.
S. 103.
Korallen-Fischerei.
Die Wichtigkeit der an der Nord-Kuͤste von Afrika zwischen Caletraverse
(diesseits des Cap-Rose) bis Cap-Roux getriebenen Korallen-Fischerei, und der mit
Verarbeitung derselben beschaͤftigten Fabriken erhellt aus folgender
Thatsache. Im J. 1821 wurden vom 1ten April bis 1ten Oktober von 30
franzoͤsischen, 70 sardinischen, 39 toscanischen, 83 neapolitanischen und 19
sicilianischen Barken, welche 241 Fahrzeuge mit 2274 Matrosen bemannt waren, 44,200
Pfd. Korallen gefischt, die man im Durchschnitte auf 463,000 harte Piaster oder
2,400,000 Franken schaͤzt. Merc. technol. Jan.
1823. S. 111.
Robben- oder Seehund-Felle.
Bekanntlich werden die Robben, wie die Wallfische, am Nordpole immer weniger. Man
macht daher jezt auf beide am Suͤdpole Jagd, wo erstere in wahrhaft
ungeheuerer Menge sich finden. Ein einziger nordamerikanischer China-Fahrer aus
New-York erschlug auf einer der suͤdlich von Tristan
d'Acunna
gelegenen, wenig
besuchten, Crozat-Inseln in wenigen Wochen 60,000 Robben, und fuhr mit den Fellen
derselben nach Canton, wo er sie gegen Thee, Nankins und Seiden-Waaren vertauschte.
Merc. technol. A. a. O.
Neue Faiance-Fabrik der HHr. Fouque u. Arnoux zu Toulouse.
Nach dem Berichte der Akademie zu Toulouse dd. 14. August
1822 (im Mercure technique Jan. 1823 S. 86) verfertigen
diese Herren Toͤpfen-Waaren à la Wedgwood,
die nichts zu wuͤnschen uͤbrig lassen. Allein dieser ganze Bericht ist
so voll gespikt mit Geheimnissen (Sécrets), daß
er fuͤglich haͤtte ungedrukt bleiben koͤnnen, außer die
Akademie wollte in Geheimniß-Kraͤmerei mit den uͤbrigen jezigen
koͤnigl. technischen Anstalten in Frankreich wetteifern.
Feuer-Maschinen.
(Beitraͤge zur Geschichte der Erfindungen.)
Im Mercure technologique Jan. 1823. S. 49. findet sich
ein Traité historique et pratique des machines
à feu, ou de tous les moteurs produits par l'application du calorique
à l'air, à des gaz, à la poudre à canon, et à
plusieurs autres corps: par P. M. de Montgéry, Cap. de frégate
etc., das zwar fuͤr den Gelehrten wenig
Neues, fuͤr den Dilletanten hingegen eine nicht ganz uninteressante
Lectuͤre gewaͤhrt. Frankreich wuͤrde allerdings auf die
Erfindung der Dampfmaschinen Anspruch haben, wenn es den bekannten Erfinder des
papin'schen Topfes, den Arzt Papin, nicht durch den
beruͤchtigten Widerruf des Edictes von Nantes gezwungen haͤtte, den
Bluthochzeitern zu entrinnen, und sein Asyl bei uns in Deutschland zu suchen. Ein
gewißer Abbé de Hautefeuille zu Orleans
beschuldigte zwar Papin des Plagiates: allein wie oft erlaubten sich nicht die Abbés, die armen Huguenotten auch noch moralisch
zu toͤdten, nachdem sie dieselben vorlaͤufig physisch todtschlagen
ließen.
Ueber eine Weise, die hin- und her gleitenden Theile an Morey's sich drehender Dampf-Maschine zu schmieren, und uͤber einen verbesserten Dampfkessel
hat Hr. Sullivan, Esq., in Sillimann's
American Journal of Science et Arts Vol., V. N. 1. einen Aufsaz mitgetheilt, welcher sich auch in
Hrn. Gill's
techn. Repository N. 10. S. 265 abgedrukt befindet. Der
keine Zeichnung beigefuͤgt ist, so ist er fuͤr den groͤßten
Theil der Leser unverstaͤndlich, und kann nur fuͤr
Dampfmaschinen-Fabrikanten von Profession interessant seyn, welche wir hierauf
aufmerksam zu machen fuͤr unsere Pflicht halten.
Verbesserungen bei dem Steindruke.
Hr. K. M. Willich empfiehlt, das Leder nicht wie
gewoͤhnlich mit Oel oder Fett, sondern mit venetianischer oder spanischer
Seife zu bestreichen, wodurch alle Fettfleken vermieden werden. Tilloch's et Taylor's Philos. Mag. et Journ. N. 293. S.
206. Hr. Malapeau drukt Oelgemaͤhlde Mittelst
Steindrukes ab. Lond. Journ. of Arts N. 22. S. 218.
Neue Schreibtafeln zum Schreiben Lernen fuͤr Kinder.
Bekanntlich hat Hr. Keyworth zu Sleaford in Lincolnshiere
schon im J. 1814 von der Londner Society for
Encouragement einen Preis fuͤr Schreibtafeln aus sehr duͤnnem
Horne erhalten, welche die Kinder nur auf die Vorschrift legen duͤrfen, um
diese durch dieselben nachzuschreiben, und dann wieder ausloͤschen
koͤnnen, um die Uebung zu wiederholen. Hrn. Keyworth's Taͤfelchen brauchten aber Schrauben und einen
duͤnnen Ueberzug aus Spanisch-Weiß. Hr. Leroy,
Professor der Schreibkunst zu Paris, Chaussée d'Antin,
N. 52, bedient sich jezt gleichfalls solcher Taͤfelchen aus Horn,
die er aber an der oberen Flaͤche etwas matt haͤlt, indem er sie mit
etwas Harz reibt, um den Ueberzug zu ersparen, und dock mit einer nicht scharfen,
nicht beizenden Tinte darauf schreiben, und diese mit einem Schwamme leicht
wegwaschen zu koͤnnen. Die Vortheile fuͤr den Schreibschuͤler,
der hier eine sichere und bestimmte Hand erhaͤlt, fuͤr die Eltern, die
Risse von Papier ersparen, ist einleuchtend, und Hr. Leroy verdiente allerdings fuͤr diese Erfindung, oder vielmehr
fuͤr diese Verbesserung einer englischen Erfindung, eine Belohnung: nur fragt
es sich: woher wir Horn genug nehmen sollen; oder ob wir der Hoffnung leben
koͤnnen und duͤrfen, daß in unsern Zeiten die Hoͤrner aller Art
nicht so leicht ausgehen werden? (Vergl. Bulletin de l. Soc.
d' Encour. p. l' industr. nat. N. 218. S. 255.)
Ueber Ledergaͤrberei und Faͤrberei.
Hr. Joh. Neilson, Leimfabrikant zu Linlithgrow in
Schottland, ließ sich ein Patent, dd. 19. Jun. 1819, auf
die Anwendung gewisser Pflanzenstoffe zum Ledergaͤrben und Faͤrben
ertheilen, welche bisher in dieser Hinsicht nicht gebraucht (not hitherto used) wurden. In der im Repertory of
Arts, Manufactures et Agriculture, Dezember 1822, S. 14. gegebenen
Erklaͤrung nennt er als diese Pflanzen:
Saxifraga crassifolia, (G. F.)G bedeutet, daß alle Theile der Pflanze
Gaͤrbestoff enthalten; w daß dieser
vorzuͤglich im Gaͤrbestoffe enthalten ist; u. F, daß sie zugleich Faͤrbemittel ist.cordífolia, u. orbicularis . Rheum sibiricum (w)
crispum u. tataricum.
Geranium macrorrhizon, reflexum, lividum, phaeum, angulatum. Heuchera americana (G.
F.) u. villosa, Polygonum
undulatum oder canadense (w). Rhodiola rosea.
Nachdem er diese Pflanzen aus der Erde genommen hat, waͤscht er sie von Erde
und Sand rein, und braucht sie entweder frisch oder getroknet. Frisch wirken sie
schwaͤcher, wenn nicht, wie er sagt, ihr vegetabilischer Stoff! durch
maͤßige Hize, Dampf oder warmes Wasser, zerstoͤrt ist!! In jedem Falle
muͤssen, sie, wie er uns lehrt, geschnitten und entweder gestossen oder
gemahlen, und dann auf die zur Gaͤrbung auf die gewoͤhnliche Weise
vorbereiteten Haͤute oder Felle in waͤsseriger Aufloͤsung
angewendet werden, warm oder kalt, wie die Lederer und Lederbereiter es mit der Lohe
zu thun pflegen.
Hr. Neilson berechnet die Staͤrke seiner neuen
Pflanzen im Vergleiche mit englischer Eichenrinde wie folgt:
Man braucht zweimal so viel Blaͤtter der Saxifragen dem Gewichte nach als
Eichenrinde: von den Wurzeln der Saxifragen eben soviel, als von der
Eichenrinde.
Rheum sibiricum u. tataricum
ist der Wurzel der Saxifragen gleich; crispum ist etwas
schwaͤcher.
Die Geranien und Polygonen kommen an Staͤrke beinahe den Blattern der
Saxifragen gleich, und die Wurzel der Heuchera ist den Wurzeln der Saxifragen
gleich: die der Rhodiola ist aber beinahe doppelt so stark.
Diese Beobachtungen gelten uͤbrigens nur von frischen Pflanzen: getroknet
verlieren sie zwei Drittel an Gewicht, und auch etwas an Kraft. Die Pflanzen
muͤssen dann ausgezogen werden, wenn ihr Wachsthum aufgehoͤrt
hat.Schade, daß diese Pflanzen im mittleren Europa so wenig als in England wild
wachsen, einige derselben ausgenommen, und bisher nur in botanischen
Gaͤrten vorkommen, so daß man uͤber ihre Cultur im Großen noch
so wenig weiß, als uͤber die Guͤte des damit gegaͤrbten
Leders. A. d. Ueb.
In Hinsicht auf Faͤrberei empfiehlt Hr. Neilson, statt der
Sumach-Gallaͤpfel- oder Eichenrinde-Bruͤhe und Beize, obige mit F bezeichnete Pflanzen im Aufgusse! mit Wasser, indem
sie halb so stark, wie Sumach, und nur um drei Viertel!! schwaͤcher seyn
sollen als Gallaͤpfel.
Neue Retorten der Hrrn. Gibbons und Wilkinson zur Bereitung des Beleuchtungs-Gases aus Steinkohlen.
Aus dem Bulletin d. l. Soc. d' Encouragement N. 221 S. 378.
Die Hrn. Gibbons und Wilkinson
fuͤttern ihre gewoͤhnlichen Metall-Retorten innenwendig mit Ziegeln,
Thon, oder mit irgend einer anderen Substanz aus, die der zerstoͤrenden
Einwirkung der Saͤuren zu widerstehen vermag, und theilen sie, nach der
Richtung ihrer Achse, durch eine Scheidewand.
Auf die erstere Weise werden diese Retorten vorzuͤglich fuͤr chemische
Fabriken tauglich, weil sie von Sauren nicht angegriffen werden; auf die leztere
liefern sie mehr Ertrag, weil sie dem Feuer eine groͤßere Oberflaͤche
darbiethen: und diese taugt verzuͤglich zur Gas-Erzeugung. Es ist bekannt,
daß, wenn man die Steinkohlen zerkleint, man schneller und in groͤßerer Menge
Gas erhaͤlt. Die Hrn. Gibbons und Wilkinson bedienen sich sehr großer Retorten aus Gußeisen
mit doppelter Scheidewand. Das untere Fach, 10 Fuß uͤber dem Grunde der
Retorte, nimmt die Steinkohlen auf; das zunaͤchst daruͤber liegende
die Cokes, den Thon etc., welche, bei einer sehr hohen Temperatur, den Theer
zersezen, und in sehr reines Gas verwandeln. Die groͤßte Retorte dieser
Herren gibt, binnen 24 Stunden, 6,000 Cubic-Zoll. Auf diese Weise wird auch das
Verlegen dieser Retorten mit Theer beseitigt.
Ueber Oelgas-Gewinnung aus Oel-Saamen.
Die Gesellschaft, welche Paris mit Oelgas aus Oel-Samen, vorzuͤglich aus Hanf-
und Reps-Samen, beleuchtet, hat ihr großes Unternehmen bereits mit dem
gluͤklichsten Erfolge begonnen, und bewiesen, daß, weit entfernt, daß die
Oelgas-Bereitung aus Oel-Samen, wie einige behaupteten, ein Ruͤkschritt in
der Kunst der Gasbeleuchtung ist (Vergl. polytechn. Journ. B. 9. S. 264), dieses Verfahren vielmehr vor
jedem anderen den Vorzug verdient. Es ist keine Reinigung des auf diese Art
gewonnenen Gases noͤthig; denn es riecht durchaus nicht, leuchtet zweimal so
stark als Steinkohlen-Gas, und besizt in jeder Hinsicht Vorzuͤge vor dem auf die
gewoͤhnliche Weise gewonnenen Thrangase. (Gill's
Repository, II. B. N. 6. p.
428.)Auf die vortheilhafteste Gewinnung des Oelgases aus ausgepreßten und
unausgepreßten Oelsamen habe ich, auf vorausgegangene Versuche
gestuͤzt, im 6 B. S. 309. in diesem Journal zuerst aufmerksam gemacht
und daselbst die Vortheile, welche die Gewinnung des Oelgases aus Oelsamen
fuͤr die Landwirthschaft und die Staatsoͤkonomie darbietet,
auseinander gesezt. Diese meine Erfindung wird nun auch hoffentlich da in
Deutschland Eingang finden, wo es an guten und wohlfeilen Steinkohlen
gebricht, zumal sie auch das Ausland gut fand, und sich der Anwendung zur
Beleuchtung der Hauptstadt Frankreichs von einer mit aus Englaͤndern
bestehenden Gesellschaft zu erfreuen hatte. Fuͤr die Abtheilung der
polytechnischen Lehranstalt, welche sich in meinem Fabrikgebaͤude
befindet, habe ich durch baukundige Eleven, welche an dem Unterrichte dieser
Anstalt Theil nehmen, einen solchen Gas-Apparat ausfuͤhren lassen,
durch den mit aus ausgepressten Oelsamen gewonnenem Oelgas die drei
Modellir- und Maschinenwerkstaͤtten, der chemische Hoͤrsal,
die Stiegen, der Hofraum und eine Straffenlaterne, leztere durch einen aus
acht Lichtern hervorgebrachten Sonnenkreis, auf's Brilanteste erleuchtet
werden. Ein baierscher Zentner ausgepreßter Oelsamen (Oelkuchen von
Repssamen), der hier einen Gulden kostet, gibt 250 bis 280 franz. Cubicschuh
reines Oelgas. Diesen Sommer, werde ich durch wiederholte Versuche die
Ergebniße der wohlfeilem ausgepreßten und unausgepreßten Oelsamen auf reines
Oelgas ausmitteln und die Resultate in diesem Journal mittheilen. D.
Mittel zur Vertreibung der Insecten: Wanzen, Blattlaͤuse, Raupen etc.
Man nimmt Holzschwaͤmme, oder von den großen braunen stinkenden
Loͤcherschwaͤmmen, 3000 Gramm, d.i. 6 ℔; schwarze Seife, 1000
Gramm, d.i. 2 ℔; geraspelte Kraͤhenaugen 64 Gramm, d.i. 4 Loth;
gemeines Wasser, 1,000,000 Gramm oder 200 ℔.
Man gibt die zerquetschten Schwaͤmme, wenn sie anfangen zu faulen, in das
Wasser, in welchem die Seife aufgeloͤst ist, und laͤßt alles in einem
Fasse einige Tage uͤber faulen, waͤhrend welcher Zeit man die
Fluͤssigkeit oͤfters umruͤhrt. Wenn diese bereits recht
stinkend geworden ist, gießt man einen Absud der obigen Menge von
Kraͤhenaugen in hinlaͤnglicher Menge Wassers in dieselbe. Mit dieser
Fluͤssigkeit besprizt man die Gegenstaͤnde, welche man gegen die
Insecten sichern will, sowohl in den Garten, als anderswo, huͤthet sich aber,
Vergoldungen oder polirte Metallarbeiten damit zu besprengen, indem diese schwarze
Fleken davon erhalten wuͤrden. Die Insecten koͤnnen diesem stinkenden
Gifte nicht widerstehen. Aus dem Journal de Pharmacie.
Fevrier 1823. S. 61.Wir theilen dieses Mittel nicht zur Anwendung, sondern bloß darum mit, um
dagegen zu warnen. Daß Niemand seine Wohnzimmer, seinen Blumengarten mit
solchem pestilentialischen Gestanke erfuͤllen wird, versteht sich
zwar von selbst, und wird keiner Bemerkung beduͤrfen; daß aber der
Staub der Kraͤhenaugen, der an Gemuͤsen etc., die man im
Garten oder auf Feldern mit diesem Stinker uͤbergießen wuͤrde,
um sie gegen Insecten zu schuͤzen, in den Falten der Blaͤtter
etc. haͤngen bleiben wird, ein der Gesundheit hoͤchst
gefaͤhrliches Gift ist, von welchem man die damit oͤfters
begossenen Pflanzen nie wieder vollkommen reinigen kann, dieß glauben wir
hier unseren deutschen Lesern zu Gemuͤthe fuͤhren zu
muͤssen. A. d. Ueb..
Preis-Aufgaben der Société de Pharmacie de Paris fuͤr das Jahr 1823.
Die Société de Pharmacie schreibt in ihrem
Journal de Pharmacie, Fevrier 1823, p. 98.
fuͤr die beßte Beantwortung jeder der beiden folgenden Preisaufgaben einen
Preis von 500 Franken aus:
I. Bestimmen: ob die Schwefelsaͤure in vollkommen reinem
wasserfreiem Zustande vorkommen kann, und wenn dieß der Fall waͤre: 2tens
die Eigenschaften derselben, vorzuͤglich in Hinsicht ihrer Wirkung auf
brennbare Koͤrper, mit Erfahrungen belegt, aufzustellen; 3tens ein
Verfahren anzugeben, wie diese wasserfreie Schwefelsaͤure im Großen zu
erhalten ist.
II. Die Charaktere der Gallerte, des Eyweißstoffes und des
Schleimes in den Pflanzen vergleichungsweise zu bestimmen, und die geeigneten
Pruͤfungs-Mittel, wodurch man diese verschiedenen Stoffe sicher erkennen
kann, aufzusuchen.
Die Abhandlungen der Preiswerber muͤssen spaͤtestens bis 1sten April
1824 an Hrn. Robiquet, Sécrétaire général de la Société, rue
de la Monnaie n. 9. unter den gewoͤhnlichen Formalitaͤten bei
Preiswerdungen eingesandt werden.
Neueste franzoͤsische technische Litteratur.
L'Art du Boyaudier par Mr. Labarraque. 8. Paris. 1822Von diesem von der Société
d'Encouragement mit dem Preise gekroͤnten, und
fuͤr die deutsche Industrie so wichtigen Werke, werden wir eine
deutsche Uebersezung besorgen lassen, welches wir zur Vermeidung aller
Collisionen hier anzeigen.D. Redact..
Mémoire sur la mécanique, par M. le Cheval. de Buat. 4. Paris. 1822. T. 1. chez Didot.
Traité de mécanique industrielle, ou Exposé de la Science de la mécanique déduite de l'expérience et de l'observation, par
Mr. Christian, 4. Paris, 1822. I. vol. 25 Francs.
Recueil de machines, instrumens et appareils qui servent a l'économie rurale, et dont les avantages sont consacrés par l'expérience;
publié avec les détails nécessaires à la construction, par Mr. Leblancke. Folio oblong. Paris. chez Mdm. Huzard n. 7. VI. et VII. Livraison. (Jede Lieferung kostet 6 Franken).
Die Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale empfiehlt dieses Werk als hoͤchst brauchbar.
Nouvelle force maritime, ou exposê des moyens d'annuler la force des marines actuelles de haut-bord, et de donner à des navires
très-petits assez de puissance pour dètruire les plus grands vaisseaux de guerre. Par J. II. Paixhans, chef de batailion au corps royal d'artillerie, in 8vo. Bachelier.
Architectonographie des théatres de Paris, ou paralléle historique et critique de ces édifices, considèrés sous le rapport
de l'architecture et de la décoration. Par Alexis Donnet, gêographe, enrichi de 20 phanches en taile douce, et du plan de Paris. In 80. Orgiazzi, rue de la Harpe, no. 102. Doriez-Mongrie,
etc.
Calcul fait des pieds de fer suivant leur épaisseur et largeur, réduits au poids, suivi des tarifs à tant la livre et à tant
le cent. Par Mr. Bablot; nouvelle édition augmentée du tarif du poids du fer rond, suivant son diamètre, ainsi que du poids des pièces en fonte le
plus en usage, dans les bâtiments et les jardins. Par M***, architecte in 12. Bachelier.
L'art de la navigation orientale, et du commerce. Par Mr. l'abbé Ouvard. In 12, à Senlis.
Recueil d'expériences et d'observations faites sur différens traveaux exècutés pour la construction du pont de Nemours, pour
celle de l'arsenal et du pont militaire d'Anvers et pour la reconstruction du pont de Flessingue, dans le quel on a traité
de la thêorie et de l'equilibre des voutes, par L. C. Boistard, architecte, in 4to. 19 planches (Merlin).
Endlich ist auch der lezte, 16te Band, des:
„Nouveau cours complet d'agriculture theorique et pratique, ouvrage rédigé sur le plan de celui de feu l'ab. Rozier par les membres de la section d'agriculture de l'Institut de France“, in 80. (Deterville) erschienen. Preis fuͤr die 16 Baͤnde 120 Fr.
Neueste italienische polytechnische Litteratur.
Secreti concernenti le arti ed i mestieri. Traduzione italiana sull' ultima edizione francese. Traduzione del Sign, giov.
Pozzi. 8. Milano. 1822. p. Giovani Silvestri. I. Bd. 332. II. Bd. 415 S.
Der Titel darf nicht befremden; in unseren mystischen Zeiten ist alles
Geheimniß. „Das Geheimniß Gold zu
machen“ sagt ihr vortrefflicher Redacteur der Biblioteca italiana, Hr. Acerbi, (Januar 1823. S. 117) „werden
die Leser hier vergebens suchen“. Die italienischen
„(nicht die deutschen)“ Buchhaͤndler haben es zwar
darin gefunden; „behalten es aber fuͤr sich, und theilen
es weder dem Publicum noch den Autoren mit.“ Der zweite Theil
enthaͤlt lauter Faͤrbekuͤnste. A. d. B.
Pr. 7 lire.
Trattato dell' esterna conformazione del cavallo e degli altri animali domestici, di G. Batt. Volpi, Prof. d. Clinica nell J. R. Seuola Veterinaria di Milano. Opera postuma. 8. Milano. 1822. p. Silvestri. 348 S.
Vocabolario agronomico-italiano compilato da G. B. Gagliardo. III. Ediz. aumentata da 600 e piu vocaboli dal Dott. G. Chiappari. 8. Milano. 1822. p. Silvestri. 2 Livre, 30 Cent.
Dei prati del basso Milanese detti a marcita, di Domenico Brera. 8. Milano 1822. D. J. R. Stamperia. 159 S.
Wenn dieses fuͤr den Wiesenbau (der bei uns in Baiern so sehr
vernachlaͤßigt ist, da wir meistens entweder duͤrre Heiden
oder versumpfte Wiesen besizen) so aͤußerst wichtige Werk bei uns
eine Uebersezung, oder wenigstens einige Leser finden sollte, so wird
der Uebersezer so wie der geneigte Leser sehr wohl thun, wenn er mit
demselben die Biblioteca italiana N. 85. Gennajo 1823 S. 64–78 vergleicht. A.
d. B.
In der Antologia di Firenze, Fasc. 19° befinden sich: Osservazioni sull' agricoltura toscana, del D. F. Chiarenti. L'agricoltura dei Giudei desunta da Isaia; del Cav. Febroni. Dell' illuminazione per mezzo del Gas, del Prof. Taddei .
Im Giornale enciclopedico di Napoli. T. II. dell' anno 1821 befindet sich ein Aufsaz: Della formazione del nitro e degli altri sali che l' accompagnano: Memoria del Canonico J. M. Giovene . Ebendaselbst kommt auch eine Anzeige folgender Werke vor: Saggio scella tintura delle viole mammole come ottimo reagente in chimica di V. Pepe. – Lezioni di Agricoltura date nel R. Orto botanico di Madrid, di A. de Arias. – Del butirro e della maniera di farlo con facilita ad economia. 16. Milano. 1822. 23 S.
Tafeln