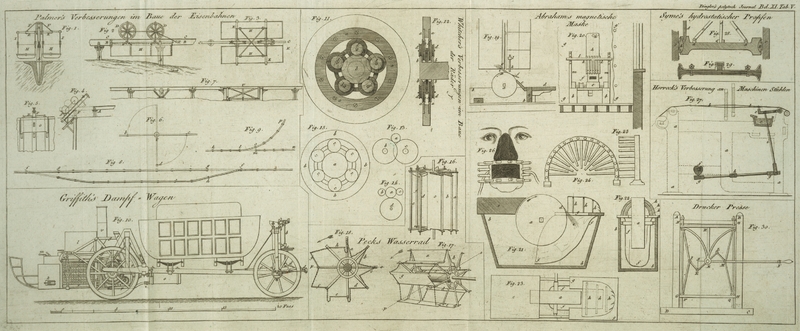| Titel: | Verbesserungen an Dampf-Wagen zum Versenden aller Arten von Waaren, und auch zum Gebrauche der Reisenden auf den gewöhnlichen Straßen, ohne alle Beihülfe von Pferden, worauf Jul. Griffith, Esqu., Brompton Crescent, Middlesex, sich, nach seinen Erfindungen sowohl als nach Mittheilungen von Ausländern, dd. 20. Dec. 1821, ein Patent geben ließ. |
| Fundstelle: | Band 11, Jahrgang 1823, Nr. XXVI., S. 186 |
| Download: | XML |
XXVI.
Verbesserungen an Dampf-Wagen zum
Versenden aller Arten von Waaren, und auch zum Gebrauche der Reisenden auf den
gewöhnlichen Straßen, ohne alle Beihülfe von Pferden, worauf Jul. Griffith, Esqu., Brompton Crescent,
Middlesex, sich, nach seinen Erfindungen sowohl als nach Mittheilungen von Ausländern,
dd. 20. Dec. 1821, ein Patent geben
ließ.
Aus dem London Journal of Arts etc. April 1823. S.
169Das London Journal bedauert, daß es noch keine
Versuche angeben kann, die mit diesem Dampfwagen oͤffentlich angestellt
worden sind, und verspricht dieselben mitzutheilen, sobald sie, da die hier
angegebenen Vorrichtungen noch immer Veraͤnderungen erleiden, Statt haben
werden. Diese Dampfwagen wurden in unserem Journale, da man ihre
Ausfuͤhrung zuerst in Wien versuchte, schon einigemal besprochen, und
wenn wir auch glauben, daß die Mechanik zu London auf einer hoͤheren
Stufe steht, als zu Wien, so zweifeln wir doch an dem Gelingen derselben. Man
sollte, so scheint es uns wenigstens, nicht so sehr sich darum kuͤmmern,
wie man die Pferde bei dem Fuhrwerke beseitigen kann (denn der liebe Gott hat
mehr Roͤsser als Menschen, geschaffen, und selbst an manchem Menschen
das, was man ein Roß Gottes nennt), sondern vielmehr darum, wie man durch irgend
eine leichte und einfache Vorrichtung, deren die Mechanik so viele besizt,
Pferde-Kraft ersparen, und Pferden und Menschen das Ziehen am Wagen erleichtern kann. Erleichterung einer Last ist genug
fuͤr denjenigen, dem sie nicht gaͤnzlich abgenommen werden kann.
A. d. Ueb..
Mit einer Abbildung auf Tab. V.
Griffith's Verbesserungen an Dampf-Wagen.
Diese Verbesserungen bestehen in einer gewissen Verbindung
mechanischer Kraͤfte, die durch Dampf in Thaͤtigkeit gesezt und an einem Wagen
angebracht werden, wodurch derselbe ohne Pferde auf den gewoͤhnlichen Wegen
fortgetrieben wird. Tab. IX zeigt diesen Dampf-Wagen von Außen. Die
Dampfmaschinen, deren man hier, weil die doppelten Staͤmpel ein Flugrad
ersparen, zwei braucht, sind, sammt Ofen, Kessel und Verdichter und uͤbrigem
Zugehoͤre, hinten angebracht. Die Cylinder koͤnnen in der Figur nicht
dargestellt werden, weil sie in einer Kiste zwischen den Hinterraͤdern
liegen.
Der Kasten des Wagens kann von beliebiger Form seyn, je nachdem er zur
Foͤrderung von Waaren oder von Reisenden bestimmt ist, und von Federn
gestuͤzt werden, die auf der Langwied ruhen. Der Wagen kann umkehren oder in
Bogen fahren, wenn man, auf gewoͤhnliche Weise, die Richtung der
Vorderraͤder aͤndert. Die kurzen Achsen dieser Raͤder werden
von einem senkrechten Gestelle oder Joche, a, getragen,
welches sich horizontal um die Spindeln dreht, die durch dasselbe und durch den
daruͤber liegenden Querbalken laufen. Die Lage dieser Vorderraͤder
wird mittelst der Griffe und der Spindel, b,
geaͤndert, welche von der vorne sizenden Person, die den Gang der Kutsche
leitet, gedreht werden.
Wenn der Griff und die Spindel b entweder rechts oder
links gedreht wird, so bringt ein unten an derselben angebrachter Triebstok, der in
ein großes Kerbrad c, welches innerlich gezaͤhnt
ist, eingreift, eine Drehung hervor, und hebt die Hebel, dd, welche an diesem Schafte angebracht sind. Diese Hebel stehen mit
Armen, ee, in Verbindung, welche von dem Gestelle nahe
an den aͤußeren Zapfen eines jeden Vorderrades, auslaufen, und durch die
Wirkung der Spindel und der Hebel, d, werden die
Raͤder horizontal auf jenen Theilen ihrer Peripherie umgedreht, welche mit
dem Boden in Beruͤhrung stehen. Auf diese Weise kommen die
Vorderraͤder in schiefe Richtung in Hinsicht auf die Hinterraͤder, und
der Wagen wird, in seiner Bewegung, eine Krumme beschreiben, und um jede Eke in
einer Gasse sich wenden koͤnnen.
Das Gestell, welches die Vorderraͤder fuͤhrt, ist nicht mit der
Langwied, sondern mit einer kurzen, sich drehenden, Stange f, verbunden. Diese Stange wird an jedem Ende von einem eisernen Reifen
umfaßt, wovon der eine an der Langwied der andere an dem Gestelle befestigt ist: dadurch werden
die Vorderraͤder in den Stand gesezt, uͤber jede Unebenheit weg zu
rollen: der Wagen schwingt sich auf dieser Stange, und erhaͤlt seine
aufrechte Lage. Auch die Dampfmaschine sammt Zugehoͤr ist dadurch von aller
Theilnahme an der schaukelnden und schlagenden Bewegung des Wagens geschuͤzt,
da sie sich auf einer schwingenden Unterlage befindet, welche in Schlingen von dem
eisernen Gestelle g, herabhaͤngt. Die vier
Ketten, welche diese Unterlage tragen, werden mittelst Spiral-Federn, h, elastisch gemacht. Die Hinterraͤder werden mit
der Langwied durch gabelfoͤrmige Schaͤfte, i, verbunden, an deren unterer Seite Buͤgel angebracht sind, welche
die Zapfen oder kurzen Achsen dieser Raͤder tragen.
Der Herd, k, kann aus Eisen und mit Feuerziegeln
ausgefuͤttert seyn, und wird aus der Kiste, l,
mit dem noͤthigen Feuer-Material, nach Bedarf, von dem Hintermanne
versehen, welcher mit dem Handgriffe m, die
Speisethuͤre und das Register zur Regulirung des Zuges in dem Ofen
oͤffnet. Unten ist die Aschengrube und das Reinigungsloch. Der Kessel besteht
aus mehreren Reihen metallner Roͤhren, nn, die
sich umbiegen und wieder quer in den Ofen zurruͤkkehren: in diesen
Roͤhren wird der Dampf erzeugt. O, ist der
Wasserbehaͤlter: das Wasser fließt durch ein Nußgelenk in die Roͤhre
p, und aus dieser in den Kessel. Eine Sprizpumpe,
q, treibt das Wasser in die untere Roͤhre,
r, und fließt von da in die untere Lage der
Roͤhren, nn, aus welchen der, durch Einwirkung
des Feuers, auf ihre aͤußere Oberflaͤche erzeugte, Dampf in die oberen
Reihen von Roͤhren aufsteigt, in seinem Verlaufe noch mehr erhizt wird,
wodurch seine Elasticitaͤt noch mehr zunimmt, und sich endlich durch die
oberste Roͤhre, s, in die Cylinder der Maschine
entleert.
Die Verdichter bestehen aus einer Menge flacher Roͤhren, die gedoppelt sind,
und in der Kiste, t, auf und niedersteigen. Da ihre
aͤußeren Oberflaͤchen der Einwirkung der Atmosphaͤre ausgesezt
sind, so wird der Dampf darin verdichtet, worauf das Wasser in den Behaͤlter
o ablaͤuft. Auf diese Weise verwandelt das
Feuer in dem Ofen k das in den Roͤhren, nn, enthaltene Wasser in Dampf, welcher, nachdem er alle
Reihen von Roͤhren durchgezogen ist, durch eine gekruͤmmte Roͤhre etwas in
den Schonstein, v, hinaufsteigt, und von da in die
Einleitungs-Oeffnung gelangt. Sobald der Dampf in den Cylinder gelangt, wirkt
er durch seine Ausdehnungskraft, und treibt die Staͤmpel abwechselungsweise;
tritt, wie gewoͤhnlich, aus den Cylindern durch die Abzugsklappe in die
Verdichtungsroͤhren etc. so daß die Maschine ganz auf die gewoͤhnliche
Weise in Thaͤtigkeit gesezt und in derselben erhalten wird.
Die Kraft wird den Hinterraͤdern durch Kehrstangen, u, mitgetheilt, welche mit den Staͤmpelstangen verbunden sind. An
dem unteren Theile einer jeden Kehrstange sind Triebstoͤke mit Sperkegeln,
welche in die Zahnraͤder, w, eingreifen. Diese
Zahnraͤder sind an den gewoͤhnlichen Raͤdern der Kutsche
befestigt, und treiben diese Raͤder um, sobald sie von den
Triebftoͤken getrieben werden, und die Raͤder schieben den Wagen in
Folge ihrer Reibung auf dem Boden waͤhrend ihrer Umdrehung
vorwaͤrts.
Den mit dem unteren Theile einer jeden Kehrstange und den Triebstoͤken
verbundenen Mechanismus kennt der Patent-Traͤger einen Artzberger, nach seinem Erfinder, Hrn. Joh. Artzberger,
Professor zu Wien. Er besteht aus einer Gabel und einer Achse, und bildet eine Art
allgemeinen Gelenkes, wodurch die Verbindung zwischen den Triebstoͤken und
den Zahnraͤdern erleichtert und der Umtrieb, ungeachtet alles Schwingens und
Stoßens des Wagens, unterhalten wird. Der Sperkegel wird durch eine Feder in dem
Arzberger gehalten, wodurch er in die Zaͤhne der Roͤhre eingreift. Da
aber die Raͤder zuweilen schneller laufen koͤnnen, als die
Triebstoͤke, so ist eine Vorsorge durch diesen Sperrkegel getroffen, der den
Raͤdern das Vorlaufen und das Ausbleiben gestattet. Der Sperkegel kann auch
so gewechselt werden, daß er den Wagen vor- und ruͤkwaͤrts
treibt. Dieser Theil der Maschine ist jedoch nicht deutlich erklaͤrt, bewerkt
das London Journal, und unser Leser wird finden, daß das London Journal Recht
hat.
Tafeln