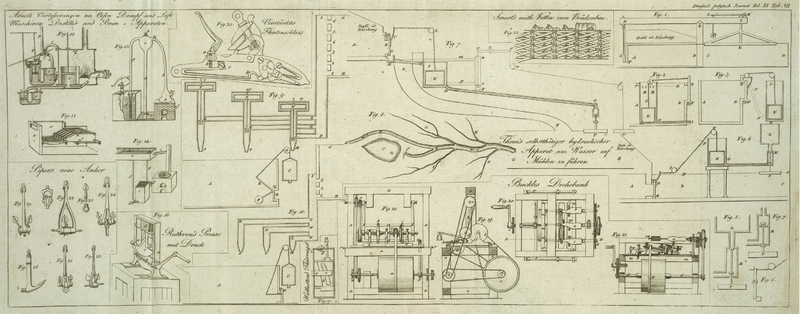| Titel: | M. Drs. Neil Arnott, in Bedford Square, Middlesex, Verbesserungen bei Erzeugung und Anwendung der Hize an Oefen, Dampf- und Luft-Maschinen, und Destillir-Abrauchungs- und Brau-Apparaten, worauf sich derselbe am 14. Nov. 1821 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 11, Jahrgang 1823, Nr. XLIII., S. 281 |
| Download: | XML |
XLIII.
M. Drs. Neil Arnott, in Bedford Square, Middlesex, Verbesserungen bei Erzeugung und Anwendung der Hize an Oefen, Dampf- und Luft-Maschinen, und Destillir-Abrauchungs-
und Brau-Apparaten, worauf sich derselbe am
14. Nov. 1821 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Mai 1822. S.
225.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Arnott's Verbesserungen bei Erzeugung der Hize an
Oefen.
Diese Verbesserungen zerfallen in vier Abtheilungen: 1tens, in
gewisse Methoden, den Rauch zu verbrennen, und dadurch die Staͤrke des
Feuers, welches denselben erzeugte, zu vermehren; 2tens, in eine Methode, das Feuer
in verdichteter Luft brennen zu lassen, theils um eine groͤßere Hize zu
erzeugen, theils bloß um die Luft zu erhizen, und dadurch die Elasticitaͤt
derselben zu vermehren, wodurch sie zur Kraft wird, die man zum Treiben der
Maschinen anwenden kann; 3tens, in Verfahrungsarten, Fluͤssigkeiten schneller
zu kochen, abzudampfen und zu destilliren, und zwar bei einer viel geringeren Hize
als ihr Siedepunct, indem man den Druk der atmosphaͤrischen Luft auf
dieselben vermindert oder gaͤnzlich aufhebt; und 4tens, in gewisse
Verfahrungs-Arten, die Fluͤssigkeiten beim Brauen
abzukuͤhlen.
Die Verbrennung des Rauches geschieht mittelst einer besonders dazu geeigneten
Vorrichtung, welche man nach Belieben an jedem Ofen anbringen und wieder aus
demselben wegnehmen kann. Fig. 11 in Tab. VII. stellt sie im Perspektive dar. aa, ist die den Ofen umgebende Ziegelmauer. b, sind die Eisenstangen des Rostes. c, ist ein eisernes Gehaͤuse, das in eine Menge
Rinnen abgetheilt ist, deren Enden jenem Theile des Ofens nahe gebracht werden, wo
das Feuer brennt. Die Kohlen werden, nachdem sie gestossen oder zerkleint wurden, in
den oberen Theil des Gehaͤuses, d, gebracht, und
gleiten dann auf der schiefen Flaͤche zwischen den Rinnen in den Ofen, in welchen sie
gelegentlich mittelst einer gabelfoͤrmigen Heizstange vorgeschoben werden.
Die Rinnen oder Canaͤle e,e,e, dienen zur EinfuͤhrugEinfuͤhrung der Luft in das Innere des Ofens. wodurch ein großer Luftzug erhalten und
das Feuer mit ausserordentlicher Staͤrke in Flammen gesezt wird. Die auf
diese Weise in den Ofen geleitete frische Luft verbindet sich mit dem Rauche, treibt
diesen in die Flamme zuruͤk, und erzeugt hiedurch vollkommene Verbrennung
desselben, wodurch nicht nur die Hize des Ofens vermehrt, sondern auch bedeutende
Ersparung an Brenn-Material erzielt wird.
Die zweite Vorrichtung besteht darin, das Feuer in dem Ofen in einer verdichteten
Atmosphaͤre brennen zu lassen, wodurch wieder mehr Hize erzeugt, und die
verduͤnnte und mehr ausgedehnte Luft als Triebkraft einer Luftmaschine oder
zu irgend einem anderen Zweke verwendet werden kann. In dieser Hinsicht ist der
Rost, wie oben Fig.
11., vorgerichtet; statt daß er aber, wie daselbst, offen ist, ist er in
einem großen luftdichten Gehaͤuse von Gußeisen, wie Fig. 12 zeigt, wo a der Feuer, Herd, b der
Speiser ist, welcher, so wie das Feuer angezuͤndet ist, mit einem luftdichten
Thuͤrchen geschlossen wird. Um nun Luft in den Ofen zu bringen, wird ein
Geblaͤse-Cylinder, c, angebracht, in
welchem ein Staͤmpel entweder mit der Hand oder durch Verbindung mit irgend
einer im Gange befindlichen Maschine in Bewegung gesezt wird. Dieser Cylinder steht
mit einem anderen Cylinder, d, in Verbindung, und beide
sind unten mit Wasser oder mit irgend einer anderen Fluͤssigkeit
angefuͤllt, e, e, sind Luftklappen, welche sich
einwaͤrts gegen die Cylinder c und d, oͤffnen. ff, sind
Entladungs-Klappen, welche sich auswaͤrts in die Windroͤhre,
g, oͤffnen. Wenn der Staͤmpel in dem
Cylinder, c, niedersteigt, so steigt das Wasser in d, wodurch Luft in den vorigen gelangt, und von dem
lezteren ausgeflossen wird. So wie dieß abwechselnd in den Cylinder c und d, Statt hat, kommt
immer neue Luft in die Wind-Roͤhre, g, und
aus dieser in den Regulator, k, welcher aus einem bloßen Cylinder mit einem
luftdichten Staͤmpel besteht, der durch den Druk der Luft aufsteigt, und
durch seine eigene Schwere niedersinkt. Durch diese Vorrichtung wird ein steter
ununterbrochener Luftzug laͤngs durch die Roͤhre, g, in das Feuer geleitet, durch welches die dahin geleitete Luft
erhizt und oben an der Deke in einem elastischen Zustande angehaͤuft wird.
Von dort nun fuͤhrt die Roͤhre, i, diese
Luft zum Treiben der Luftmaschine ab.
Diese Luftmaschine besteht aus zwei Cylindern, j und k, welche unten mit einander in Verbindung stehen: beide
sind, wie die Geblaͤse-Cylinder, unten mit Wasser gefuͤllt, und
haben auf der Oberflaͤche des Wassers Schwimmer. Die erhizte Luft (von 5 bis
600 Fahrenh. (208 bis 252 Reaum)) tritt von der Deke des Ofens her durch die
Roͤhre, i, zur Dreheklappe, I, welche so wie andere Drehe-Klappen
vorgerichtet ist, daß sie naͤmlich abwechselnd eine Seite schließt und die
andere oͤffnet, und entweder mittelst einer Kurbel, einer Welle oder eines
Flugrades in Bewegung gesezt werden kann. Die erhizte Luft geht ferner durch die
Drehe-Klappe in die Einleitungs-Roͤhre, m, und von da in den Cylinder, j, wo sie ihre
Expansiv Kraft auf das daselbst enthaltene Wasser ausuͤbt, und einen Theil
desselben in den Cylinder, k, treibt; und da der
Staͤmpel, n, wasserdicht in dem Cylinder, j, auf und niedersteigt, so druͤkt das Wasser,
wenn es in j sinkt, den Staͤmpel nieder. Wenn nun
die Drehe-Klappe der erhizten Luft den Zutritt in den Cylinder, j, versperrt, so oͤffnet sie ihn derselben durch
die Roͤhre, i, in die Roͤhre, o, und in den Cylinder, k,
und die Luft wird aus j durch die
Entweichungs-Roͤhre, p, ausgelassen. Auf
diese Weise wird aber auch das Wasser aus k
ausgetrieben, und muß in j steigen, und den
Staͤmpel, n, mit sich in die Hoͤhe
treiben. Auf diese Welse entsteht eine abwechselnde Bewegung an dem Staͤmpel,
die, wenn dieser mit einer Stange, q, verbunden wird,
auf die bei Dampfmaschinen gewoͤhnliche Weise mit einer Welle in Verbindung
gesezt werden und sodann eine andere Maschine oder die Dreheklappe oder obigen
Pump-Apparat treiben kann.
Die Schwimmer auf dem Wasser in den Cylindern j und k, sind darum noͤthig, damit das Wasser durch die
darauf wirtende heiße Luft nicht verduͤnstet; Brettchen sind bekanntlich
schlechte Waͤrmeleiter. Da aber dessen ungeachtet das Wasser heiß wird, und
allmaͤhlich abnimmt, hat man eine Vorrichtung angebracht, um diesen Abgang zu
ersezen: rr, sind naͤmlich zwei Zuleitungs-Roͤhren, welche Wasser aus einem Behaͤlter
zufuͤhren, und s s sind zwei kleine mit den
Klappen verbundene Hebel. Wenn das Wasser nun so sehr abgenommen hat, daß
Auffuͤllung noͤthig ist, so werden die Schwimmer an der
Oberflaͤche niedersinken, dadurch an diesen Hebeln anschlagen, und den
noͤthigen Zufluß von Wasser veranlassen. Um die Entstehung eines Vacuums in
dem Cylinder oder in den Zuleitungs-Roͤhren zu verhuͤten, sind
zwei kleine Klappen angebracht, die sich nach Einwaͤrts oͤffnen, durch
leichte Federn festgehalten werden, und so gleichsam von selbst wirken, so oft es
noͤthig ist.
Da die Temperatur, bis zu welcher die Luft hier erhizt ist, dieselbe einen viel
groͤßeren Raum, als im natuͤrlichen Zustande, einzunehmen zwingt, so
darf nur die Haͤlfte derselben, die zur Fuͤllung der
Trieb-Cylinder noͤthig ist, in den Ofen und den Behaͤlter der
heissen Luft eingepumpt werden: die Geschwindigkeit des gesammten Zuges der heißen
Luft wird durch eine sogenannte Drossel Klappe, m, in
der Roͤhre regulirt, und mittelst eines gewoͤhnlichen Regulators
gestellt. Um diese Maschine mit Vortheil zu gebrauchen, muß eine Vorrichtung
angebracht seyn, mittelst welcher man durch ein Glas den Zustand des Feuers
beobachten kann, und die Gabel zum Schuͤren des Feuers muß, noͤthigen
Falles, durch ein luftdichtes Nußgelenk geruͤhrt werden.
Die dritte Vorrichtung ist zur Erzeugung eines leeren Raumes auf der
Oberflaͤche der lockenden Fluͤssigkeiten bestimmt, damit sie auch bei
niedrigeren Temperaturen verduͤnsten. Hiezu bedient man sich eines Apparates,
wie ungefaͤhr in Fig. 13, wo a, der Kessel ist, der die Fluͤssigkeit
enthaͤlt, auf welche gewirkt werden soll, und der oben mittelst einer
Roͤhre, b, mit einem Verdichter, c, verbunden ist: alle diese Theile muͤssen stark
genug seyn, um einem Druke von mehr als 15 ℔ auf jeden Quadratzoll ihrer
Flaͤche ertragen zu koͤnnen. Der Verdichter muß hoͤher als 32
Fuß uͤber dem Grunde oder uͤber der Wasserflaͤche eines Brunnen stehen, um eine Metall-Roͤhre, d, aufzunehmen, die von der unteren Seite desselben bis
zu dieser Tiefe hinabsteigt, e, ist eine Cisterne, oder
ein Wasserbehaͤlter, zu dessen Wasser das untere Ende der Roͤhre, d, eintaucht. Noch eine andere Cisterne, f, ist ungefaͤhr 16 Fuß unter der unteren Seite des Verdichters
angebracht, und aus dieser steigt eine Roͤhre, g,
zu dem Verdichter hinauf. Oben auf dem Verdichter, bei h, ist eine nach Aufwaͤrts sich oͤffnende Klappe angebracht, und
eine aͤhnliche ist in der Roͤhre, g, bei
i. An dem Wasserbehaͤlter, f, ist eine Drukpumpe, k,
durch welche Wasser in die Roͤhre. g,
uͤber der Klappe eingepumpt wird.
Man bedient sich dieses Apparates auf folgende Weise: Nachdem der Kessel, a, mit der Fluͤssigkeit und den in derselben
abzulockenden Materialien gefuͤllt ist, muß der Sperrhahn oben an der
Roͤhre, b, und auch jener unten an der
Roͤhre, d, geschlossen werden. Hierauf wird der
Verdichter, c, aus dem Behaͤlter f, mit Wasser gefuͤllt, worauf der Hahn unten an
der Roͤhre, d, geoͤffnet, und das Wasser
aus dem Verdichter auslaufen und bis zur Hoͤhe von 32 Fuß niedersinken wird,
so daß der Verdichter beinahe luftleer seyn muß. Wenn nun unter dem Kessel Feuer
gemacht, und der Hahn der Roͤhre, d,
geoͤffnet wird, so entsteht eine Verbindung zwischen dem Kessel und dem
Verdichter, und alle Luft in dem Kessel wird in den Verdichter uͤbergehen.
Wenn man nun zum zweitenmal den Verdichter mit Wasser fuͤllt, und das Wasser
wie zuvor aus demselben auslaufen laͤßt, so entsteht ein leerer Raum in
demselben, und da die beiden Roͤhren, g und d, in Verbindung sind, so wirken sie als Heber, das
kalte Wasser steigt durch die Roͤhre, g, in den
Verdichter, und laͤuft durch die Roͤhre, d, ab, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die durch den Sperrhahn unten nach
Belieben regulirt werden kann.
Je nachdem nun die Luft in dem Kessel und in dem Versdichter mehr oder minder
ausgezogen wurde, wird die Fluͤssigkeit in dem Kessel bei einem geringeren
oder hoͤheren Waͤrmegrad sieden, immer aber bei einer niedrigeren
Temperatur, als jene ist, unter welcher diese Fluͤssigkeit in freier Luft
sieden wuͤrde. Sollte auf irgend eine Weise neuerdings Luft in den Verdichter
gelangen, so muͤßte das Vacuum auf die vorige Weise in demselben erzeugt
werden, und durch gelegentliche Wiederholung dieser Operation kann dasselbe
fuͤr unbestimmte Zeit uͤber der Oberflaͤche der
Fluͤssigkeit in dem Kessel unterhalten werden. An dem unteren Theile des
Kessels befindet sich ein Hahn, t, zur Ausleerung der in
demselben enthaltenen Fluͤssigkeit, nachdem das Feuer hinlaͤnglich auf dieselbe
eingewirkt hat, und zur Verhuͤtung aller Gefahr ist bei m eine Sicherheits-Klappe angebracht. Die Klappe,
h, oben an dem Verdichter oͤffnet sich nach
Aufwaͤrts, und laͤßt die Luft aus demselben entweichen, wenn das
Wasser zum erstenmal in denselben eingeleitet wird; sie dient auch zugleich als
Sicherheits-Klappe, wenn sich auf einmal zuviel Dampf entwikeln sollte.
Die vierte Abtheilung dieser Verbesserungen endlich besteht in einem
Kuͤhl-Apparate, um Fluͤssigkeiten waͤhrend des Brauens
abzukuͤhlen, a, in Fig. 14, ist der Kessel,
von dessen unterem Ende eine Roͤhre, b, in den
Kuͤhler, c, laͤuft. Dieser Kuͤhler
besteht aus einem Gehaͤuse, welches eine Menge laͤnglicher und sehr
seichter Beten aus verzinntem Kupferbleche enthaͤlt: je duͤnner das
Metall, aus welchem diese Beken verfertigt sind, desto besser; nur muß es stark
genug seyn, um sich nicht an den Seiten einzubiegen. Diese Beken werden mit ihren
Seiten neben einander gestellt, und oben mittelst Roͤhren, welche aus der
heissen Roͤhre auslaufen, und an ihrem Boden durch eine
Ablaß-Roͤhre, d, verbunden. Das
aͤußere Gehaͤuse ist wasserdicht, und so eingerichtet, daß, wenn es
mit Wasser gefuͤllt ist, dieses alle Beken umgibt. Wenn man nun den Hahn an
der Roͤhre, b, umdreht, fließt die heiße
Fluͤssigkeit aus dem Kessel unmittelbar um die
Abkuͤhlungs-Beken, die mit kaltem Wasser umgeben sind, wird in
denselben eine niedrigere Temperatur annehmen, und abgekuͤhlt durch die
Roͤhre, d, ablaufen. Die
Zufuͤhrungsroͤhre, b, muß, wie die
Ableitungs-Roͤhre, d, mit einem Hahne
versehen seyn, um die Menge der Fluͤssigkeit zu bestimmen, welche
waͤhrend einer gegebenen Zeit durch den Kuͤhler durchlaufen soll.
Ueber dem Kuͤhler ist bei e, ein offener
Behaͤlter angebracht, aus welchem eine Roͤhre, f, herabsteigt, und kaltes Wasser in den Kuͤhler leitet. Eine
andere Roͤhre, g, steigt aus dem Kuͤhler
in den Behaͤlter, g, und, da das Wasser in dem
Kuͤhler etwas Waͤrme von der heißen Fluͤssigkeit annimmt, die
durch denselben geht, wird die specifische Schwere desselben vermindert, und dieses
erhizte Wasser steige durch die Roͤhre, g, in den
Behaͤlter hinauf, waͤhrend das kalte, specifisch schwerere, durch die
Roͤhre, f, herabfaͤllt, und auf diese
Weise wird ein steter
Zufluß von kaltem Wasser in dem Kuͤhler unterhalten, so lang heiße
Fluͤssigkeit durch die Beten des lezteren fließt.
Wenn die Umstaͤnde es nicht erlauben, einen Behaͤlter mit kaltem Wasser
uͤber dem Kuͤhler anzubringen, so muß das Wasser mittelst einer Pumpe
aufgezogen werden. In Faͤllen, wo ein groͤßerer Behaͤlter
unausfuͤhrbar waͤre, schlaͤgt man Reihen flacher Roͤhren
vor, die, wie h, gerade unter der Oberflaͤche des
Wassers hinlaufen, und sich mit einem offenen Ende aufwaͤrts gegen die Luft
empor kehren, mit dem anderen Ende aber mit der Roͤhre, i, verbinden, die in den Schornstein laͤuft. Auf
diese Weise erzeugt die Hize des aufsteigenden Wassers vereint mit dem Zuge des
Schornsteines ein Durchstroͤmen von kalter Luft durch diese flache
Roͤhren, wodurch das Wasser maͤchtig abgekuͤhlt werden
wird.
Um die Daͤmpfe einer Destillir-Blase zu verdichten, kann dieser
Kuͤhler, und der andere zulezt beschriebene Apparat, angewendet werden, und
in diesem Falle wird der Dampf durch die Roͤhre, b, eingelassen: da aber der Destillations-Proceß im Vacuum
fortgesezt werden soll, so muß die Entladungs-Roͤhre, d,
ungefaͤhr 35 Fuß tief senkrecht herabsteigen. Um dieses Vacuum zum erstenmal
zu erzeugen, muͤssen die flachen Roͤhren mit Wasser ausgefuͤllt
werden, welches man entweder ablaufen laͤßt, oder mittelst einer Pumpe oder
Saugsprize aufzieht, die man an einem schillschen Orte anbringt.
Der Patent -Traͤger sagt, er habe keine
Groͤßen-Verhaͤltnisse angegeben, weil diese nach
Umstaͤnden sich aͤndern muͤssen; und eben so unbesorgt war er
aus eben diesem Grunde auch um die FormDer Uebersezer zweifelt, ob diese Vorrichtungen irgend wo in wirklichem
Umtriebe stehen, und Ruzen gewaͤhren; indessen verdienen doch die
Ideen des Hrn. Doctor Beherzigung, so wie uͤberhaupt in der Mechanik
keine Idee, und schiene sie auch urspruͤnglich noch so ungereimt,
unbeachtet bleiben darf. Man kann nicht voraus wissen, wozu irgend etwas
fuͤhren kann, und nur zu oft gelangt man erst durch die weitesten
Umwege zum erwuͤnschten Ziele. A. d. Ueb. .
Tafeln