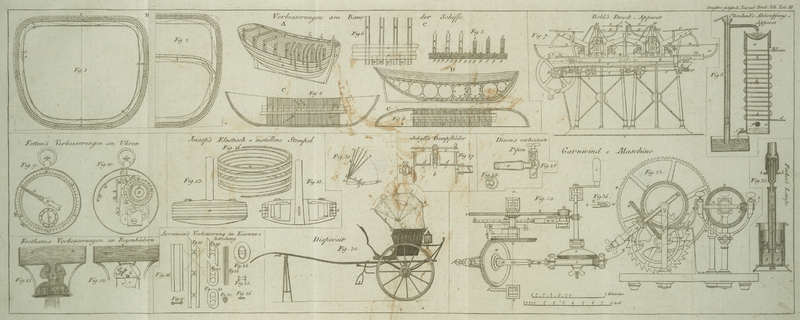| Titel: | Verbesserungen an Regenbädern, worauf Wilh. Feetham, Eisenrost-Macher und Eisenmeubel-Händler am Ludgate Hill in der City of London sich dd. 13. Juni 1822 ein Patent geben ließ. |
| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. VII., S. 39 |
| Download: | XML |
VII.
Verbesserungen an Regenbädern, worauf Wilh. Feetham,
Eisenrost-Macher und Eisenmeubel-Händler am Ludgate Hill in der City of
London sich dd. 13. Juni 1822 ein Patent geben ließ.
Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Junius
1823. S. 284.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Feetham's Verbesserungen an Regenbädern.
Durch diese Verbesserung soll der Kranke, der eines Regenbades
bedarf, den Zufluß des Wassers reguliren, und dadurch den Regen nach
Umstaͤnden und Belieben sanfter machen koͤnnen. Dieser Zwek wird durch
zwei Vorrichtungen erreicht: 1tens durch einen stellbaren Hemmer, der so
vorgerichtet werden kann, daß er den Hahn hindert sich uͤber eine gewisse
Entfernung aufzudrehen, damit man also die Oeffnung des Wasserweges auf jede
erfoderliche Entladung beschraͤnken kann; 2tens durch eine Abtheilung der
durchloͤcherten Buͤchse oder des Siebes in mehrere Kammern mittelst
zweier oder mehrerer kreisfoͤrmigen concentrischen Abtheilungen, wodurch
bestimmte Quantitaͤten Wassers die aus der oben angebrachten Cisterne
ausgelassen werden, nothwendig auf bestimmte Theile der Oberflaͤche des
Siebes beschrankt werden.
Fig. 11. ist
ein Durchschnitt des Apparates. aa ist die, auf
gewoͤhnliche Weise uͤber dem Siebe aufgehaͤngte, Wassers
Cisterne, unter welchem der Patient sieht, um den Regen auf sich fallen zu lassen,
b, ist der Hahn zum Ablassen des Wassers. c, der Rost oder das Sieb, wodurch das Wasser in Form
eines Regens faͤllt.
Fig. 12. zeigt
die Vorrichtung, wodurch die Oeffnung des Durchzuges des Wassers regulirt wird, d, ist eine Platte, und der Hahn, der in der vorigen
Figur dargestellt ist, abgenommen, e, ist ein an dem
Zapfen des Hahnes B, angebrachter Hebel mit zwei Ohren,
an welchen die Strike angebracht sind, um die Oeffnung, durch welche das Wasser
abstießt, zu erweitern oder zu schließen.
Bei f sind zwei kleine in der Platte d befestigte Zapfen, und ein Stellstift g, der frei von einem Buͤgel herabhaͤngt;
dieser Stift muß an den ersten oder zweiten Zapfen angelegt werden, je nachdem man
viel oder wenig Wasser zufließen lassen will. Ein kleiner Knopf h vorwaͤrts von dem Hebel e, und in der gekruͤmmten Oeffnung wirkend, schlaͤgt gegen
den Stift g, und beschraͤnkt dadurch die Wirkung
des Hahnes und folglich auch den Durchgang des Wassers. Wenn jedoch der volle Strom
aus der Cisterne noͤthig waͤre, dann muß der Stift g entfernt, und dann kann der Hahn in seinem ganzen
Umfange gedreht, und das Wasser durch den freien Durchgang entladen werden.
Das Wasser, das in der Roͤhre niedersteigt, faͤllt in das
kegelfoͤrmige Sieb i, aus welchem es durch die
Loͤcher auf den Rost kk fließt, und
daselbst in Form eines Regens durchfaͤllt. Wenn bedeutend viel Wasser aus dem
Hahne zufließt, so fließt es uͤber die Scheidewand in die naͤchste
Kammer 11, und bedekt hierdurch eine noch groͤßere Flache des Rostes, und
wenn noch wehr Masser zustroͤmt, so laͤuft dieses auch uͤber
die aͤußere Scheidewand, und bringt hierdurch den Regen zur hoͤchsten
Staͤrke, die ein solches Bad nur immer gewaͤhren kann.
Ein Stuͤk Holz, welches rinnenfoͤrmig ausgehoͤhlt ist, wird in
geneigter Lage an dem Boden der Thuͤre des Cabinettes angebracht, um das
Wasser, welches an diese anschlagt, in das Auffang-Gefaͤß am Boden zu leiten,
und auf diese Weise zu hindern, daß der Boden des Zimmers nicht naß wird, wenn man
die Thuͤre des Bades oͤffnet. Am Boden befindet sich noch ein
kegelfoͤrmiger Zapfen, durch welchen das Wasser in irgend ein schikliches
Auffangs-Gefaͤß abfließen kann.
Der Patenttraͤger nimmt bloß die Regulirung der aus dem Hahne ausfließenden
Wassermenge, und die Methode den Regen nach Belieben von einem Mittelpunkte aus zu
erweitern, oder zusammenzuziehen, als sein Patentrecht in Anspruch.
Tafeln