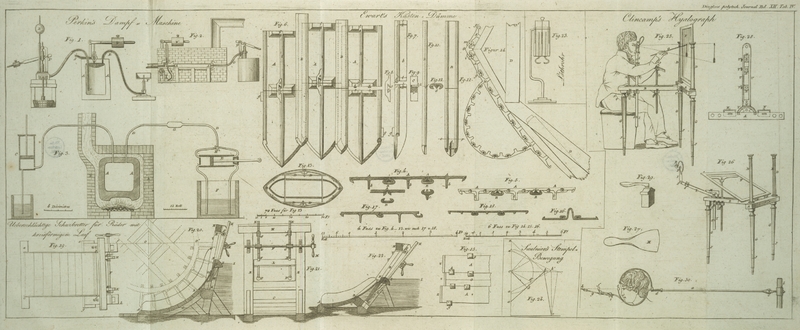| Titel: | Beschreibung des Hyalographen des Hrn. Clinchamp, eines Instrumentes zur Perspectiv-Zeichnung. |
| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. XXXV., S. 157 |
| Download: | XML |
XXXV.
Beschreibung des Hyalographen des Hrn. Clinchamp, eines Instrumentes
zur Perspectiv-Zeichnung.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement N. 227. S. 126.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Clinchamp's Beschreibung des Hyalographen.
Hr. Clinchamp hat ein Instrument
zur Perspectiv-Zeichnung erfunden, wodurch er zugleich einen oder mehrere
Abdruͤke seiner Zeichnung erhaͤlt. Er hat der Zeichnung eine neue
Abhandlung beigefuͤgt, aus welcher wir hier einen Auszug liefern, (Vergl.
Bulletin 1822. S. 154), und zeither mehrere Verbesserungen an dem Instrumente selbst
angebracht, um dasselbe fester und tragbarer zu machen, die wichtiger sind, als die
vorgeschlagenen Erleichterungen zu den vielen Anwendungen, deren der Hyalograph
faͤhig ist.
Auf den Linealen, die das Ocular tragen, sind Abtheilungen angebracht, die man dem
Spiegelglase nach Belieben naͤhern, oder davon entfernen kann. Diese
Abtheilungen dienen, nach Umstaͤnden, zur Bestimmung des
Verhaͤltnisses zwischen der wirklichen Groͤße des Gegenstandes, den
man zeichnen will, und seiner scheinbaren auf dem Spiegelglase. Sie dienen auch zur
Bemessung der Entfernung eines Gegenstandes, dessen Hoͤhe man kennt, oder
umgekehrt, der Hoͤhe aus der Entfernung. Einige dieser Abtheilungen dienen
auch zur Bestimmung des Sehe-Winkels auf dem Felde des Spiegelglases nach der Entfernung des Oculares.
Hr. Clinchamp sezt die Graͤnze der Weite des
Sehewinkels, innerhalb welcher man eine correcte Zeichnung verfertigen kann, auf
90°, und hierin stimmt er mit den Schriftstellern, die uͤber
Perspectiv geschrieben haben, uͤberein, obschon dieß nichts mehr als ein
Irrthum ist. Es ist offenbar, daß die Weite dieses Winkels viel zu groß ist, und daß
ein Gemaͤhlde, das unter dieser Bedingung gemahlt werden wuͤrde, in
allen von seinem Mittelpuncte entfernten Theilen auffallende Unrichtigkeiten
darstellen muͤßte.
Im Perspektive betrachtet man ein Gemaͤhlde gleichsam im Quer-Durchschnitte
senkrecht auf die Achse des kegelfoͤrmigen Strahlenbuͤndels, der von
allen Puncten der in diesem Gemaͤhlde begriffenen Gegenstaͤnde
ausgeht, und sich in dem Auge des Beobachters vereint.
Je mehr der Durchschnitt der Strahlen dieses Sehekegels schief wird, desto mehr wird
das durch diesen Durchschnitt gebildete Bild, wo man dasselbe von einem anderen
Puncte, als von der Spize des Sehekegels aus, beschaut, verzerrt; denn nur in diesem
Puncte ist, die Schiefe des Durchschnittes mag was immer fuͤr eine seyn, die
Wirkung auf den Beobachter immer dieselbe.
Ein Gemaͤhlde ist aber nicht dazu auf der Welt, daß man es nur von einem
Puncte allein sehen darf; es muß, von jedem Puncte aus gesehen, wo der Beobachter
dasselbe mit Bequemlichkeit betrachten will, seine Wirkung hervorbringen.
Es ist allerdings wahr, daß in einem streng gehaltenen Perspective nur dasjenige sehr
richtig gezeichnet ist, was sich dem Mittelpuncte des Gemaͤhldes
naͤhert, und daß die Gegenstaͤnde desto mehr entstellt sind, je mehr
sie sich davon entfernen, weil der Durchschnitt der Lichtstrahlen mehr schief
ausfaͤllt; so lang aber eine Entstellung nicht merklich ist, faͤllt
sie dem Beobachter nicht auf. Man kann also das Sehefeld, so wie den Sehewinkel, bis
auf denjenigen Punct erweitern, wo die Verzerrung bemerkbar wird.
Man muß ferner nicht vergessen, daß jene Verzerrung, die von einem Durchschnitte zu
schiefer Lichtstrahlen entsteht, nicht an allen Gegenstaͤnden gleich bemerkbar ist. An
einem Wuͤrfel kann sie, z.B., Statt haben, ohne das Auge zu sehr zu
beleidigen; eine Kugel aber wuͤrde, auf denselben Punct hingestellt, auf eine
empoͤrende Weise verzerrt werden.
Nach diesen Bemerkungen kann man die Theorie des Herausnehmens (théorie des licences) rechtfertigen, welche darin
besteht, der Wahrheit des Perspectives, insofern das Auge des Beobachters es unter
irgend einem Gesichtspunkte fodert, untreu zu werden.
Man hat verschiedene Regeln uͤber das Verhaͤltniß des Sehewinkels, den
man bei einem Gemaͤhlde zu beobachten hat, gegeben. Die Einen rathen dem
Beobachter eine Entfernung, die dreimal die Breite des Gemaͤhldes
betraͤgt, was einen Winkel von 20 Graden geben wuͤrde. Andere
fuͤhren Gemaͤhlde auf, die unter einem Winkel von 45 Graden gezeichnet
sind, und keine bemerkbaren Verzerrungen enthalten. Am beßten ist es, sich hier an
Erfahrung zu halten. Wenn man mit Hrn. Clinchamp's
Instrument regelmaͤßige Koͤrper zeichnet, so wird man bald die
Graͤnzen des Sehewinkels kennen lernen, die man bei gewissen Formen der
Gegenstaͤnde nicht uͤberschreiten darf.
Es ist immer nuͤzlich, und selbst oͤfters nothwendig, die Schatten der
Koͤrper, die man treu darstellen will, nach der Natur zu zeichnen. Hr. Clinchamp meint, daß es moͤglich waͤre, die
Schatten auf dem Spiegelglase selbst darstellen zu koͤnnen, wodurch der
Vortheil entstuͤnde, zwei oder drei Copien von einer und derselben Zeichnung
erhalten zu koͤnnen: denn man kann von der auf dem Spiegelglase gemachten
Zeichnung mehrere Abdruͤke veranstalten.
Wir zweifeln auch wirklich nicht, daß etwas Gemahltes sich eben so gut auf Papier
abdruken laͤßt, als etwas Gezeichnetes, und die Schwierigkeit liegt nicht in
der Uebertragung der Zeichnung. Es laͤßt sich leicht begreifen, daß man das
Spiegelglas in eine fuͤr den Zeichner bequeme Lage bringen, und dasselbe mit
weissem Papier unterlegen kann, um die Wirkung der Farben gehoͤrig
beurtheilen zu koͤnnen, so wie daß man an einem Spiegelglase die Schatten
sehen kann, die man nachbilden will, wo aber die Schattirung umgekehrt geschehen
muß: die große Schwierigkeit besteht nur in der materiellen Ausfuͤhrung des Lezteren.
Man kann die Farben auf ein Glas, nicht wie auf Papier, auftragen und vertreiben; man
muß sie mit einem einzigen Pinsel-Striche auftragen, und darf nicht mehr
uͤber dieselben hinfahren: die erste Lage muß vollkommen troken geworden
seyn, ehe man eine zweite auf dieselbe auftragen kann: man muß, mit einem Worte,
hier, wie bei der Miniatur-Mahlerei verfahren, wenn man einige Praͤcision in
die Nachahmung bringen will.
Diese Betrachtungen erweken in uns die Ueberzeugung, daß man das Mahlen auf Glas
aufgeben wird. Wenn man mehrere Copien eines Gemaͤhldes noͤthig hat,
so wird es bequemer seyn, und eben so schnell hergehen, wenn man nur die Zeichnung,
die Umrisse, abdrukt, und das Gemaͤhlde selbst auf dem Papiere
ausfuͤhrt. Die Versuche, die Hr. Clinchamp der
Gesellschaft eingesendet hat, bestaͤtigen uns in der Meinung, daß man, ohne
bedeutenden Zeit-Aufwand, durch sein Verfahren keine befriedigenden Copien erhalten
kann.
Wenn man aber auch den Gebrauch des Instrumentes des Hrn. Clinchamp bloß auf die Linien-Zeichnung beschraͤnken muͤßte,
so bleibt dasselbe noch immer von großem Nuzen. Dieses Instrument gewaͤhrt
den wichtigen Vortheil, daß man mittelst desselben die Genauigkeit der Zeichnung der
Umrisse, die man gemacht hat, pruͤfen, und die leichtesten Abweichungen, die
durch Unsicherheit der Hand entstanden sind, verbessern kann. Bringt man ferner noch
an demselben den langen Arm (long bras) an, der an dem
Physionotrace des Hrn. Chretien zur beliebigen Entfernung der Spize des Sehekegels dient, so wird
man in einem groͤßeren Verhaͤltnisse ganz fehlerfreie Zeichnungen
erhalten, weil sie sich innerhalb eines Winkels von geringer Oeffnung finden.
Wir sind der Meinung, daß man den Gebrauch des Hyalographen auch denjenigen nicht
dringend genug empfehlen kann, die sehr feste Zeichner sind. Die meisten Leute
koͤnnen z.B. sich von einer Maschine keine deutliche Vorstellung machen,
außer wenn man ihnen dieselben im Perspective vorzeichnet. Mit dem Instrumente des
Hrn. Clinchamp kann man dieselben aͤußerst schnell, und
genauer zeichnen, als es irgend Jemanden entweder nach dem freien Auge oder durch
die Operationen, welche eine genaue Perspectiv-Zeichnung fodert, moͤglich
ist.
Auch die Landschaft-Mahler koͤnnen, bei der Zeichnung einer Landschaft, durch
Anwendung dieses Instrumentes sich viele Zeit ersparen; sie werden sich dadurch in
Kenntniß und Anwendung der Grundsaͤze der Perspective uͤben, und sich
gewoͤhnen, ihren Gemaͤhlden, wenn dieselben auch noch so klein sind,
eine scheinbar natuͤrliche Groͤße, oder selbst ein noch
groͤßeres Ansehen zu geben, wenn sie dasselbe noͤthig erachten
sollten.
Man erhaͤlt, wenn man sich das Instrument bei Hrn. Clinchamp, Lehrer der Zeichenkunst bei den See-Cadeten zu Toulon
unmittelbar bestellt, dasselbe fuͤr 100 Franken mit Grad-Linealen, und, ohne
diese, fuͤr 70 Franken. Die Farbentusche kosten 3 Franken.
Erklaͤrung der Figuren.
Fig. 25.
Seiten-Aufriß des Hyalographen, wie er waͤhrend des Mahlens gestellt ist, mit
der Stellung des Mahlers.
Fig. 26.
Dasselbe Instrumente im Perspective: das Spiegelglas und das Ocular sind
herabgelassen.
Fig. 27. Die
Lehne fuͤr den Arm zur Erleichterung fuͤr die Hand des Zeichners.
Fig. 28. Das
Lineal mit horizontalem Falze im Aufrisse.
Fig. 29. Der
Glaͤtter, mit welchem man uͤber das Papier hinfaͤhrt, um
Abdruͤke zu erhalten.
Fig. 30. Der
Lange-Arm am Physionotrace
des Hrn. Chretien, an dem Hyalographe angebracht.
Der Hyalograph besteht aus einem Tische A, an welchem ein horizontales Lineal mit einem Falze
B in Form eines lateinischen T angebracht ist, welches Lineal mittelst eines Gewindes, C, beweglich ist. Zwei Pfeiler oder Saͤulen DD nehmen in Falzen EE ein feines Spiegelglas ohne Belegung auf, F, welches senkrecht steht, und den Tisch in zwei gleiche Theile theilt.
Dieses Spiegelglas und der Rahmen desselben kann in der Mitte, wo sich Gewinde und
Haken befinden, welche
ein Zusammenlegen gestatten, um es desto leichter in die Kiste des Instrumentes zu
bringen, abgeschnitten seyn. Die drei Fuͤße, GG, welche den Apparat tragen, sind jeder mit einem Stifte oder Zapfen,
I, versehen, wodurch man sie nach Umstaͤnden
verlaͤngern oder verkuͤrzen kann, um das Instrument auch auf unebenem
Boden vollkommen horizontal zu stellen. Drei Leiter, HH, lassen sich in dem Lineale B hin und
herschieben, und koͤnnen, mittelst Drukschrauben mit einem
tellerfoͤrmigen Kopfe, FF, fest gestellt
werden, wodurch auch die Gegenstaͤnde, welche diese Leiter zu tragen haben,
befestigt werden koͤnnen. Der Traͤger des Oculares, I, wird durch Gewinde S in
drei Theile getheilt, so daß man denselben neigen und aufrichten kann, um das Ocular
immer parallel mit dem Spiegelglase zu erhalten, und dasselbe zu entfernen, wenn man
den Abstand vergroͤßern will. Die Lehne, L, die
aus zwei Theilen besteht, dient der Hand des Zeichners als Stuͤze, dessen
Ellenbogen sich auf ein anderes Stuͤk, M,
auflehnt, wodurch die Fuͤhrung der Hand erleichtert wird. Das
Staͤbchen O haͤlt den Zeichenstift, der
die Oberflaͤche des Spiegelglases beruͤhrt, wenn das Ocular davon
entfernt ist. Dieses Ocular P ist aus Kupfer, und an dem
Ende des Traͤgers desselben, I, angebracht: es
vereinigt die Sehestrahlen. Ein undurchsichtiges Stuͤk, R, das sich in einem Kniee bewegen laͤßt, ist vor
dem Auge, mit welchem der Zeichner nicht sieht, angebracht, damit derselbe sich
nicht bemuͤhen darf, dieses Auge immer zugeschlossen zu halten. Das
horizontale Lineal B ist mit zwei graduirten
Maßstaͤben, UU, Fig. 28. versehen deren
einer zur Bemessung der genauen Entfernung des Oculares von dem Spiegelglase, der
andere zur Bestimmung des Sehewinkels dient, unter welchem man den Gegenstand sieht.
Ein Winkelmesser, V, dient zur Bestimmung derjenigen
Winkel, die auf dem Lineale nicht mehr verzeichnet werden konnten, so wie der wahren
Lage der natuͤrlichen Linien gegen die Flaͤche des Spiegelglases.
Dieses Stuͤk, welches sich mittelst eines Gewindes aufrichten laͤßt,
wird auch ein Richtscheit, um das Instrument vollkommen horizontal zu stellen.
Der lange Arm des Physionotrace des Hrn. Chrétien,
Fig. 30.
besteht aus einem Stabe a, der an einem festen Puncte,
b, angebracht ist, und dem man, mittelst einer Nuß, (genou de Cardan) c, jede
beliebige Neigung geben kann. Dieser Stab laͤßt sich mittelst einer
Spiralfeder d, nach Belieben verlaͤngern, und hat
ein Ocular e, das vor dem Auge des Zeichners steht. Ein
anderes Ocular, f, ist an der Reißfeder g befestigt. In dem Verhaͤltnisse als die Spize
des Zeichenstiftes h stumpf wird, laͤßt man die
Stellschraube i wirken, die sie an der
Oberflaͤche des Spiegelglases andruͤkt. Dieses Instrument, verbunden
mit dem Hyalographen, erlaubt selbst innerhalb eines sehr kleinen Sehewinkels ohne
alle Verzerrung zu zeichnen, indem das Auge sehr nahe an dem Spiegelglase ist.
Gebrauch des Instrumentes.
Der Zeichner sezt sich in der, Fig. 25. angegebenen,
Stellung, und, nachdem er den Sehewinkel gewaͤhlt hat, unter welchem er die
Gegenstaͤnde sehen will, bringt er sein Auge an das Ocular an, und darf nun
nur auf der Oberflaͤche des Spiegelglases mit der Spize der Zeichenfeder dem
Umrisse der Gegenstaͤnde nachfahren, die auf diese Weise auf dem Glase mit
aller Treue dargestellt seyn werden. Die Zeichnung wird desto groͤßer oder
kleiner ausfallen, je mehr oder minder das Auge von dem Spiegelglase entfernt
war.
Das Spiegelglas, dessen man sich bedient, muß so duͤnn wie moͤglich
seyn, ohne alle Blasen, und so eben als moͤglich. An der Seite des Oculares
uͤberzieht man dasselbe mit einer sehr duͤnnen Lage Gummiwasser. Wenn
das Spiegelglas in dieser Hinsicht gehoͤrig zugerichtet ist, so muß der
Zeichenstift leicht auf demselben angreifen, ohne daß das Glas darob etwas an seiner
Durchsichtigkeit verloren hat.
Der Zeichenstift, dessen man sich bedient, ist weiße Kreide, und zuweilen, wo man
sehr feine Striche machen muß, zugespizter weißer Pfeifenthon.
Es ist nicht noͤthig, das Spiegelglas bei jeder Zeichnung neu zuzubereiten,
man darf nur die weißen Striche mit etwas Leinwand wegwischen. Nur dann, wenn das
ganze Glas mit weißen Strichen uͤberdekt ist, muß eine neue Lage Gummiwasser
aufgetragen, und das Glas mit Seifenwasser oder Weingeist gewaschen werden.
Um Abdruͤke von der auf das Glas gemachten Zeichnung zu erhalten, kehrt matt
dasselbe auf seine nicht gummirte Seite und bringt es in eine schiefe Lage, wie in
Fig. 26.,
d.h., den unteren Theil des Rahmens auf die Haken NN gestuͤzt, die in dieser Absicht auf dem Tische des Instrumentes
und dem oberen Theile der Lehne der Hand L angebracht
sind. Hierauf reibt man die hyalographische Tusche in einem kleinen
Marmornaͤpfchen, und zwar etwas dik, ab. Dann faͤhrt man mit der Spize
eines Pinsels, dessen Aussenhaare man weggeschnitten hat, um nur einen sehr feinen
Haarbuͤschel innwendig uͤbrig zu lassen, allen Kreidezuͤgen
nach, die sich auf der entgegengesezten Seite des Glases befinden. Nachdem diese
Zeichnung getroknet ist, bereitet man ein Blatt etwas befeuchtetes Papier
uͤber dieselbe, und legt ein anderes Blatt trokenes Papier darauf, welches
man mittelst eines Stuͤkes harten und glatten Holzes, wie Fig. 29, genau auf
demselben anliegen macht. Hierauf zieht man das Blatt Papier ab, welches eine genaue
Copie der in hyalographischer Tusche gezeichneten Perspektive gibt.
Tafeln