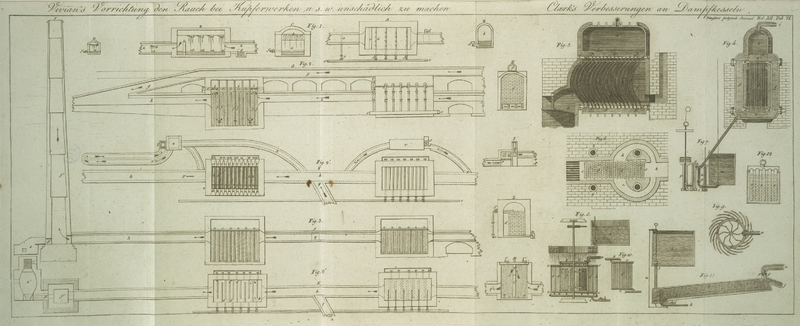| Titel: | Alexander Clark's, Esqu. zu Dron, in the Parish of Lenchars, County of Tife, Rorth-Britain, Verbesserung an Kesseln und Verdichtern der Dampf-Maschinen, worauf er am 21. März 1822 sich ein Patent geben ließ. |
| Fundstelle: | Band 12, Jahrgang 1823, Nr. XLVIII., S. 300 |
| Download: | XML |
XLVIII.
Alexander Clark's, Esqu. zu Dron, in the Parish
of Lenchars, County of Tife, Rorth-Britain, Verbesserung an Kesseln und Verdichtern der
Dampf-Maschinen, worauf er am 21. März 1822
sich ein Patent geben ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Nro. 32. S.
57.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Clark's Verbesserung an Kesseln und Verdichtern der
Dampfmaschinen.
Diese Verbesserungen beziehen sich vorzuͤglich auf
Dampfmaschinen mit hohem Druke. Die Kessel bestehen aus einer Menge aufrecht
stehender gekruͤmmter Roͤhren, wodurch dem Feuer eine große
Oberflaͤche dargebothen wird. Die Enden der Roͤhren oͤffnen
sich in mit Wasser gefuͤllte Kammern, wodurch die Roͤhren
gefuͤllt und immer voll erhalten werden.
Fig. 4 Tab. VI.
ist ein Querdurchschnitt des Kessels und Ofens nach der punctirten Linie zz, im horizontalen Durchschnitte. Fig. 5. ist ein
Laͤngendurchschnitt desselben, welcher die Form und Stellung der
Roͤhren zeigt, und Fig. 6. ist der Grundriß
oder horizontale Durchschnitt, in welchem die Form und der Bau der Zuͤge
dargestellt ist. Dieselben Buchstaben zeigen dieselben Gegenstaͤnde in allen
3 Figuren an. a, ist der Feuerherd; b, die Aschengrube; c, c,
der Ofen, welcher die Roͤhren enthaͤlt. Dieser Raum ist oben und unten
und an den Seiten mit Feuerziegeln eingeschlossen. d, d, d,
d, sind Gußeisen-Platten, mit Oeffnungen zum Durchgange fuͤr die
Roͤhren, in welchen die Enden derselben befestigt sind. e, e, sind die oberen und unteren Theile des Kessels,
welcher destillirtes Wasser enthaͤlt, welches durch die senkrechten
Saͤulen, f, f, f, f, zufließt. Diese
Saͤulen stuͤzen den oberen Theil des Kessels, und verbinden ihn mit
dem unteren: beide sind mittelst vorspringender Raͤnder und Bolzen vereinigt,
und bilden ein Ganzes. g, g, sind die
gekruͤmmten, mit Wasser zur Erzeugung des Dampfes gefuͤllten,
Roͤhren auf der aͤußeren Oberflaͤche, auf welche das Feuer
wirkt. Diese
Roͤhren sollen aus ungefaͤhr 1/10 Zoll dikem Kupferblech verfertigt,
an den Kanten mit Messing oder Zinn geloͤthet, und ungefaͤhr 1 Zoll
weit seyn. Die krumme Form wurde den Roͤhren deßwegen gegeben, damit das
Metall sich bei verschiedenen Temperaturen, ohne zu springen, ausdehnen und zusammen
ziehen kann. Zwischen dem Bogen der Feuerziegel oben und der oberen Platte, e, ist ein Raum, damit die Hize die Platte nicht
verderben kann. h, ist der Kobel des Kessels, und i, die Roͤhre, welche den Dampf nach der Maschine
leitet. k, k, sind die Zuͤge, durch welche der
Rauch in den Schornstein gelangt, und l eine
Roͤhre, durch die der Kessel mit Wasser versehen wird. Die unteren Theile des
Kessels, die Platten e, e, und der Kobel sind durch
hervorstehende Raͤnder oder Rippen verstaͤrkt, wie Fig. 4. und 5. zeigen.
Fig. 7. ist
eine Vorrichtung, um Wasser in den Kessel zu treiben, und die Sicherheits-Klappe in
den Daͤmpfer zu stellen. In dieser Figur ist m
eine Wasser-Cisterne mit einer Klappe am Boden, welche mittelst eines Seiles oder
einer Kette, welche uͤber eine Rolle zu einem Schwimmer in den Kessel
laͤuft, geoͤffnet oder geschlossen werden kann. n, ist eine Drukpumpe, die von der Maschine getrieben wird, und durch die
Roͤhre l Wasser in die Maschine treibt. o, ist ein Gefaͤß, welches mittelst eines Armes
mit der Roͤhre l verbunden ist, und kaltes Wasser
enthaͤlt. Der untere Theil desselben steht mit einem Cylinder p in Verbindung, in welchem ein Staͤmpel
eingesezt ist, der mit mehreren Gewichten beschwert wird, deren Schwere dem Druke
gleich ist, mit welchem die Maschine in Thaͤtigkeit gebracht werden soll.
Nachdem die Roͤhren und Kammern des Kessels bis zur Linie jj, in dem Kobel mit destillirtem Wasser
gefuͤllt sind, wird das Feuer in dem Ofen angeschuͤrt, und die Hize
desselben wird, indem sie durch die Zuͤge zieht, auf die aͤußere
Oberflaͤche der Roͤhren g, g, wirken, in
denselben Dampf erzeugen, und diesen durch die Roͤhren in den Kobel
hinaufsteigen lassen, aus welchem er durch die Roͤhre i zur Maschine gelangt. Eine bedeutende Menge Wassers, welche in den
Roͤhren mit dem Dampfe aufsteigt, wird durch die Saͤulen f, f, in den unteren Theil des Kessels
zuruͤkkehren, und wieder in die Roͤhren bei ihren unteren Enden eintreten, wodurch ein
bestaͤndiger Kreislauf des Wassers durch den Kessel erhalten wird.
Wenn jemahls der Druk des Dampfes groͤßer werden sollte, als die Kraft, unter
welcher die Maschine zu arbeiten bestimmt ist, so wird das Wasser durch die
Roͤhre 1, zuruͤk gedruͤkt, wo dann die kleine Klappe x an dem unteren Theile der Roͤhre die
Ruͤkkehr desselben in die Pumpe n, oder in die
Cisterne m, hindern, und es in das Gefaͤß o, oder in den Cylinder p,
leiten wird, wo die Kraft desselben den belasteten Cylinder hebt, wodurch ein mit
der Kette q verbundener Daͤmpfer in dem Zuge des
Kessels niedergelassen, und folglich die Kraft des Feuers vermindert wird. Sollte
die Kraft des Dampfes fortfahren, den Staͤmpel in dem Cylinder p zu heben, nachdem der Zug durch den Daͤmpfer
geschlossen wurde, so kann eine Sicherheits-Klappe durch ein an der Kette q, befestigtes Gewicht geoͤffnet werden, welches
auf einen Hebel wirken und die Klappe heben wird. Dieß kann indessen auch durch
andere Mittel bewerkstelligt werden.
Die Verbesserungen, die hier an den Verdichtern vorgeschlagen werden, sind von
zweierlei Art, und schiken sich sowohl fuͤr Verhaͤltnisse, unter
welchen das Wasser wenig ist, als wo es haͤufig ist. Wo das Wasser wenig ist,
schlaͤgt Hr. Clark vor, den Verdichter so, wie hier in Fig. 8., zu bauen, wo
dieser Apparat im verticalen Durchschnitte dargestellt ist. Fig. 9. ist ein
horizontaler Durchschnitt des oberen Theiles desselben, a, ist die Ausleitungs-Roͤhre, welche den Dampf von der Maschine
ausleitet, nachdem er seinen Dienst gethan hat. bb
ist eine kreisfoͤrmige oder Hauptroͤhre, um den Dampf in die
gekruͤmmten Roͤhren c, c, c zu leiten. Aus
diesen einzelnen Armroͤhren steigt eine Menge kleiner senkrechter
Roͤhren dd zu einer unteren Reihe von
Armroͤhren, ee, hinab, die man
Sammlungs-Roͤhren nennt.
Einer dieser Arme, mit seiner oberen und unteren gekruͤmmten Roͤhre,
und feiner Reihe von senkrechten Roͤhren ist, abgenommen, in Fig. 10. dargestellt,
damit man den Bau des Ganzen besser einsieht. Es gibt eine Menge solcher Arme mit
ihren Reihen von Roͤhren, die hier aus der Hauptroͤhre b, auslaufen, wie man vorzuͤglich in Fig. 9, im
Vogelperspektive, wahrnehmen kann.
Der Dampf geht aus der Ausleitungs-Roͤhre der Maschine in die
kreisfoͤrmige Hauptroͤhre b, und von da
durch kleine Haͤlse in die verschiedenen krummen Roͤhren c, c, c; von da steigt er durch die senkrechten
Roͤhren, d, d, nieder zu den unteren
gekruͤmmten Roͤhren, e, e.
In dem Mittelpunkte dieser Reihen von Roͤhren ist ein Faͤcherrad, f, horizontal angebracht, welches mittelst einer Rolle
an seiner Spindel und einem Bande, das mit der Achse des Flugrades der Maschine in
Verbindung steht, bewegt wird. Ueber den Roͤhren ist ein
kreisfoͤrmiges Gefaͤß mit kaltem Wasser g,
g, welches aus einer Cisterne h, kommt. Das
kalte Wasser aus diesem Gefaͤße g, welches durch
kleine Loͤcher niedersteigt, faͤllt auf die Roͤhren unten,
welche einzeln mit Tuch oder irgend einer Wasser verschlingenden Substanz
uͤberzogen sind, damit sie das kalte Wasser laͤnger an ihrer
Oberflaͤche behalten. Diese Roͤhren sollen aus duͤnnem Kupfer,
und nicht staͤrker seyn als noͤthig ist, um den Druk der
Atmosphaͤre zu ertragen.
Wenn der Dampf alle Roͤhren gefuͤllt hat, dringt seine Hize durch das
Metall bis in das nasse Tuch, und macht dieses ausduͤnsten, wodurch folglich
die Temperatur des Dampfes innerhalb der Roͤhren vermindert wird, und auf der
Stelle Verdichtung entsteht. Diese Wirkung wird noch mehr durch den Wind
befoͤrdert, den die Umdrehung des Faͤcher-Rades erzeugt, und welches
die bereits frei gewordene Hize verjagt, und dadurch die Ausduͤnstung sehr
vermehrt.
Das auf diese Weise durch Verdichtung des Dampfes in den Roͤhren erzeugte
Wasser fließt durch die sammelnden Arme nach der Roͤhre i, und von da zu der Luftpumpe der Maschine, welche sie
in die Cisterne m, Fig. 7. treibt, um den
Kessel ununterbrochen mit Wasser zu versehen. So kann dasselbe Wasser immer wieder
zur neuen Dampfbildung gebraucht werden, und eben so das zur Verdichtung bestimmte,
indem man es aus dem unteren Sammlungs-Gefaͤße in die Cisterne h hinaufpumpt, und die einzige Menge neuen Wassers, die
man zur Fortsezung der Arbeit der Maschine braucht, wird gerade so viel betragen,
als die Menge
desjenigen, das durch Ausduͤnstung von der aͤußeren Oberflaͤche
der Roͤhre verfliegt.
Es ist nothwendig, daß dieser Apparat in freier Luft offen hingestellt wird, damit
das verduͤnstende Wasser leicht in die Atmosphaͤre entweichen kann;
und es ist noͤthig, daß eine Abzugs-Klappe, wie k, in der unteren Roͤhre i angebracht wird,
um den Dampf ausfahren zu lassen, wenn der Apparat, ehe man die Maschine in
Thaͤtigkeit sezt, durchgeblasen wird.
Wenn die Maschine sich unter Umstaͤnden befindet, die ihr reichlichen Zufluß
an Wasser erlauben, soll der Verdichter auf die in Fig. 11. dargestellte
Weise gebaut werden, wo a die
Haupt-Ausleitungs-Roͤhre ist, durch welche der Dampf von der Maschine
abzieht; b, b, sind zwei Vertheilungs-Roͤhren,
welche von der Hauptroͤhre ausgehen; Fig. 12. stellt diesen
Theil vergroͤßert dar, und von seinem Ende aus gesehen: dieselben Buchstaben
bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in beiden Figuren. Neun kleinere
Vertheilungs-Roͤhren, c, c, c, entspringen aus
den zwei groͤßeren Roͤhren, b, b; aus
diesen fließt der Dampf in ein und achtzig Verdichtungs-Roͤhren, d, d, d, die der Laͤnge nach in dem Durchschnitte
des Gehaͤuses Fig. 11. dargestellt
sind, und die in die Armroͤhren e, von da in die
Sammlungs-Roͤhren, f, f, an dem unteren Theile
der Reihe leiten, welche auf eine aͤhnliche Weise, wie die oben beschriebenen
Vertheilungs-Roͤhren, eingerichtet sind.
Nachdem der Dampf von der Ausleitung alle Arme und Verdichtungs-Roͤhren
angefuͤllt hat, fließt kaltes Wasser aus der Cisterne h durch die Klappe i in das Gehaͤuse,
welches die Roͤhren enthaͤlt, und nachdem er dieses durchzog, wird er
an dem entgegengesezten Ende durch die Auslaß-Roͤhre j ausgelassen. Die Wirkung dieser Vorrichtung ist, daß die Hize der
Roͤhren von dem kalten Wasser aufgenommen wird, und der Dampf in denselben
sich folglich verdichtet. Das Wasser desselben sammelt sich in der Roͤhre k, geht in die Luftpumpe der Maschine, und wird von da
in die Cisterne des destillirten Wassers getrieben, welche den Kessel der Maschine
mit Wasser versieht.
An der Roͤhre k ist eine Klappe l, die sich auswaͤrts oͤffnet, um den Dampf
entweichen zu lassen, wenn der Apparat durchgeblasen wird, ehe man die Maschine in
Thaͤtigkeit sezt. Die Klappe i, und die Klappe
m, sind mittelst einer Stange, n, und zweier Hebel mit einander verbunden, mittelst
welcher sie abwechselnd wirken, und den Zufluß des Wassers aus der Cisterne sperren,
waͤhrend dieses zugleich aus dem Gehaͤuse ausfließt.
Der Patent-Traͤger bemerkt, daß, obschon die Zeichnungen und Beschreibungen
bestimmte Formen, Dimensionen und Materialien zum Baue des Kessels und der
Verdichter darstellen, er sich doch nicht auf dieselben allein beschraͤnken
will. Der Kessel kann, wenn ein außerordentlich hoher Druk des Dampfes
noͤthig ist, in allen Theilen, die hier als aus Gußeisen bestehend
dargestellt sind, diker gemacht werden, die Bolzen koͤnnen zahlreicher und
staͤrker, und die Ofenroͤhren duͤnner seyn; sie sollen nicht
soviel Metalldike haben, daß die Hize nicht durch dieselben zu dem Wasser gelangen
und unregelmaͤßige Ausdehnung und Zusammenziehung der inneren und
aͤußeren Oberflaͤchen, folglich groͤßere Abnuͤzung und
Wahrscheinlichkeit eines Bruches, erzeugen kann.
Die Roͤhren in dem Kessel koͤnnen in der oberen und unteren Platte
durch vertiefte Loͤcher und in denselben eingeschnittene
Schraubengaͤnge befestigt werden: man bringt dann runde Staͤbe und
eine Doke in die Muͤndung der Roͤhren, wodurch das Metall in die
Schraubengaͤnge getrieben wird, und bis Roͤhren gehoͤrig in den
Platten befestigt werden. Wenn eine oder die andere dieser Roͤhren
ausgebessert und herausgenommen werden muß, schraubt man die Bolzen ab, und nimmt
die obere Platte weg. Jede so eingerichtete Roͤhre des Kessels wird als
Sicherheits-Klappe wirken; denn die staͤrkste Roͤhre muß ehe springen
als der Kessel, und die Bereitung derselben beschraͤnkt sich bloß auf das
Innere des Ofens.
„Die Vortheile dieser Bauart des Kessels sind: 1tens, die
Faͤhigkeit, mit hohem Druke zu arbeiten, ohne alle Gefahr einer Berstung;
2tens, nimmt der Kessel, im Vergleiche mit der dadurch gewonnenen Kraft, wenig
Raum ein, und vermindert beinahe in demselben Verhaͤltnisse die
Groͤße der Maschine; 3tens, sezt er der Einwirkung des Feuers eine
groͤßere Oberflaͤche aus, und da das Metall an den Roͤhren duͤnn
ist, werden diese die Hize sehr schnell aufnehmen, vielleicht drei oder vier
Mahl schneller als ein gewoͤhnlicher Kessel von gleichem, dem Feuer
ausgesezten Umfange; 4tens, biethet er der aͤußeren Luft wenig
Oberflaͤche dar, und da der, der aͤußeren Luft ausgesezte Theil
sehr dik ist, so kann wenig Hize durch denselben; 5tens, da er mit destillirtem
Wasser gespeiset wird, so wird es selten oder nie noͤthig seyn, ihn zu
reinigen, und es werden sich weder Steinnoch Salz- oder andere Rinden in
demselben bilden, die die Hize nicht zu dem Wasser durchdringen lassen, den
Kessel stellenweise roch brennen, und dadurch durchloͤchern und
unbrauchbar machen.“
Die Vortheile der hier vorgeschlagenen Einrichtung der Verdichter sind: 1tens, ihre
Anwendbarkeit auf jede gewoͤhnliche Maschine; die Leichtigkeit, den Kessel
immer wieder neu mit Wasser zu fuͤllen; 3tens, die Leichtigkeit, die Maschine
auch dort in staͤtem Gange zu halten, wo nur wenig Wasser vorhanden ist;
4tens, daß hier eine kleinere Luftpumpe noͤthig ist, als bei den
gewoͤhnlichen Dampfmaschinen; 5tens, die Anwendbarkeit der Verdichter der
zweiten Art auf Dampfbothe. Die Vortheile des Kessels und der Verdichter, wenn beide
zugleich angewendet werden, sollen 1tens, in einer Ersparung von neun Zehntel des
bisher bei Maschinen mit niedrigem Druke gewoͤhnlich noͤthigen
Feuermateriales; 2tens, in der Gedraͤngtheit dieses Apparates, die ihn
fuͤr Dampfbothe besonders tauglich macht, bestehen.
Die Anspruͤche des Patent-Traͤgers sind: 1tens, das Auftreiben des
Dampfes in kleinen gekruͤmmten Roͤhren; 2tens, Verfertigung der Theile
des Kessels, welche dem Feuer ausgesezt sind, aus duͤnnem Metalle; 3tens,
Verfertigung der Theile des Kessels, welche dem Feuer nicht ausgesezt sind, aus sehr
diken und starken Stuͤken, verhaͤltnißmaͤßig viel
staͤrker, als alle uͤbrigen Theile, und Verwahrung derselben vor der
Einwirkung des Feuers, damit sie nicht durch Ausdehnung und Zusammenziehung leiden;
4tens, Verbindung des Kessels mit einem oder dem anderen der oben beschriebenen
Verdichter, wodurch er mit destillirtem Wasser, das nur wenig Nachfuͤllung
braucht, bearbeitet werden kann; 5tens, Verdichtung des Dampfes der Maschine durch den
zuerst beschriebenen verduͤnstenden Verdichter oder durch den anderen zulezt
beschriebenen!!Diese, beinahe einem organische Koͤrper gleichende, Dampfmaschine ist
so zusammengesezt, daß sie wohl schwerlich irgendwo ausgefuͤhrt und
benuͤzt werden kann. Es ist doch sonderbar, daß der menschliche Geist
lieber das Einfachste complicirt, als das Complicirte vereinfacht: beinahe
in allen Theiten des menschlichen Koͤnnens und Wissens. A. d.
Ueb.
Tafeln