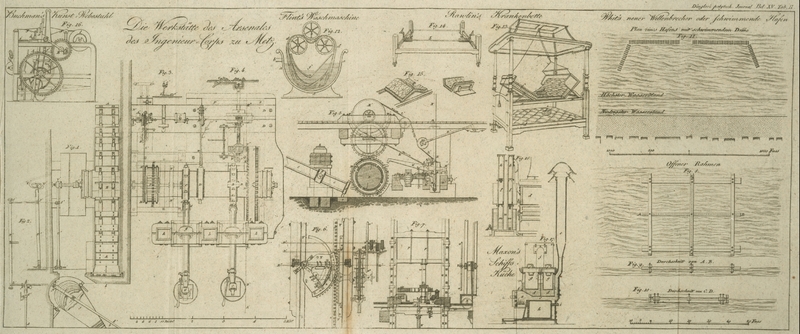| Titel: | Auszug einer Notiz des Hrn. Poncelet über die Werkstätte des Arsenales des Ingenieur-Corps zu Metz, und vorzüglich über eine von Hrn. Ségard, Guide du genie, erfundene Vorrichtung zur Verfertigung der Radfelgen. |
| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. III., S. 9 |
| Download: | XML |
III.
Auszug einer Notiz des Hrn. Poncelet über die Werkstätte
des Arsenales des Ingenieur-Corps zu Metz, und vorzüglich über
eine von Hrn. Ségard, Guide du genie, erfundene
Vorrichtung zur Verfertigung der Radfelgen.
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement
pour l'industrie nationale. N. 237. S. 68.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Poncelet über die Werkstätte des Arsenales des Ingenieur-Korps zu
Mez.
Diese Werkstaͤtte enthaͤlt nebst der
Saͤgemaschine auch die Haͤmmer, die Blasebaͤlge, eine Drehbank
fuͤr die Naben, eine Schleifmuͤhle eine Blechschere, eine Vorrichtung
zum Eingreifen und Ausheben des Triebstokes der Saͤge und eine andere
Vorrichtung zum Aufheben des Schuzbrettes des oberen Stokwerkes des
Gebaͤudes, in welchem sich die Saͤge zum Gerade und Krummsaͤgen
befindet.
Da man aͤhnliche Ein- und Vorrichtungen auch anderswo mit Vortheile anwenden
kann, so scheint eine Beschreibung derselben die Aufmerksamkeit des Publicums zu
verdienen.
Beschreibung der Haͤmmer.
Fig. 1. Tab.
II. stellt alle zu ebener Erde in dieser Werkstaͤtte befindliche
Vorrichtungen im Grundrisse dar, und Fig. 5 ist ein senkrechter
Durchschnitt nach der gebrochenen Linie, A'' B'' C'' D'' E''
F'' G'' H'', dieses Grundrisses, wodurch ein Theil derselben
Gegenstaͤnde theils im Durchschnitte theils im Aufrisse dargestellt wird. A ist ein unterschlaͤchtiges Wasserrad mit 30
Fluͤgeln; dasselbe bewegt sich in einem gewoͤhnlichen Laufe, und ist
mit zwei Eimern mit Klappen versehen, welche das Wasser in eine oberhalb angebrachte
Traufrinne gießen, aus welcher dasselbe in einen neben den Haͤmmern befindlichen Trog fließt,
woraus die Schmiede und die Schleiferei versorgt wird.
Dieses Rad theilt seine Bewegung dem Wellbaume der Haͤmmer, BB, mit, der drei Guͤrtel aus Gußeisen, C, D, E traͤgt, wovon der erste mit 6, der zweite
mit 12, der dritte mit 18, hervorstehenden eisernen Daͤumlingen versehen ist,
welche die Haͤmmer F, G, und die Schere R'R' in
Bewegung sezen.
Der Hammer F wiegt 168 Kilogramme, ohne Stiel cc. Dieser Stiel ist an seinem Ende, in der
Naͤhe der Daͤumlinge, mit einem eisernen Bande, d, versehen, auf welchem ein staͤhlerner Knopf zur Aufnahme des
Drukes der Daͤumlinge angebracht ist, und der sich unten in einem andern,
gleichfalls staͤhlernen Knopf endet, der auf ein Stuͤk Gußeisen
aufschlaͤgt, welches auf einem Stuͤke Holz angebracht ist, und dem
Hammer als Feder oder Zuruͤkschneller dient. Der Stiel c, bewegt sich auf zwei Zapfen ff, die
in einem gegossenen Halbsbande, g befestigt sind,
welches denselben umfaͤngt, und in denselben eingelassen ist. Diese Zapfen
stuͤzen sich kraͤftig gegen zwei Stuͤke Gußeisen oder zwei
Pfannen, welche von drei Seiten mittelst hoͤlzerner Keilen gegen die Doken,
hh, und ihre Systeme aus verbolzten
Baͤndern gehalten werden. Man entzieht den Hammer, nach Belieben, der
Einwirkung der Daͤumlinge mittelst des Systemes, ikl, welches 1tens aus einem verticalen Hebel besteht, l, der sich frei in einer auf dem Boden befestigten
Pfanne dreht, und dessen oberer Theil einen Elbogen hat, der unter dem Stiele des
Hammers eingreift. 2tens aus einem horizontalen Hebel, ik, der sich um den Bolzen k dreht, welcher an
dem Bloke des Ambosses befestigt ist, und mit seinem Ende frei den verticalen Hebel
l umfaßt, wodurch dieser dem Stiele c, naͤher gebracht, oder von demselben entfernt
werden kann. Die Buchstaben, éé, der
1ten und 5ten Figur erklaͤren ein aͤhnliches auf die Schere, R'R', angewendetes System noch deutlicher, wovon unten
ausfuͤhrlicher die Rede seyn wird.
Der Hammer G unterscheidet sich von dem vorigen nur
dadurch, daß er 70 Kilogramme wiegt, und aus geschlagenem Eisen, statt aus Gußeisen
besteht. Er dient zum Schmieden der Schaufeln und der Eisenbleche, waͤhrend
der vorige zum Schmieden mehr oder minder starker Eisenstangen aus dem alten Stabeisen (fers riblons) gebraucht wird.
Der große Wellbaum der Haͤmmer, BB,
traͤgt noch außer den drei Guͤrteln CDE, zwei Raͤder, HH, II, welche die Bewegung desselben der Drehbank
fuͤr die Naben und der Saͤge mittheilen, wie wir weiter unten
erklaͤren werden. Dieser Wellbaum wiegt, mit allem, was er traͤgt,
zwischen 6 und 7,000 Kilogramme, und ungeachtet dieses ungeheuren Gewichtes bemerkt
man noch deutliche Stoͤße von den Haͤmmern an ihm. Man hat daher in
England sehr Recht, wenn man das Wasserrad zuweilen aus Gußeisen verfertigt, und an
dem andern Ende des Wellbaumes ein Flugrad aus demselben Metalle und von großer
Staͤrke anbringt, indem man dadurch nicht nur die Stoͤße vermindert
und die Bewegung mehr gleichfoͤrmig macht, sondern auch noch einen
bedeutenden Verlust der Triebkraft erspart.
Der Hammer F kann in 200 Tagsschichten, jede zu 10
Stunden, 9,500 Kilogramme altes Stabeisen (fers riblons)
in Stangen von jeder Dimension verwandeln, und ungefaͤhr 7,600 Kilogramme
neues Eisen erzeugen: das Uebrige wird naͤmlich Abfall. Hierbei muß man noch
bemerken, daß die Haͤlfte der Zeit durch das Hizen verloren geht, und daß man
noch ein Mahl so viel Eisen erzeugen koͤnnte, wenn man den Hammer immer gehen
ließe, wie dieß gewoͤhnlich geschieht.
Maschine, um das Holz in gerade Stuͤke zu
saͤgen.
Die Saͤge, auf welcher das Holz in gerade Stuͤke zerschnitten wird,
wird von dem Rade II, Fig. 1 und 5, welches auf dem
Wellbaume, BB, aufgezogen ist, in Bewegung gesezt.
Dieses Rad hat 56 Zaͤhne oder hoͤlzerne Randstaͤbe und greift
in den Triebstok, k, ein, welcher aus Gußeisen
verfertigt ist und 13 Spindeln hat. Dieser Triebstok oder Drilling ist auf einer
eisernen Achse, L, aufgezogen, die auf zwei doppelten
kupfernen Kissen oder Buͤchsen, m, aus zwei
Stuͤken ruht, welche mit eisernen Huͤten, p, bedekt sind, die von Bolzen mit doppelten Schrauben fest angezogen
werden. Diese eiserne Achse ist an ihrem Ende, M,
gekruͤmmt, so daß sie eine Kurbel von 32 Centimeter im Halbmesser bildet, an
welcher die hoͤlzerne Muschel, N, angebracht ist,
die das Gestell der Saͤge in Bewegung sezt. Diese Muschel traͤgt an
ihrem unteren Theile eine kupferne Buͤchse, die aus zwei Stuͤken
besteht, durch mit Huͤten versehene Zaͤume festgehalten wird, und den
Bolzen der Kurbel aufnimmt.
Urspruͤnglich hatte die Kurbel, M, zwei Arme, und
die Achse L des Drillinges verlaͤngerte sich bei
O, Fig. 1 um einen
gewoͤhnlichen Schleifstein aufzunehmen, PP,
der der Saͤge als Flugrad dienen koͤnnte, wie auch jezt eines daran
ist: allein man hat diese Vorrichtung aus besonderen Ursachen aufgegeben.
Die Muschel N hat an ihrem unteren Ende, Fig. 6 und 7, ein eisernes Auge,
welches durch zwei verbolzte Baͤnder daran befestigt ist, und einen Knopf an
den unteren Querbalken des Rahmens QQ, der die
Saͤge aufnimmt. Dieser Rahmen bewegt sich in dem Falze zweier gefalzten
Pfosten, RR, welche mit hervorstehenden
hoͤlzernen Schuͤsseln versehen sind um die Pfosten des Rahmes zu
halten. Die abwechselnde Bewegung der Saͤge wird mittelst eines, mit einem
Gewinde versehenen Hebels, nn, einer kleinen
hoͤlzernen horizontalen Achse mitgetheilt, die in der Zeichnung nicht
dargestellt werden konnte.
Diese Welle, die unter dem Boden der Saͤge vor und parallel mit dem Rahmen,
QQ, angebracht ist, traͤgt an ihrem
anderen Ende eine eiserne Stange, welche mit Loͤchern zur Aufnahme eines
kleinen Bolzens versehen ist, auf welchem das untere Ende des Stieles des Geisfußes,
oo, Fig. 6, ruht. Dieser
Geisfuß treibt ein Schiebrad, S, welches mit 360
Zaͤhnen versehen, und auf einer horizontalen Achse TT, aufgezogen ist, die einen Drilling, UU, von acht hoͤlzernen Spindeln
traͤgt. Dieser Drilling greift in einen horizontalen Zahnstok, rr, ein, welcher auf einem Schwungbaume des
Schlittens, VV, aufgezogen ist, auf welchen man
das zu zersaͤgende Holz legt: auf diese Weise ruͤkt der Schlitten
immer gegen die Saͤge vor. Um denselben zuruͤkzufuͤhren,
nachdem das Stuͤk Holz seiner ganzen Laͤnge nach durchsaͤgt
ist, hebt man den Geisfuß, oo, sammt dem darunter
befindlichen Sperrkegel, und der Arbeiter dreht die horizontale Achse, TT, mittelst der an den Seiten des Rades S, befindlichen Zapfen.
Diese vom Wasser getriebene Saͤge, die mit allem Zugehoͤre
ungefaͤhr 170 Kilogramme wiegt, kann im Durchschnitte in 10 Stunden
50–60 □ Meter gesaͤgte Flaͤche Eichenholz liefern, wo
die Zeit mit eingerechnet ist, waͤhrend welcher die Saͤge ruhig steht,
und man die gesaͤgten Stuͤke aufschlichtet. Sechs Menschen
wuͤrden waͤhrend 10 Stunden kaum ebensoviel Arbeit liefern. Ihre
Wirkung kommt 190 Kilogrammen gleich, die in Einer Secunde 1 Meter durchlaufen, und
die man hier am Ende der Halbmesser des hydraulischen Rades angebracht denkt.
Maschine zum Saͤgen der Felgen der
Raͤder.
Um kreisfoͤrmig zu saͤgen, beseitiget man das gewoͤhnliche
Saͤgeblatt mit Ausnahme des unteren Buͤgels t, Fig.
6 und 7, und bringt zwischen den Pfosten QQ
dieser Saͤge den kreisfoͤrmigen Sector, XYZ, an, der in seinem Mittelpuncte sich auf einem Zapfen U dreht, welcher auf der eisernen Unterlage befestigt
ist, die auf einer Seite auf einem der Falze des Schlittens, auf der anderen auf dem
Boden der Saͤgemuͤhle eingebolzt ist. Diese Unterlage muß, den
Schwingbaum des Wagens so umfassen, daß die Bewegung desselben dadurch nicht
gehindert wird. Der Zapfen, u, um welchen der
kreisfoͤrmige Sector sich dreht, muß genau in der Ebene des Rahmens der
Saͤge, QQ, neben einem der Pfosten
eingestekt seyn.
Der Sector XYZ ist inwendig ausgeschweift und
besteht aus zwei hoͤlzernen Armen, X, Y, deren
innere Flaͤche nach der Richtung der Halbmesser laͤuft, und die sich
gegen den Mittelpunct mittelst eines hoͤlzernen Keiles vereinigen, der durch
Zapfen und Ausschnitte zusammengehalten wird; zwei duͤnne Eisenplatten
verbinden dieses Gefuͤge oben und unten in der Naͤhe des Zapfens u. An dem diesem Zapfen gegenuͤber stehenden Ende
endet der Sector sich in ein gekruͤmmtes Holzstuͤk Z, welches mit den Armen X,
Y verbunden und außen mit Zaͤhnen versehen ist, welche in die
Zaͤhne des Zahnstokes; WW, eingreifen,
welcher sich auf einem Schwingbaume, VV, des
geraden Schlittens befindet, und folglich seine fortschreitende Bewegung dem
kreisfoͤrmigen Sector mittheilt. Zwei hoͤlzerne Stuͤzen xx, die an den Enden unter dem krummen
Stuͤke des Sectors befestigt sind, dienen zur Aufnahme zweier eisernen
Geschiebe, auf welchen
der Sector ruht. Ein duͤnnes Eisenband ist auf dem Boden der
Saͤgemuͤhle angenagelt, um das Rollen der Geschiebe xx, zu erleichtern.
Nachdem der kreisfoͤrmige Schlitten auf diese Weise vorgerichtet wurde,
laͤßt man den Querbalken, y, des Rahmes der
Saͤge um eine beliebige Weite herab, indem man denselben in dem an den
Pfosten, QQ, angebrachten Falze schiebt. Auf dem
unteren Querbalken des Rahmes bringt man ein hoͤlzernes Winkelmaß, QZ, an, dessen horizontaler Schenkel, Z, unter dem Buͤgel der Saͤge, t, durchlaͤuft. An dem Ende dieses Armes und an
dem mittleren Querbalken, y, befestigt man die
Buͤgel zweier neuen paralellen Saͤgeblaͤtter, ww, welche zum Saͤgen, der Felgen der
Raͤder bestimmt sind; diese Blaͤtter muͤssen den
ausgeschweiften Theil des kreisfoͤrmigen Wagens durchlaufen.
Das Winkelmaß QZ, welches einer Seits auf dem
unteren Querbalken des Rahmens, QQ, stuͤzt,
anderer Seits auf dem Buͤgel, t, bildet eine Art
von Hebel, welche die beiden Blaͤtter der Saͤge nach Belieben spannen
laͤßt, was mittelst der Bolzen pp,
geschieht, die man an der Stelle der kleinen Bolzen der gewoͤhnlichen
Saͤge anwendet.
An den beiden Armen des Sectors, XY, hat man
uͤbrigens noch Paare concentrischer Kerben angebracht, die von einem Arme
gegen den andern correspondiren, und zur Aufnahme der beiden
Saͤgeblaͤtter, ww, beim Anfange und
Ende der Bewegung bestimmt sind. Diese Kerben-Paare sind nach der Groͤße der
zu schneidenden Felgen ausgeweitet. Der Blok, aus welchem die Felgen geschnitten
werden muͤssen, wird an seinen Enden auf den beiden Armen des Wagens
befestigt, was nach Art der Schreiner, mittelst zweier Knechte, ss, geschieht. Diese Vorrichtung ist, wie man
sieht, sehr einfach; die abwechselnde Bewegung des Rahmens, QQ, theilt sich dem geraden Schlitten, VV, mit, und von diesem aus, mittelst des
Zahnstokes WW, dem krummen Schlitten XYZ, der regelmaͤßig gegen die
Saͤgen ww, fortschreitet, in dem Maße als
der Blok zerschnitten wird. Dieser Blok kann uͤbrigens mehrere Felgen in
seiner Breite halten, und wenigstens zwei in seiner Laͤnge, ohne daß das
Saͤgen dadurch erschwert wird. Es versteht sich uͤbrigens, daß die
Felgen vorlaͤufig auf dem Bloke vertheilt und gezeichnet werden.
Es waͤre uͤberfluͤßig, sich in ein weiteres Detail uͤber
diesen Mechanismus einzulassen, wir wollen nur beifuͤgen, daß die
Saͤgeblaͤtter, ww, aus gegossenem
Stahle ungefaͤhr 1 Meter lang, 5 Centimeter breit, und 3 Millimeter dik sind;
daß sie nur 11 Centimeter aus einander stehen, nach der Breite der Felgen
naͤmlich die man in den Arsenalen braucht, daß man sie aber nach Belieben um
vieles weiter von einander stellen kann, indem man naͤmlich entweder ein
Blatt der Saͤge dem Zaume t in der Mitte des
unteren Querbalkens des Rahmens hinlaͤnglich naͤhert, oder diesen Zaum
gaͤnzlich weglaͤßt, und durch zwei kleine auf beiden Seiten in der
Mitte des Rahmens befestigte Buͤgel ersezt.
Was den groͤßten Durchmesser betrifft, welchen man den zu saͤgenden
krummen Stuͤken geben kann, so haͤngt dieser von der Breite des
Schlittens der geraden Saͤge ab: diese darf nie weniger als 1,3 Meter
betragen, wenn man Stuͤke von 0,65 im Gevierte saͤgen will, wie es
hier der Fall ist. Indessen gibt man doch den großen Felgen, nach Arsenal-Gebrauche,
nur 1,9 Meter im Durchmesser; es ist aber leicht denselben zu vergroͤßern,
wenn man den arbeitenden Zapfen, u, dem Pfosten der
Saͤge naͤhert, und statt der Ferse des Sectors, xz, welche aus Holz ist, ein hervorstehendes Auge
aus Eisen nimmt, welches mit den Armen des Sectors fest verbunden ist. Man
wuͤrde auch noch von Seite der Kruͤmmung, z, gewinnen, wenn man die Stuͤzen, xx, der kleinen Rollen, die von Holz sind, durch eiserne ersezte. Man kann
noch uͤberdieß auf dem großen Schlitten der Saͤge eine Buͤhne
befestigen, auf welcher die Geschiebe des kreisfoͤrmigen Schlittens rollen
koͤnnen. Auf diese Weise wuͤrde man beinahe den ganzen Raum gewinnen,
der zwischen dem einen Pfosten des Rahmes QQ, und
dem Zahnstoke, rr, des großen Schlittens gelegen
ist. Man koͤnnte auf diese Weise Felgen schneiden, deren aͤußerer
Durchmesser vont 0,8 Meter bis 2,10 Meter betragen koͤnnte. Was die
Laͤnge des Umfanges der Felgen betrifft, so kann derselbe ohne alle
Unbequemlichkeit bis auf ein Drittel des ganzen Umfanges gebracht werden, wenn man
die Arme des Sectors, xy, hinlaͤnglich weit
oͤffnet, und
ein oder ein Paar Geschiebe mehr unter die Krumme, z,
legt, die denselben schließt.
Die Resultate dieser Vorrichtung zum Schneiden der Felgen sind folgende: Das Holz,
welches geschnitten wurde, war, gruͤnes und troknes Ulmen-Kernholz. Die
Felgen, die daraus geschnitten wurden, hatten im Durchschnitte 80 Centimeter der
Laͤnge nach am Umfange, und ungefaͤhr 11 Centimeter Dike. Wenn das
Holz noch gruͤn war, brauchte man zwei bis drei Minuten zu dem Schneiden
einer Felge, und wenn es ausgetroknet war, drei bis vier. Zwei bis drei Minuten
waren noͤthig um das Holz aufzuschlichten, das Schuzbrett aufzuziehen etc.
Man schnitt also in einer 10 stuͤndigen Tagsschicht ungefaͤhr 90
Felgen aus trokenem und 120 Felgen aus gruͤnem Ulmenholze, hierzu
wuͤrde man 5 Holzschneider brauchen, wenn mit dem Arme geschnitten
wuͤrde.
Wie das Schuzbrett aufgezogen und niedergelassen, und der
Drilling der Saͤgemuͤhle im Umlauf gesezt und gestellt wird.
Da die Saͤgemuͤhle sich im zweiten Stoke des Gebaͤudes befindet,
und es sehr unbequem seyn wuͤrde jedes Mahl hinabzulaufen und das Schuzbrett
zu ebener Erde aufzuziehen oder niederzulassen, so hat Hrn. Segard neben dem gefalzten Pfosten der Saͤge einen Wellbaum, Y'Z', angebracht (Fig. 6 u. 7), der mit vier Armen,
v', v', versehen ist, mittelst welcher derselbe
gedreht werden kann, und um welchen sich, nach und nach, ein Seil ohne Ende t't', u'u', welches mittelst eines Systemes von
fuͤnf Rollen mit dem Hebel des Schuzbrettes in Verbindung steht, aufwindet.
X'X', sind zwei dieser Rollen, welche unter dem
Wellbaume befestigt sind, und die beiden Seile t't',
u'u', parallel mit dem Boden bis zur gegenuͤberstehen den Wand
zuruͤkschiken, wo das Schuzbrett sich mit den zwei Rollen befindet, die den
vorigen aͤhnlich und mit denselben parallel sind. Die Seile t't', u'u', steigen dann senkrecht laͤngs dieser
Mauer hinab, und laufen uͤber die fuͤnfte Rolle, die nahe an der Erde
befestigt ist. Das Ende des Hebels des Schuzbrettes ist an einem dieser Seile
befestigt, und kann durch den Wellbaum, Y'Z', in
Thaͤtigkeit gesezt werden, der sich in dem oberen Stokwerke der
Saͤgemuͤhle befindet.
Die Vorrichtung, um den Drilling der Saͤgemuͤhle k in Fig.
1, 4, 5,
zu stellen und in Thaͤtigkeit zu sezen, hat Hr. Segard auf folgende Weise getroffen. Die kupfernen Kissen oder Lager, m, durch welche die Achse L
dieses Drillings laͤuft, gleiten auf ihren eisernen Platten, s', welche mit erhabenen Raͤndern versehen sind,
um diese Kissen zu leiten. Die Bewegung geschieht mittelst der Zahnstoͤke,
v'v, an deren einem Ende sich eine Gabel befindet,
die die Achse L umfaßt, waͤhrend an dem anderen
Ende ein Zahnwerk angebracht ist, welches in den Triebstok des Wellbaumes q'q', eingreift, der auf den Lagern (longrines) befestigt ist, auf welchen die Kissen sich
befinden. Schluͤssel oder eiserne Keile, oo, dienen zur Befestigung der Kissen, und sichern den Wellbaum vor den
Stoͤßen, welche die Kurbel der Saͤge erzeugt, wenn der Drilling K dem Rade II nahe
kommt. Diese Schluͤssel haben einen Knopf und greifen in die Ausschnitte ein,
welche entweder in den Platten s', Uͤber welche
die Kissen m gleiten, oder in den Huͤten p' angebracht sind, die sie in dem oberen Theile
enthalten.
Vorrichtung zur Treibung des Blasebalges.
In allen Werkstaͤtten ist die Bewegung des Blasebalges unabhaͤngig von
jener der Haͤmmer, und wird durch ein anderes Getriebe erzeugt; man kann auf
diese Weise die Gewalt des Windes an dem Blasebalge vermehren oder vermindern, was
aͤußerst nothwendig ist. Hier hatte man nur ein einziges Wasserrad, und man
mußte auf ein Mittel sinnen, mittelst desselben Herr uͤber das Spiel des
Blasebalges zu werden.
An dem Ende der Welle der Haͤmmer, BB, gegen
das Wasserrad AA hin, ist mittelst eines Aufsazes,
n', eine eiserne Achse befestigt, welche zwei
hoͤlzerne Daͤumlinge, V'V', traͤgt,
die abwechselnd auf das Ende eines ersten horizontalen Hebels, U', druͤken, der sich an seinem anderen Ende um
den Bolzen m' dreht. Dieser Hebel theilt seine Bewegung
einem anderen oberen Hebel T', mittelst des
Staͤngelchens, l'l', mit, welches sich um den
Bolzen, i' dreht, und mittelst des Staͤngelchens,
R'R', die Bewegung dem unteren Blatte des
Blasebalges I mittheilt. k'k', wird von einem Zapfen g' durchbohrt, und
frei von einer Gabel h' eines oberen Blasebalgziehers,
S'S', umfaßt, welcher sich um einen Haken j' dreht, und an seinem anderen Ende gegen die Schmiede
hin eine herabhaͤngende Kette traͤgt, an welcher der Hammerschmied
oder sein Gehuͤlfe zieht.
Der Zwek dieser lezten Vorrichtung laͤßt sich leicht begreifen. Wenn der
Hammerschmied die Gabel h' mehr oder weniger hebt, die
an dem Ende des Blasebalgziehers S'S' angebracht ist,
und in dieser Absicht einen Ring der Kette in dem Haken einhaͤngt, der an dem
Pfosten der Schmiede angebracht ist, so hindert es dadurch den Zapfen g' unter diese Gabel herabzusteigen, und folglich den
Hebel U' sich bis zu seiner ganzen Hoͤhe zu
erheben; die Daͤumlinge V'V' lassen folglich
diesen Hebel, und daher auch das untere Blatt des Blasebalges, einen weit
kuͤrzeren Weg durchlaufen, wodurch auch der Wind vermindert wird. Wenn der
Zapfen g' in seiner ganzen Hoͤhe gehoben wird,
wird der Hebel U' hinlaͤnglich tief gesenkt, um
der Wirkung der Daͤumlinge V'V' zu entgehen, so
daß dann die Bewegung des Blasebalges gaͤnzlich aufhoͤrt. Auf
entgegengesezte Weise erhaͤlt aber der Blasebalg mehr oder minder freies
Spiel. Es ist offenbar, daß mit dieser Vorrichtung keine Unbequemlichkeit verbunden
ist, und daß sie ihren Zwek vollkommen erreicht.
Beschreibung der Schere und der Drehebank der Naben.
Die auf Fig. 1
und 5
dargestellte Schere besteht 1tens aus einem starken Hebel R'R', aus geschlagenem Eisen, der sich um einen Bolzen, f'f', dreht, in dessen Naͤhe er etwas diker ist.
Dieser Hebel hat an einem Ende einen Daumen, der sich gegen die Daͤumlinge
des Guͤrtels, D, stuͤzt, und an dem
anderen Ende eine staͤhlerne Schere, die ein Centimeter dik und 5 Centimeter
breit ist, in dem Hebel in gleicher Richtung und Flaͤche eingelassen, und auf
demselben mittelst zweier Bolzen mit eingesenkten Koͤpfen befestigt ist.
2tens, aus einer gegossenen Stuͤze, Q'Q', die den
Bolzen ff traͤgt, und einem Messer, das dem
Hebel R' gleich ist, aber ruhig liegen bleibt. Diese
Stuͤze, in Form eines T, stuͤzt ihren Kopf
auf die Lager (longrines) D'D', in welchen die Einschnitte zur Aufnahme derselben sich befinden. Der
Schweif dieser Stuͤze kommt in den zwischen den Lagern befindlichen Zwischenraum zu
liegen, so daß er unten vorsteht, und einen starken Schluͤssel oder Keil
bildet, der den Kopf gegen dieselben festhaͤlt. Diese Schere, welche 8
Millimeter dikes Eisen schneidet, darf nur weilenweise sich bewegen; man unterbricht
also ihre Bewegung mittelst eines Hebelssystemes, éé, welches demjenigen aͤhnlich ist, das wir bei
Gelegenheit der Haͤmmer beschrieben haben.
Die Drehebank zum Drehen der Naben ist von den gewoͤhnlichen
Drehebaͤnken nur durch einige Nebenvorrichtungen verschieden, die wir nun
beschreiben wollen.
Sie wird von der Welle der Haͤmmer BB, Fig. 1 und 5, mittelst des
Rades HH mit 36 Zaͤhnen bewegt, welches das
Sternrad P', Fig. 5, dreht, das
dieselbe Anzahl von Zaͤhnen fuͤhrt. Dieses Sternrad ist auf einer
eisernen Achse aufgezogen, welche sich der Laͤnge nach in zwei kupfernen
Buͤchsen schiebt, die sie gegen die Enden hin stuͤzen. Auf diese Weise
kann man dasselbe nach Belieben dem Rade HH
naͤhern, oder von demselben entfernen, und die Bewegung der Drehebank
unterbrechen oder beginnen. Haken, die an der Seite der Stuͤke, welche die
Kissen tragen, angebracht sind, hindern, daß das Rad nicht von selbst nach der
Richtung der Achse gleitet, wenn es von den Zaͤhnen des Rades H hinlaͤnglich entfernt, oder denselben
genaͤhert wurde.
Das Sternrad P' treibt den Drilling O', welcher neun hoͤlzerne Spindeln hat; die
eiserne Achse dieses Drillinges traͤgt auf der einen Seite einen Schleifstein
aus Sandstein, N'N', Fig. 1, zum Schleifen der
schneidenden Werkzeuge. Dieser Schleifstein dreht sich in einem Troge aus
Eichendauben, welche von zwei Schrauben-Reifen, H'H',
zusammen gehalten werden, die sie gegen zwei halbkreisfoͤrmige Aufsazbretter
druͤken, welche sich auf die Durchzugbalken des Bodens des Halbgeschosses
stuͤzen. Der Schleifstein erhaͤlt sein Wasser mittelst eines kleinen
senkrechten Paternosterwerkes, welches dasselbe aus einer in der Schmiede
befindlichen Kufe schoͤpft.
Auf der anderen Seite des Drillinges, O, und auf
derselben Achse befindet sich eine große Rolle M',
welche die Schnur L'L' der Drehbank der Naben, A', B', B', aufnimmt. Um diese Schnur in Spannung zu
halten, hat Hr. Segard vorne und etwas uͤber der Drehdank einen Hebel mit zwei
Armen, K'K', angebracht, der an einem Ende eine Rolle
H' fuͤhrt, welche sich gegen die Schnur H'H' stuͤzt; das andere Ende dieses Hebels ist
mit einer Achse l' verbunden, die sich um ihre
zugerundeten Enden dreht. Die kleine Welle G' dient noch
uͤberdieß zur Vermehrung des durch das Gewicht der Rolle H' und ihrer Achsen erzeugten Drukes, und hindert
zugleich, daß die Rolle nicht zu bedeutende Stoͤße erleidet. In dieser
Hinsicht dreht sich die Welle G' mit Reibung in dem
Balken D', der sie traͤgt.
Wenn man den Schleifstein ohne die Drehebank laufen lassen will, darf man nur den
Hebel K' bis an die Hoͤhe des oberen Bodens
heben, und ihn daselbst mittelst des Drehestokes d,
aufhaͤngen, und dann die Schnur, L'L', von der
großen Rolle M' abnehmen. Da es aber auch noͤthig
ist, den Lauf der Drehebank oͤfters augenbliklich zu unterbrechen, hat Hr.
Segard auf der Achse dieser Drehebank zwei Rollen, E'F''
aufgezogen, von welchen die erstere sich mit sanfter Reibung um die Achse schieben
laͤßt, ohne dieselbe mit sich umzudrehen, die andere aber ein vierekiges Auge
fuͤhrt und sich mit der Achse dreht.
Um die Bewegung der Drehebank zu unterbrechen oder beginnnen zu lassen, darf man nur
die Schnur L'L', um die eine oder um die andere Rolle
schlagen, was mittelst des gabelfoͤrmigen Winkelhakens, a'b'c', Fig. 1, 3, 5, leicht geschieht.
Dieser Winkelhaken traͤgt zwei Spulen c'c',
zwischen welchem die Schnur laͤuft, und dreht sich mit seinem Winkel b auf einem an dem Gestelle der Drehebank D'D' befestigten kleinen Bolzen. Der Arbeiter ergreift
den Griff a', der an einem Arme des Winkelhakens
befestigt ist, und hebt und senkt ihn, je nachdem er will, daß die Drehebank laufen
oder still stehen soll; dadurch zwingt er die Schnur, L'L', abwechselnd von einer Rolle auf die andere uͤber zu gehen,
was ohne Schwierigkeit geschieht, indem die Raͤnder dieser Rolle ziemlich
zugerundet sind, und einen ununterbrochenen Vorsprung bilden. Die Rolle E', welche sich mit sanfter Reibung bewegt, wird in
ihrer senkrechten Lage auf der Achse mittelst einer Feder, x'x', erhalten, die aus mehreren elastischen Plaͤttchen besteht,
welche sich mit ihren
Enden gegen den Umfang der Rolle, und gegen den Mittelpunct an einer kleinen
Scheibe, die sich frei um ihre Achse dreht, stuͤzen, und gegen eine
Verstokung enden, die an eben dieser Achse in einer kleinen Entfernung von der Rolle
E, angebracht ist.
Erklaͤrung der Figuren.
Fig. 1.
Grundriß der Werkstaͤtte uͤberhaupt, zu ebener Erde, mit den
Haͤmmern, dem Blasebalge und seinem Getriebe, dem Raͤderwerke der
Saͤge, der Schere und der Drehebank der Nabe.
Fig. 2. Aufriß
des Mechanismus, durch welchen man die Wirkung des Blasebalges nach Belieben
unterbrechen oder maͤßigen kann.
Fig. 3. Aufriß
des Hebels mit den Spulen, um die Drehebank in Bewegung zu sezen oder in Ruhe zu
stellen.
Fig. 4. Aufriß
des Zahnstokes und der Welle, um in den Drilling der Saͤge einzugreifen und
denselben leer laufen zu lassen.
Fig. 5.
Senkrechter Durchschnitt im Aufrisse nach der punctirten Linie A'', B'', C'', D'', E'', F'', G'', H'', der 1ten Figur,
und eines Theiles der in derselben enthaltenen Gegenstaͤnde.
Fig. 6.
Grundriß des Mechanismus zum Saͤgen in gerader und in krummer Linie, wie auch
der Welle, mittelst welcher man das Schuzbrett oͤffnet und schließt.
Fig. 7.
Senkrechter Durchschnitt nach der Linie K''L'' der 6ten
Figur, dieselben Gegenstaͤnde im Aufrisse darstellend.
Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in allen Figuren.
AA, Wasserrad, unterschlaͤchtig und mit 30
Fluͤgeln.
BB großer Wellbaum der Haͤmmer.
C, gegossener Guͤrtel des großen Hammers, mit 6
Daͤumlingen besezt.
D, gegossener Guͤrtel der Schere, mit 2
Daͤumlingen.
E, aͤhnlicher Guͤrtel des kleinen Hammers,
mit 18 Daͤumlingen.
F, großer gegossener Hammer von 168 Kilogrammen Schwere,
ohne uͤbriges Zugehoͤr.
G, kleiner Hammer von gegossenem Eisen, 70 Kilogramme
schwer.
HH, Sternrad mit 36 Zaͤhnen, welches der
Drehebank der Naben und dem Schleifsteine die Bewegung des Wellbaumes BB mittheilt.
II, großes Rad mit 56 Zaͤhnen, welches die
Bewegung des Wellbaumes BB der Kurbel der
Saͤge mittheilt.
I, Blasebalg der Schmiede.
K, Drilling aus Gußeisen mit 13 Spindeln, der von dem
Rade II getrieben wird.
L, eiserne Achse des Drillinges K, die an ihrem Ende M gekruͤmmt
ist.
M, Kurbel der Saͤge.
N, Muschel der Saͤge mit einer kupfernen
Buͤchse zur Aufnahme des Bolzens der Kurbel.
OO, aufgegebene Verlaͤngerung der Achse der
Kurbel.
PP, Schleifstein der an der Verlaͤngerung
OO hatte angebracht werden sollen, um der
Saͤge als Flugrad zu dienen.
QQ, Rahmen der Saͤge.
RR, gefalzte Pfosten fuͤr diese Rahmen, mit
Schluͤsseln von Holz, die als Leiter dienen.
S, Sperrad, mit 360 Kerben und 12 Zapfen zur Bedienung
des Schlittens der Saͤge.
TT, hoͤlzerne Welle, unter dem Boden der
Saͤge, auf welcher das Sperrrad S, aufgezogen
ist.
UU, Drilling mit 8 Spindeln, der gleichfalls auf
der Welle aufgezogen ist, und zur Mittheilung der Bewegung des Sternrades S an den Zahnstok r dient,
welcher an dem Schlitten befestigt ist.
VV, Schwingbaͤume des Schlittens, wovon
einer auf dem Zahnstoke r ruht.
WW, Zahnstok auf dem geraden Schlitten der
Saͤge, um den krummen Schlitten XYZ gehen
zu machen, der die Form des Sectors hat, worauf man den zu Felgen zu
saͤgenden Blok legt.
A', B', C', Doken der Drehebank fuͤr die Naben,
die an ihrem unteren Ende, einen großen Zapfen haben, der sich in den Raum zwischen
den Balken, und dem Rahmen D'D' einfuͤgt. Diese
Doken und ihre Zapfen werden von einem starken Bolzen durchschossen, welcher sich in
eine Schraube verlaͤngert.
D'D', sind Balken, welche der Drehebank als Gestell
dienen, der Schere und dem Drillinge der Saͤge.
E', Rolle mit sanfter Reibung, die auf der Achse der
Drehebank der Nabe aufgezogen ist.
F', eine andere Rolle auf derselben Achse, die die Achse
zugleich mit sich dreht.
G', kleine Welle zur Vermehrung des Drukes des oberen
Hebels R' auf die Schnur, L'L, der Drehebank.
H', Rolle, welche durch ihr Gewicht die Schnur L'L' spannt.
I, Achse des Hebels K',
worauf die vorige Rolle sich befindet.
K'K', Arm dieses Hebels.
L'L', Schnur ohne Ende, wodurch die Drehebank in
Bewegung gesezt wird.
M', große Rolle, welche der Schnur L'L' die Bewegung mittheilt.
N'N', Schleifstein, welcher auf derselben Achse mit der
Rolle N' aufgezogen ist.
O', Drilling mit neuen hoͤlzernen Spindeln, der
seine Bewegung von dem Sternrade P', mit 36
Zaͤhnen erhaͤlt, welches von dem Rade K'H', getrieben wird, das auf dem großen Wellbaume der Haͤmmer, B'B' aufgezogen ist.
Q'Q', Stuͤze der Schere aus Gußeisen in Form
eines T, mit einem eingelassenen Scherenblatte.
R'R', Hebel der Schere aus geschlagenem Eisen,
gleichfalls mit einem staͤhlernen Scherenblatte versehen: er wird von den
Daͤumlingen des Guͤrtels D bewegt.
S'S', Hebel oder gabelfoͤrmige
Blasebalgziehstange uͤber dem Blasebalge I, um
die Wirkung desselben zu unterdruͤken oder zu maͤßigen, je nachdem man
den Zapfen g' mehr oder minder in die Hoͤhe
hebt.
T', oberer Hebel, welcher die Bewegung des
Staͤngelchens
l'l' dem Staͤngelchen k'k' mittheilt, welches mit dem unteren Blatte des Blasebalges I verbunden ist.
U', Hebel oder Ziehstange, welche dem
Staͤngelchen l'l' die Bewegung mittheilt, welche
er von den hoͤlzernen Daͤumlingen, V'V',
erhaͤlt, die auf der Verlaͤngerung des Wellbaumes BB der Haͤmmer befestigt sind, und
abwechselnd auf den Hebel U' druͤken.
X'X' Rolle', welche die Schnur ohne Ende zuruͤk
schikt, die zur Oeffnung des Schuzbrettes in dem oberen Stokwerke der Saͤge
dient.
Y', Welle mit vier Armen v'v, mittelst dessen man diese Schnur bewegt.
Z', hoͤlzerne Trommel, auf welcher sich die
Schnur aufrollt.
a, ehemaliges inneres, jezt aufgegebenes Schuzbrett;
bb, ein Theil des Wasserzuges unter der Schmiede
und dem Blasebalge, I.
cc, Stiel des großen Hammers F.
d, Halsband desselben, welcher den Stoß der
Daͤumlinge des Guͤrtels C auf nimmt.
e, Blok aus Gußeisen, auf einer hoͤlzernen Sohle,
die den unteren Knopf des Halsbandes d
zuruͤkschikt.
ff, Zapfen des Hammers F, der sich gegen zwei gegossene Pfannen stuͤzt.
g, gegossenes und auf dem Stiele des Hammers cc befestigtes Halsband, welches die Zapfen ff aufnimmt.
hhh, hoͤlzerne Doken der Haͤmmer mit
ihren Baͤndern.
ikl, System der Hebel um die Wirkung des Hammers
F zu unterbrechen, und dieselbe nach Belieben wieder
herzustellen.
m, m, Kissen oder kupferne Buͤchsen aus zwei
Stuͤken, welche die Achse L der Kurbel der
Saͤge tragen. Sie gleiten auf den Platten s, und
sind mit einem Hute, p, bedekt.
nn, Hebel mit einem Gewinde, der seine Bewegung
von der Saͤge erhaͤlt, und dieselbe mittelst der horizontalen Achse
dem Stiele des Geisfußes oo,
uͤbertraͤgt, und indem er auf die Zaͤhne des Sternrades S stoͤßt, den Wagen der Saͤge
vorwaͤrts treibt.
pp, Zapfen welche den Querbalken Y festhalten und die Blaͤtter der Saͤge
ww, spannen.
q, Pfosten, auf welchen sich der horizontale Hebel, Z, stuͤzt, welcher die unteren Zaͤume der
Blaͤtter der Saͤge w, w,
traͤgt.
rr, Zahnstok, der an einem Schwingbaume des
Schlittens, vv, angebracht ist, und dessen
Zaͤhne von dem Drillinge, UU, getrieben
werden, der auf der Achse des Stellrades S aufgezogen
ist.
ss, Knechte zur Befestigung des zu
zersaͤgenden Blokes auf dem kreisfoͤrmigen Schlitten XYZ.
t, unterer Zaum der großen Saͤge der dem Hebel
Z als Stuͤze dient.
u, eiserner Zapfen, um welchen sich der
kreisfoͤrmige Schlitten, XYZ, dreht.
v, eiserne Stuͤze fuͤr diesen Zapfen.
ww, Saͤgeblaͤtter zum Schneiden der
Felgen der Raͤder.
xx, hoͤlzerne Stuͤzen mit
Raͤdchen, auf welchen der kreisfoͤrmige Schlitten ruht.
Y, beweglicher Querbalken des Rahmens der
Saͤge.
Z, horizontaler Hebel, welcher die Zaͤume der
Blaͤtter der Saͤge traͤgt, ww.
a'b'c, gabelfoͤrmiger Winkelhaken mit Walzen, um
die Bewegung der Drehebank zu stellen.
d' eisernes Drehekreuz zur Befestigung des Hebels k am Ende der Arbeit.
e'e', Hebelsystem, um die Schere R'R' der Einwirkung der Zapfen des Guͤrtels D zu entziehen.
f', Bolzen, der an der Stuͤze Q'Q', befestigt ist, auf welchen sich die Schere R'R' bewegt.
g', Zapfen, welcher durch die Stange, K'K', laͤuft, die den Blasebalg I, bewegt.
h', an der Ziehstange des Blasebalges, S'S', befestigte Gabel, welche die Stange, K'K', frei umfaßt.
i', an der Mauer befestigter Bolzen, um welchen sich der
Hebel T' dreht.
j' Haken, um welchen sich die Ziehstange S'S' dreht, welche die Wirkung des Blasebalges
unterbricht, oder maͤßigt.
k'k' eisernes Staͤngelchen, welches die Bewegung
des Hebels T' dem unteren Blatte des Blasebalges
mittheilt.
l'l', anderes senkrechtes Staͤngelchen, welches
den Hebel T mit dem Hebel U'
verbindet.
m', Zapfen, um welchen das Ende des Hebels U' sich dreht.
n', eiserner Guͤrtel, welcher die Achse der
Daͤumlinge, V'V', mit dem Zapfen des Wellbaumes
der Hebel, B'B', verbindet.
o'o' eiserne Schluͤssel mit Koͤpfen,
welche die beweglichen Kissen, m', halten und den
Zahnstok, r'r, erleichtern.
p', eiserne Huͤte der Kissen m, welche durch Bolzen mit doppelten Schrauben zusammen
gehalten werden.
q', eiserne Welle mit einem Theile des Triebstokes, der
in den Zahnstok r'r, eingreift, und den Drilling k dem Rade naͤhert, oder von demselben
entfernt.
s, Platten mit Raͤndern, auf welchen sich die
Kissen, m, schieben.
t't', u'u', Schnur ohne Ende, welche das Schuzbrett des
oberen Stokwerkes der Saͤge mittelst der Welle Y'Z', hebt und senkt.
v'v' Arm dieser Welle.
x'x', elastische Blaͤtter, welche die Rolle E' der Drehebank der Naben in einer senkrechten Lage auf
der Achse dieser Drehebank halten. Sie sind an einer Scheibe befestigt, die sich um
diese Achse dreht, und stuͤzen sich an eine Verstaͤrkung.
Tafeln