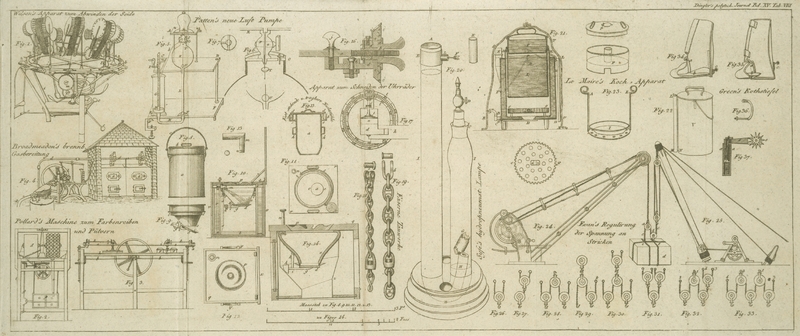| Titel: | Ueber eine neue Luftpumpe. Von Hrn. Joseph H. Patten. |
| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. LXXXV., S. 386 |
| Download: | XML |
LXXXV.
Ueber eine neue Luftpumpe. Von Hrn. Joseph H.
Patten.
Aus dem American Journal of Sciences, in den
Annals of
Philosophy. October 1824. S. 255.
Mit Abbildungen auf Tab.
VIII.
Patten, über eine neue Luftpumpe.
Ich lege hier die Zeichnung einer Luftpumpe vor, welche, wie
ich glaube, so ziemlich den Maͤngeln der gewoͤhnlichen Luftpumpen
abhelfen soll. Der Bau derselben ist so einfach, daß sie nur wenig Geschiklichkeit
oder Kuͤnstlichkeit fordert, um aufgestellt zu werden, und in jedem Falle
weniger Reparatur, als die gewoͤhnlichen Luftpumpen, noͤthig hat. Die
Klappen, welche bei anderen Maschinen so viele Schwierigkeiten veranlassen,
koͤnnen hier groͤßer und staͤrker gemacht werden, wodurch die
Oeffnungen, ohne daß der Grad der Auspumpung hierdurch litte, vollkommner
geschlossen werden koͤnnen. Die Daͤmpfe, die von dem Oehle, welches
bei allen bisherigen Luftpumpen nothwendig ist, aufsteigen, bleiben hier von dem
Recipienten vollkommen ausgeschlossen, und da der leere Raum in dem Auszieher ein
torricellischer leerer Raum ist, so wird auch jener in dem Recipienten sich einem
solchen in dem Maße naͤhern, als die Elasticitaͤt der Luft es nur
immer gestattet. Die glaͤsernen Theile dieses Instrumentes kann man hei jedem
Glashaͤndler finden, und das Faͤßchen (welches aus Glas eleganter
aussieht) kann an jeder Dampfmaschine oder in jeder Gewehrfabrik verfertigt werden,
so wie jeder Uhrmacher im Stande seyn wird dasjenige zu liefern, was an dieser
Maschine aus Messing ist. Beiliegende Skizze, obschon von keinem Adepten in der
Kunst gezeichnet, wird, wie ich hoffe, eine Idee von dieser Maschine geben
koͤnnen. Die Zeichnung stellt einen verticalen Durchschnitt einer Tischpumpe
durch den Mittelpunct derselben dar, mit der Haͤlfte des daran befindlichen
Holzwelkes.
Es sind erst einige Monate, daß ich mich mit dieser Maschine beschaͤftige; das
Faͤßchen, das ich damahls an derselben hatte, war aus Messingblech, und die
Platte der Pumpe aus verzinntem Eisen; die Maschine war nur aus dem Rohen
gearbeitet, und der Auszieher war mit Leinoͤhl gefuͤllt: indessen
uͤbertraf sie doch bei allen ihren Unvollkommenheiten noch immer meine
Erwartung. Ich konnte mir bisher kein eisernes Faͤßchen verschaffen, so sehr
ich mich auch darum bemuͤhte.
Dieselben Buchstaben zeigen in Fig. 5 und 6 dieselben
Gegenstaͤnde an.
In Fig. 5 ist
AB, CD, EF der senkrechte Durchschnitt des Instrumentes;
G, ist ein Faͤßchen aus Gußeisen oder aus
Glas, welches fest auf der Tafel EF,
niedergeschraubt ist. Der dichte Staͤmpel, H,
bewegt sich in demselben mittelst des Zahnstokes I. K,
ist eine glaͤserne Kugel, welche auf der Tafel CD, ruht, und von etwas kleinerem Inhalte, als das Faͤßchen G, mit welchem es durch die glaͤsernen
Roͤhren L und M in
Verbindung steht, die in das Stuͤk N, fest
eingekittet sind, und in den Boden des Gefaͤßes G. Oben auf der Kugel K, ist die dike Kappe, O, aufgekittet, in welcher sich zwei Oeffnungen
befinden: in einer dieser Oeffnungen ist der Sperrhahn, P, eingeschraubt, der mit der Platte der Pumpe, R, in Verbindung steht; uͤber der anderen Oeffnung ruht die Klappe,
S, die sich in die Luft oͤffnet. Fig. 6 zeigt
diesen Bau deutlicher. In der Kugel, K, ist ein steifer
Draht, der etwas in den Hahn P hinauf steigt, und an
demselben ist die Klappe T, angeschraubt. Das andere
Ende des Drahtes steigt in die Roͤhre L, und an
ihr ist die Kugel U, aus Holz oder aus Kork, befestigt.
Wir wollen nun annehmen, daß der Staͤmpel H,
weggenommen, und das Faͤßchen G, mit Queksilber
gefuͤllt ist: wenn man die Roͤhren L und
M oͤffnet, so werden sie sich bis zur
punctirten Linie mit Queksilber fuͤllenDie aber in der Zeichnung fehlt. A. d. Ueb.. Man bringe nun den Staͤmpel so auf das Queksilber, daß zwischen
diesem und demselben keine Luft eingeschlossen ist. So wie der Staͤmpel niedergedruͤkt
wird, wird das Queksilber in die Hoͤhe steigen, und, wenn es die Kugel U, erreicht hat, diese auf seiner Oberflaͤche
schwimmen lassen. Diese Kugel wird mittelst des Drahtes die Klappe T, gegen jene Oeffnung hinauf stoßen, welche mit dem
Recipienten, R, in Verbindung steht; und da das
Queksilber fortfaͤhrt zu steigen, so hat die vor demselben hergetriebene Luft
keinen anderen Weg zu entweichen, als durch die Klappe S. Nun befindet sich der Staͤmpel an dem Boden des Faͤßchens,
und die Kugel ist voll Queksilber, wenn aber der Staͤmpel wieder in die
Hoͤhe gezogen wird, bildet sich ein leerer Raum in dem Faͤßchen, und
daß Queksilber in der Kugel muß, da es uͤber dem Staͤmpel in der
Hoͤhe von T sich befindet, herabsteigen, und in
der Kugel K, wuͤrde ein Torricellischer Raum sich
bilden, wenn nicht eine Verbindung zwischen derselben und dem Recipienten, R, Statt haͤtte. Wenn das Queksilber wieder in
die Kugel hinaufgetrieben wird, so treibt es alle in derselben enthaltene Luft
hinaus, sobald es bis S emporgestiegen ist. Damit aber
dieß geschehen kann, ist die Kappe O mit einem Rande
versehen, so daß immer der Zusammenziehung nachgeholfen, und am Ende der Ausziehung
die Klappe S mit dem Finger gehoben werden kann. Die
Luft wird, wie Fig.
7 im Durchschnitte zeigt, durch ein Loch a in
dem Hahne P eingelassen. Die Kappe O muß stark, und, wo sie aus Messing ist, mit einem
Glaskitte, so wie man denselben bei nautischen Maschinen braucht, uͤberzogen
seyn. Der Maßstab kann an der Kappe angebracht, oder in dem Recipienten
eingeschlossen seyn.
Der steife Draht mit der Klappe T, und der Kugel U, kann gaͤnzlich wegbleiben, und an der Stelle
desselben kann man eine glaͤserne, an beiden Enden offene, und in den Hahn
P, eingekittete Roͤhre anwenden, die beinahe
bis an den Boden der Kugel reicht. Das Queksilber wird, wenn es bis an das untere
Ende dieser Roͤhre gekommen ist, die Verbindung mit dem Recipienten
absperren. Dieß ist vielleicht der beste und einfachste Plan. Es kann auch, wenn man
die Kappe O mit dem Faͤßchen G verbindet (nach der punctirten Linie b), eine doppelte Pumpe angebracht werden, deren eine
Klappe sich einwaͤrts, die andere auswaͤrts, oͤffnet. Da die
Maschine klein ist, so
kann die Schwere derselben nicht als Einwurf gegen diese Einrichtung vorgebracht
werden: die Kugel hat bloß 4 Zoll im Durchmesser: das Faͤßchen ist 8 Zoll
hoch, und die ganze Hoͤhe der Maschine; bis zur Platte R, betraͤgt 15 bis 20 Zoll.
Tafeln