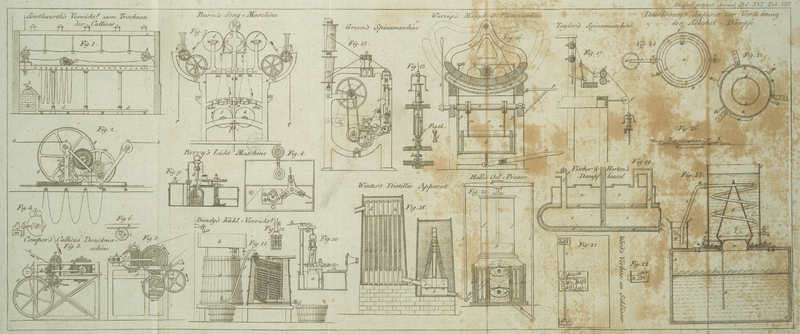| Titel: | Anti-Evaporations-Abkühler zur Erleichterung und Regulierung des Abkühlens der Würze in allen Jahres-Zeiten, zwischen jedem Grade der Siedehize und der zur Gährung nöthigen Wärme, worauf Wilh. Burdy, mathematische Instrumenten-Macher zu Fulham, Middlesex, am 1. November 1823 sich ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. LXXXVIII., S. 432 |
| Download: | XML |
LXXXVIII.
Anti-Evaporations-Abkühler zur Erleichterung und
Regulierung des Abkühlens der Würze in allen Jahres-Zeiten, zwischen jedem Grade der
Siedehize und der zur Gährung nöthigen Wärme, worauf Wilh. Burdy, mathematische Instrumenten-Macher
zu Fulham, Middlesex, am 1.
November 1823 sich ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Jan. 1825
S. I.
Mit Abbildungen auf Tab.
VIII.
Burdy's Anti-Evaporations-Abkühler etc.
Dieser Apparat besteht aus einer Reihe von Roͤhren,
welche aus einer Hauptroͤhre entspringen, und durch welche die heiße
Fluͤßigkeit laͤuft. Diese Roͤhren sind in einer Kufe oder in
einem Fasse eingeschlossen, und mit kaltem Wasser umgeben; um den Waͤrmestoff
der Wuͤrze zu entziehen, waͤhrend dieselbe durch diese Roͤhren
laͤuft, wodurch sie sich sodann auf den gehoͤrigen Grad
abkuͤhlt.
Dieser Apparat kann sowohl in Hinsicht seiner Form als seiner Groͤße
verschieden abgeaͤndert werden. Fig. 11, zeigt eine
bequeme Zusammenstellung, desselben. Die Figur weiset nur zwei Faͤsser; es
koͤnnen aber deren mehrere angewendet werden, die mit Wasser gefuͤllt
sind, und von denen jedes eine Reihe von Kuͤhlroͤhren enthaͤlt,
die oben aus einer gemeinschaftlichen Hauptroͤhre entspringen, und unten in
eine gemeinschaͤftliche Hauptroͤhre sich enden. In A, sind eben solche Roͤhren enthalten, wie in B, welches im Durchschnitte dargestellt ist. Die
Wuͤrze laͤuft aus dem Kessel durch den Hahn, a, in den Hopfentrog, b, ab
, und gelangt aus diesem, nachdem sie daselbst durchgeseihet wurde, durch den
Hahn, c, in die Vertheilungs-Buͤchse, d, welche in Fig. 12, abgesondert
dargestellt ist. Aus dieser Buͤchse laufen mehrere Roͤhren (vielleicht
16) aus, und winden sich in concentrischen Kreisen, wie man bei B, sieht, in soviel moͤglich gleicher Neigung: am Ende
vereinigen sie sich, alle unten in einen Hauptstamm.
Die Roͤhren in diesem Fasse, 11 an der Zahl, sind in 5 Kreise gewunden, werden
in die Runde gebogen, und eine uͤber der anderen in die bequemste schiefe
Neigung gebracht. Jede Roͤhre wird von kleinen Zapfen an der Seite der
hoͤlzernen Stuͤzen getragen, und alle werden soviel moͤglich
unter gleichem Winkel angelegt, wie B zeigt: die Lage
der Roͤhren ist in allen Faͤssern oder Kufen, soviel derselben seyn
moͤgen, dieselbe. Die zweite Reihe von Roͤhren, (die in B), leitet die
Wuͤrze in das dritte Faß, wenn man ein solches braucht, oder in die
uͤbrigen Gefaͤße.
Wenn man annimmt, daß die Wuͤrze in dem Hopfentroge beinahe siedend heiß ist,
so wird sie, nach der oben beschriebenen Einrichtung an dem Boden von A durch den Hahn, e,
kuͤhl herauskommen. Wenn sie noch nicht hinlaͤnglich abgekuͤhlt
waͤre, muß der Hahn bei, e, geschlossen werden,
und sie muß durch die Roͤhre, f, in die
Vertheilungs-Buͤchse, g, hinauf in die zweite
Roͤhrenreihe, B, und endlich in die
Haupt-Roͤhre, h, in welcher alle Roͤhren
sich vereinigen. Wenn die Wuͤrze dann hinlaͤnglich abgekuͤhlt
ist, fließt sie durch den Hahn, i, zu den weiteren
Bearbeitungen derselben ab.
Das kalte Wasser wird in das Faß, B, durch den mittleren
Stamm, R, bis auf den Boden des Gefaͤßes
hinabgeleitet, wo es, nachdem es warm geworden ist, in die Hoͤhe steigt, und
durch eine Rinne, l, in das Faß. A, uͤberfließt, in welchem es auf die heißeste Wuͤrze wirkt,
und oben wieder auslaͤuft. Auf diese Weise wird viel Wasser erspart, indem
das kalte Wasser in dem zweiten Fasse den Abkuͤhlungs-Proceß vollendet, der
schon im ersten anfingWenn man die Schlangenroͤhren in Branntweinbrennereien mit Recht
verwarf, weil sie sich nicht gehoͤrig reinigen lassen, so Muß dieß
hier noch weit mehr der Fall seyn. Es ist beinahe unmoͤglich, daß das
auf diese Weise gekuͤhlte Bier nicht sauer werden soll. A. d. Ueb.
Tafeln