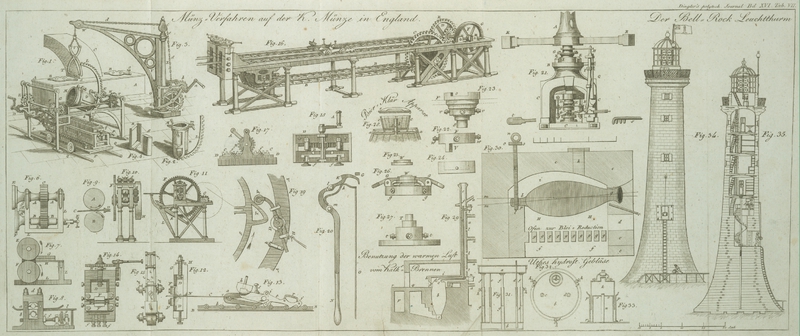| Titel: | Beschreibung eines Verfahrens, eine Baumwollen-Spinn-Mühle mittelst der Hize zu heizen, welche beim Kalkbrennen erzeugt wird. Von T. Bewley, Esqu. zu Montrath in Ireland. |
| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. CIV., S. 483 |
| Download: | XML |
CIV.
Beschreibung eines Verfahrens, eine
Baumwollen-Spinn-Mühle mittelst der Hize zu heizen, welche beim Kalkbrennen erzeugt
wird. Von T. Bewley,
Esqu. zu Montrath in Ireland.
Aus den Transactions of the Society for Encouragement of Arts,
etc. im Repertory of Arts, Maͤrz 1825. S.
229.
Mit einer Abbildung auf Tab. VII.
Bewley's, Verfahren eine Baumwollen-Spinnmühle mittelst der Hize zu
heizen, welche beim Kalkbrennen erzeugt wird.
Nachdem Hr. Bewley die Zeugnisse auffuͤhrte, durch welche er erweist, daß
er seit mehreren Jahren sich dieser Vorrichtung zur Heizung seiner
Spinnmuͤhle mit Vortheil bedient, liefert er die Beschreibung und Abbildung
seines Apparates, wofuͤr ihm die Society die große silberne Medaille
zuerkannte.
a, a, a, a, a, Fig. 29, Tab. VII. sind
die verschiedenen Stokwerke der Muͤhle.
b, ist ein Kalkofen, in welchem Kalt gebrannt wird.
c, ist ein Dekel aus Gußeisen auf dem Kalkofen, aus
welchem eine Roͤhre, dd, aus Gußeisen
aufsteigt, welche den Rauch und die Daͤmpfe aus dem Kalkofen ableitet.
e, der Schornstein.
k, die Oeffnung der Roͤhre, d, um welche der Schornstein ringsumher gehoͤrig
verschlossen ist.
g, Oeffnung in den Kalkofen, durch welche die Steine
etc. hineingeworfen werden, und die mit einer Thuͤre aus starkem Eisenbleche
verschlossen ist.
hh, eine Ziegelmauer, welche den Dekel, c, umgibt.
i, eine Deke aus Ziegelsteinen, die mittelst eiserner
Stangen auf der Mauer, h, ruht.
k, eine der verschiedenen Oeffnungen am Grunde der
Mauer, h, durch welche der Luft Zutritt gestattet
wird.
llll, Oeffnungen in dem Schornsteine, e, um die erhizte Luft in die verschiedenen Stuben des
Gebaͤudes einstroͤmen zu lassen: diese Oeffnungen sind mit Schiebern
versehen, um die Menge der zustroͤmenden warmen Luft zu reguliren.
m, eine Oeffnung in dem Schornsteine, e, welche durch eine eiserne Thuͤre verschlossen
werden kann. Diese Thuͤre wird nur geoͤffnet, ehe man das Feuer in dem
Ofen anschuͤrt, um die Roͤhre, d, zu
reinigen, welche Reinigung dadurch geschieht, daß man ein Seil mit einem daran
befestigten Gewichte, woran Stroh, oder irgend etwas angebunden ist,
hinablaͤßt.
n, eine andere Oeffnung in dem Schornsteine, e, gleichfalls durch eine eiserne Thuͤre
geschlossen; auch diese dient bloß zur Reinigung der horizontalen Roͤhre, d, die hier eine Kappe oder einen Dekel hat, welcher
gelegentlich abgenommen werden kann.
o, das Auge oder die Oeffnung am Grunde des Ofens zum
Ausnehmen des Kalkes.
p, ein Raum, der das Gebaͤude umgibt.
q, ein Floͤz zum Brechen der Steine und
Einfuͤllen des Ofens, der gleich hoch mit r, oder
dem Hofe um das Gebaͤude ist.
ss, die Deke des Kalkhauses.
Bemerkungen.
Diese Methode zu heizen, und die Luft zu reinigen, ist vorzuͤglich bei
Fabriken, Gefaͤngnissen, Treibhaͤusern, und uͤberhaupt uͤberall, wo eine
staͤte und gleichfoͤrmige Hize unterhalten werden soll, anwendbar. Der
Kalk wird waͤhrend 24 Stunden zwei Mahl aus dem Ofen geholt (Morgens und
Abends), wo dieser dann neuerdings mit Kalksteinen und Steinkohlen gefuͤllt
wirdWenn der Ofen in einem groͤßern Maaßstabe ausgefuͤhrt wird,
dann kann man statt Steinkohlen mit großem Vortheile als Feuer-Material Tors
anwenden. D.. Wenn noch mehr staͤte Hize gefordert werden sollte, kann der Kalk
drei bis vier Mahl in 24 Stunden ausgenommen werden, wo man dann
verhaͤltnißmaͤßig duͤnnere Lagen von Steinen und Kohlen
eintraͤgt. Es ist offenbar, daß hier gleiche Hize bei Tage, wie bei Nacht,
unterhalten wird, was beinahe uͤberall, wo man Waͤrme noͤthig
hat, hoͤchst wichtig ist, um so mehr, als hier die Zeit erspart wird, die des
Morgens, ehe auf die gewoͤhnliche Weise eingeheizt wird, verloren geht, und
aller Apparat an Maschinen und Materialien zur Verhuͤtung eines Wechsels in
der Temperatur erspart wird. Fuͤr Leute, die arbeiten muͤssen,
vorzuͤglich fuͤr Kinder, ist es bei kaltem Wetter sehr angenehm, wenn
sie am Morgen ihre Arbeits-Stube gut geheizt, und sich dadurch zugleich veranlaßt
finden, fruͤhe zu ihrer Arbeit zu gehen.
Ein anderer hoͤchst materieller Vortheil bei dieser Vorrichtung besteht in der
großen Sicherheit bei derselben: es ist durchs aus unmoͤglich, wie aus der
Zeichnung erhellt (wo das Werk anders gehoͤrig ausgefuͤhrt wird), daß
hier der mindeste Unfall durch Feuer, oder die geringste Unbequemlichkeit durch
Rauch entsteht: die Roͤhre, dd, fuͤhrt alle Funken ab, allen Rauch,
jeden Geruch; es kommt nichts in die Stuben, als die warme Luft, die bei einer der
Oeffnungen, k, eintritt, von da um und uͤber den
Dekel, c, laͤuft, und um die Außenseite der
Roͤhre, dd, spielt, wodurch sie bis auf
einen hohen Grad erhizt wird, und mit großer Heftigkeit bei den Oeffnungen, llll, in die verschiedenen Stuben
einstroͤmt.
Es kann hier ferner, was sehr wichtig ist, das schlechteste Feuer-Material, (Culm, Cinders) zum Heizen verwendet werden, das man zu
nichts anderen brauchen kann.
Der groͤßte Vortheil dieser Methode besteht aber in der außerordentlichen Wohlfeilheit, oder vielmehr in dem Netto-Ertrage derselben. Kalk ist ein Artikel, den man uͤberall
braucht, und es ist kaum denkbar, daß man nicht uͤberall den Kalk sollte so
absezen koͤnnen, daß er die Kosten des Brennens verguͤten, und noch
einen kleinen Gewinn abwerfen muͤßte.
Um große Stuben zu heizen, braucht man nicht mehr Hize, als bei dem Kalkbrennen auf
eine unvermeidliche Weise uͤberfluͤßig erzeugt werden muß. Die
Spinn-Muͤhle, zu welcher diese Zeichnung gehoͤrt, hat 5 große Gruben,
von welcher die untere allein nicht geheizt werden darf: jede Stube ist
ungefaͤhr 50 Fuß lang und 20 breit. Die heiße Luft, wo sie unmittelbar in die
Stuben eintritt, macht das Thermometer oͤfters bis auf 140 Grade F. +
43° R) bei den Oeffnungen, llll, steigen; die
Temperatur in den Stuben selbst ist gewoͤhnlich 80° (F. + 26,67 R.).
Der Kalkofen ist klein, nur 11 Fuß tief, und in seiner groͤßten Breite 7 Fuß
weit; es wuͤrde aber eintraͤglicher seyn, denselben, wo es die
Umstaͤnde erlauben, noch tiefer zu bauen. Ehevor kostete die Heizung dieser
Muͤhle jaͤhrlich eine bedeutende Summe; nun traͤgt sie
jaͤhrlichen Gewinn, und die Art der Heizung selbst ist mit weit weniger
Unannehmlichkeiten verbunden.
Wo kein Kalk zu haben ist, kann man Ziegel etc. brennen; in diesem Falle brauchte man
aber zwei Oefen, die in einen Schornstein laufen, so daß, waͤhrend man in den
einen einsezt, man den anderen im Brande haͤlt.
In mehreren Gegenden koͤnnte Thon zu Duͤnger mit dem groͤßten
Vortheile gebrannt werden.
Zur Heizung von Gefaͤngnissen, Arbeitshaͤusern etc.Wir zweifeln sehr, daß man bei uns an oͤffentlichen Anstalten von
dieser Heiz-Methode Gebrauch machen wird; denn die Administratoren derselben
gewinnen in dem Masse, als viel Holz verbraucht wird. Wir erinnern uns noch
sehr wohl, wie einer der ersten Halurgen Europens vor ungefaͤhr 30
Jahren vorzuͤglich mit dem Forst-Departemente zu kaͤmpfen
hatte, weil er durch seine verbesserte Methode Salz zu sieden,
auf der ihm anvertrauten Saline jaͤhrlich an 4000 Klafter Holz
Ersparung auswies. Private, in deren Haͤusern ohne dieß
taͤglich ein starkes Feuer unterhalten werden muß, Brauer,
Baͤker, Branntweinbrenner etc. koͤnnen indessen von dieser
Vorrichtung Vortheil ziehen. Wir haben in Baiern, auch wenn man bei uns
durchaus nicht will, daß Fabriken gedeihen sollen, doch sehr noͤthig
jedes Pfund Holz zu sparen, wenn wir, bei der Unwirthschaftlichkeit, mit
welcher wir dasselbe in unseren Kacheloͤfen verschwenden, nicht bald
die lezte Quelle eines activen Ausfuhr-Handels, Holz, und damit auch den
lezten Haͤller, den wir noch aus dem Auslande beziehen
duͤrfen, verlieren sollen. A. d. Ueb. koͤnnte diese Vorrichtung mit vielem Vortheile verwendet werden; denn
außerdem, daß sie den Straͤflingen etc. Beschaͤftigung gibt, gibt sie
zugleich auch Ertrag.
Tafeln