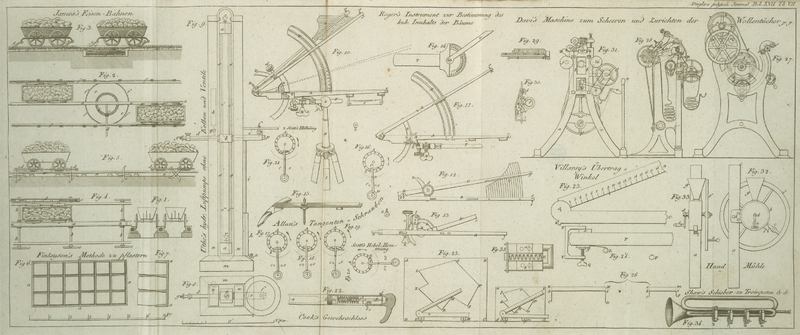| Titel: | Die hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben und Ventile. |
| Autor: | Johann Andreas Uthe [GND] |
| Fundstelle: | Band 17, Jahrgang 1825, Nr. LVII., S. 272 |
| Download: | XML |
LVII.
Die hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben und
Ventile.
Von J. A. Uthe.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Uthe's hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben und
Ventile.
Im Jahre 1817, wo ich mich viel mit der Ausbildung der
Gasapparate beschaͤftigte, und wo der suͤße Wahn mich lange gefangen
hielt, meinem Vaterlande die Vortheile des Gas-Lichtes zu Theil werden zu
lassen, bezwekte ich auch – fruͤher noch als die Englaͤnder
transportable Gaslampen. Um aber die Gase in diesen Lampen mir Bequemlichkeit zu
comprimiren, entwarf ich mir folgende Vorrichtung zu einer Luft- und
Gas-Pumpe; die einzelnen Theile dazu wurden auch sogleich bearbeitet, und
theilweise zusammen gerichtet; die Vollendung aber, blieb aus folgenden
Gruͤnden dem vorigen Jahre aufgehoben.
1) War die ganze Struktur noch nicht geeignet meine Anforderungen in jeder Hinsicht
zu befriedigen, indem die Wirkung bloß partiell war, wie bei der
gewoͤhnlichen Kolbenpumpe; ich entwarf daher eine zweite Struktur, deren
Wirkung perpetuell, und meinen Anspruͤchen genuͤgte. 2) Da meine
schoͤnen Traͤume in Betreff der Gasbeleuchtung wie Spreu zerstoben, so
warf ich in Unmuth auch diese Dinge bei Seite; im vorigen Jahre aber, wo ich die
erstere Vorrichtung zu hydraulischen Versuchen benuͤzen wollte, wurde sie
ganz zusammen gebauet.
Da mir nun vor einigen Wochen eine aͤhnliche Vorrichtung von Hrn. Dr. Romershausen (in Kastner's Archiv) in die
Haͤnde kam, so entschloß ich mich vergleichsweise, auch meine Struktur dem
wissenschaftlichen Publikum mitzutheilen. Ob Hr. R. die Seinige wirklich
ausgefuͤhrt, hat er nicht ausgesprochen; ich will daher aus Ruͤksicht
fuͤr diejenigen, welche jene Beschreibung nicht kennen, die Meinige hier
folgen lassen.
Fig. 8 und
9. stellt
die Maschine im Grund- und Aufriße dar; aa,
sind zwei Gefaͤße, wovon das untere mit Queksilber gefuͤllt wird;
diese Gefaͤße stehen durch die 4 Roͤhren, c, in Communication so, daß eine Wechselwirkung entsteht, und zwar auf
folgende Weise: b, ist ein Hahn, in dessen
Gehaͤuse die Roͤhren, c, luftdicht
eingesezt sind; der Hahn selbst, welcher fest steht, ist schief durchbohrt, wie die
punktirten Linien zeigen; die Roͤhren kommen daher untereinander in folgende
Verbindungen: c' mit c'''',
c'' mit den Einlaßrohre e, und c''' mit dem Auslaßrohre, d.
Wird nun der Apparat umgedreht so, daß das untere Gefaͤß, a, oben kommt, was in sofern moͤglich ist, indem
der Hahn, b, die Achse, und sein Gehaͤuse die
Nabe bildet, so wird dieselbe Wechselverbindung unter den Roͤhren, wie zuvor,
Statt finden.
Will man nun einen luftleeren Raum erzeugen, so ist die Wirkung folgende: Zuerst
denke man sich auf dem Teller, f, eine Gloke und dann
das untere Gefaͤß, a, oben in dem Augenblik, wo
es hinauf gedrehet wurde, so wird das Queksilber aus diesem Gefaͤße durch die
Roͤhren, c' und c'''', in das untere Gefaͤß gelangen, indem es in das Rohr, c'', nicht fallen kann, weil dieses bis nahe an den
obern Boden des Gefaͤßes hinauf reicht. Der Raum, welchen das Queksilber in
dem Gefaͤße einnahm, muß nun mit Luft angefuͤllt werden, welche aus
der Gloke durch die Roͤhren, c und c'' angezogen wird; im Gegentheile wird aus dem untern
Gefaͤße die Luft durch das Queksilber ausgetrieben, und zwar durch die
Roͤhren, c''' und d,
indem das Rohr, c'''', bis nahe an den Boden des
Gefaͤßes, a, hinabreicht, und so die Oeffnung
dieser Roͤhre durch das herabfallende Queksilber sogleich gesperrt wird,
mithin der Luft kein
anderer Ausweg bleibt, als c'''. Der Wechsel dieser
Gefaͤße wird nun fortgesezt, bis das Evacuum unter der Gloke vollkommen
ist.
Will man aber Luft oder Gase comprimiren, so wird bei f,
das Rohr, welches die Gase aus den Gasometer herbei fuͤhrt, angeschraubt, und
bei g, das Gefaͤß, welches man fuͤllen
will, und die Manipulation ist dieselbe, das heißt, ist das Queksilber
herabgefallen, so wird das untere Gefaͤß so oft hinauf gedreht, bis die Luft
oder die Gase den Grad der Compression erreicht haben, den man ihr zu geben
gedenket, welches man sogleich an dem Queksilberstande in den Roͤhren
abnehmen kann. Mein Apparat ist 60'' par. hoch; ich kann daher einen Druk von 2
Atmosphaͤren erreichen; braucht man mehr, so darf man nur die Roͤhren,
c, so lang machen, daß die Hoͤhe der
Queksilbersaͤule dem gewuͤnschten Druke entspricht.
In der Roͤhre, c'''', bleibt stets etwas
Queksilber stehen, und um so mehr, je weiter die Arbeit vorgeschritten ist; dieses
faͤllt nun, wenn die Roͤhre, c'''', oben
zu stehen koͤmmt, in das Rohr, e, herab; in
diesem darf es aber nicht stehen bleiben, weil es nicht allein aus der Oeffnung auf
den Teller ausfließen, sondern weil es auch der Luft oder den Gasen den Weg
versperren wuͤrde; es ist daher das Rohr, i,
angebracht, welches in das Gefaͤß, h, eintaucht
bis nahe auf den Boden, in dieses Gefaͤß, h,
faͤllt nun waͤhrend der ganzen Arbeit das Queksilber, welches aus dem
Rohr, c'''', heruͤber gebracht wird, herab, und
sperrt so von selbst das Rohr, i. Merkt man, daß sich
hier ein großer Theil angesammelt, so wird es unten durch den Hahn, x, abgelassen, und durch den Trichter, r, wieder in das Gefaͤß, a, eingebracht; wenn man aber comprimirt, so muß dieses durch den oberen
Trichter, o, eingefuͤllt werden. Auch habe ich
noch ein kleines Magazin an der Seite bei k, angebracht,
wodurch man stets durch Oeffnen des Hahnes, q, den
kleinen Queks. Abgang ersezen, und das Gefaͤß, a,
voll erhalten kann; dieses macht dann den unteren Trichter, r, uͤberfluͤßig. Daß jeder Ausgang einen Hahn haben, so, wie des Queksilbers
wegen alles Metall Eisen seyn muß, versteht sich wohl von selbst.
Zu den Gefaͤßen, a, und den Roͤhren, c und i, habe ich Glas
genommen, und dieses gewaͤhrt den Vortheil, daß ich stets beobachten kann,
wie weit die Arbeit vorgeschritten; denn steht das Queksilber in der Roͤhre,
c'''' 28'' hoch, so bin ich uͤberzeugt, daß
die Luftleere vollkommen ist. Die Roͤhren c,
haben 3''' Diam.; sowohl eine kleinere als groͤßere Weite bringen
Nachtheil.
An den Hahngehaͤuse, b, sind eiserne Schienen fest
gemacht, welche durch die punktirten Linien, s,
angedeutet sind, diese umfassen und tragen die Queksilbergefaͤße, a.
m, ist der Fuß, und n, zwei
Saͤulen von Holz, zwischen welchen sich der Apparat drehet.
Ob gleich dieser Apparat einfach erscheint, und es auch wirklich ist, so ist doch
dessen Ausfuͤhrung nichts weniger als leicht zu nennen; indem alles von Eisen
und Stahl und mit der allergroͤßten Genauigkeit ausgefuͤhrt seyn muß;
ist die Arbeit aber vollkommen gelungen, so kann man mit weit mehr Bequemlichkeit,
als mit der Kolbenpumpe arbeiten; ja ein Kind kann ihn dirigiren.
Spaͤter habe ich durch Kastner in seiner Physik erfahren, daß schon Hindenburg
sich einer hydrostatischen Luftpumpe bedient! wie diese aber gestaltet gewesen, habe
ich troz aller Muͤhe nicht ausmitteln koͤnnen.
Sobald Zeit und Umstaͤnde es zulassen, werde ich auch die zweite. Struktur
vollenden, welche eben so einfach, ohne Kolben und Ventile durch ihre perpetuelle
Wirkung groͤßeres Interesse und allgemeineren Nuzen verspricht; ist dieses
geschehen, dann werde ich mir auch die Erlaubniß nehmen, sie dem Publikum
vorzulegen.
Dresden im Mai 1825.
Tafeln