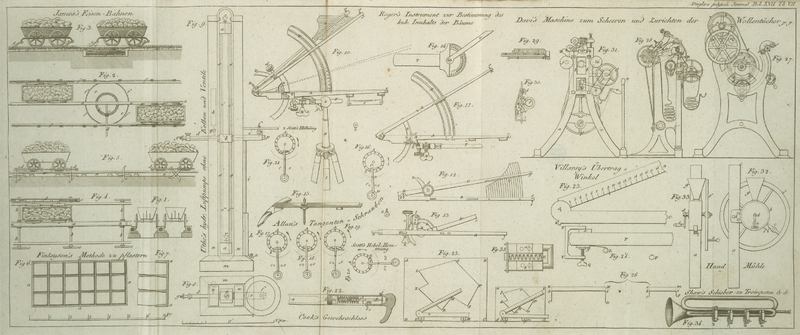| Titel: | Verbesserung an den Maschinen zum Scheren und Zurichten der Wollen-Tücher und anderer Zeuge, die dieser Bearbeitung bedürfen, und worauf Wilh. Davis, Mechaniker zu Bourne in der Grafschaft Gloucester, und zu Leeds, in der Grafschaft York, am 24. Jul. 1823. sich ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 17, Jahrgang 1825, Nr. LXIV., S. 301 |
| Download: | XML |
LXIV.
Verbesserung an den Maschinen zum Scheren und
Zurichten der Wollen-Tücher und anderer Zeuge, die dieser Bearbeitung bedürfen,
und worauf Wilh. Davis,
Mechaniker zu Bourne in der Grafschaft Gloucester, und zu Leeds, in der Grafschaft York,
am 24. Jul. 1823. sich ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts, Mai. 1825. S.
290.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Davis's, Verbesserung an den Maschinen zum Scheren und Zurichten
der Wollen-Tücher und anderer Zeuge.
Diese Verbesserungen beziehen sich auf das Scheren, und auf
das Rauhen und Zurichten. Die verbesserte Tuchscher-Maschine ist so
eingerichtet, daß sie das Tuch sowohl der Laͤnge als der Breite nach scheren
kann, und daß Eine Maschine Tuͤcher von jeder Breite zu scheren vermag. Die
Zuricht-Maschine ist eine Abaͤnderung der gewoͤhnlichen sogenannten
Gig-Muͤhle, und dient sowohl zum Rauhen oder Aufrichten des Haares vor
dem Scheren; als zum Niederlegen desselben nach dieser Operation, und besteht aus
einer Reihe von Karden-Walzen, die schnell gegen die Oberflaͤche des
Tuches hinlaufen, um das Haar niederzulegen (lay the
nap) und die Oberflaͤche des Tuches glatt zu machen.
Fig. 27.
zeigt die Maschine zum Rauhen vor dem Scheren von dem Ende her gesehen. Die
Verbesserung besteht darin, daß statt der feststehenden Karden (teashes) an der gewoͤhnlichen Gig-Trommel
eine Reihe sich umdrehender Karden-Walzen gebraucht wird. a, ist die Hauptachse der Maschine, welche durch eine
Dampf-Maschine oder durch irgend eine andere Triebkraft in Bewegung gesezt
wird. Nahe an den beiden Enden dieser Hauptachse sind die zwei kreisfoͤrmigen
Platten, b, angebracht, welche die Achsen der
verschiedenen Walzen, ccc, fuͤhren, die mit
den, Karden bedekt sind. An den Enden dieser Walzen befinden sich Zahnraͤder,
die in die Zaͤhne eingreifen, mit welchen der innere Umfang des Ringes, d, besezt ist. So wie die Hauptachse mit den Endplatten
sich dreht, werden die Walzen, c, herumgefuͤhrt,
und, da der gezaͤhnte Ring, d, fest steht, werden
dadurch die Walzen, c, um ihre Achsen gedreht. e und f, sind zwei
Aufhalt-Walzen (retarding-rollers) in
einem Gestelle, zwischen welchen das Tuch durchlaͤuft. Die Lage dieser
Aufhalt-Walzen kann mittelst des Triebstokes, g,
und des Zahnstokes, an welchem das Gestell befestigt ist, nach Belieben
veraͤndert werden.
Von diesen Aufhalt-Walzen steigt das Tuch abwaͤrts unter die
Gig-Trommel herab, wo die Oberflaͤche desselben von den
Karden-Walzen bearbeitet wird; dann aufwaͤrts zur Walze, h, unter welcher dasselbe durchlaͤuft, und von
den zwei kleineren Walzen, ii, daran
angedruͤkt wird. Ueber diese wird das Tuch geleitet, und von dort hinter der
Maschine auf den Boden fallen gelassen, oder auf einer Aufnahms-Walze
aufgerollt.
Auf der Haupt-Achse befindet sich ein Trommel-Rad, von welchem ein Band
uͤber das Rad, k, laͤuft, welches,
mittelst eines Triebstokes auf seiner Achse, das Zahnrad, l, treibt, das an der Achse des Cylinders, h,
befestigt ist. Das uͤber diese Walze gefuͤhrte Tuch wird an dem
Umfange desselben mittelst der Drukwalzen, ii,
gespannt erhalten, und langsam durch die Umdrehung der Walze vorgezogen,
waͤhrend der Gig durch sein Umdrehen die Karden-Walzen sich schnell in
entgegengesezter Richtung drehen, und das Haar des Tuches aufrichten laͤßt,
so wie lezteres vorwaͤrts kommt.
Das Umdrehen der Karden-Walzen kann durch Reibung, statt durch
Triebstoͤke, bewirkt werden, die in den gezaͤhnten Ring eingreifen. Um
die Floken und andere Uneinigkeiten aus dem Tuche wegzunehmen, ist bei m, eine Buͤrsten-Walze angebracht, die
durch einen Riemen von dem Trommel-Rade her auf die Hauptachse in
Thaͤtigkeit gesezt wird. Glaͤttungs- oder Polier-Walzen,
oder Flaͤchen koͤnnen abwechselnd mit den Karden-Walzen
angebracht werden, oder das Tuch kann auch durch eine besondere Maschine nach dem
Aufrauhen, oder durch entgegengeseztes Treiben der obigen Maschine geglaͤttet
werden.
Die Walzen, c, wurden, als mit Karden bedekt,
beschrieben. Der Patent-Traͤger hat jedoch im Sinne, sie aus
kreisfoͤrmigen Metall-Platten verfertigen zu lassen, die an ihren
aͤußeren Kanten mit feinen krummen Zaͤhnen versehen sind. Diese
Platten muͤssen mit einem durch ihre Mitte laufenden Loche zur Aufnahme einer
Stange versehen seyn, welche mit Halsbaͤndern, hervorstehenden Ringen oder
Nieten an jedem Ende ausgestattet sind, und durch dieselben an ihrer Stelle und
dicht an einander gedraͤngt erhalten werden. Bei dem Aufrauhen des Tuches
muͤssen sie so gedreht werden, daß sie mit ihren Zaͤhnen in dasselbe
eindringen koͤnnen; wenn das Haar aber niedergelegt werden soll,
muͤssen sie in entgegengesezter Richtung und sehr schnell laufen. Der
Durchmesser dieser Walzen muß klein seyn, indem sie sonst nicht kraͤftig
genug wirken.
Man haͤlt es fuͤr raͤthlich, der Gig-Trommel eine
abwechselnd nach den Seilen hin laufende Bewegung mitzutheilen, damit die Wirkung
der Spizen mehr gleichfoͤrmig uͤber das Tuch verbreitet wird, als
bisher bei den sogenannten Gig-Maschinen waͤhrend des Rauhens und
Zurichtens des Tuches moͤglich war. Um diese abwechselnde Bewegung
hervorzubringen, sind schiefe Flaͤchen oder schnekenfoͤrmig gewundene
Daͤumlinge auf den Achsen der Gig-Trommel in der Naͤhe der
Enden derselben angebracht, welche, so wie die Trommel sich dreht, dieselbe
seitwaͤrts hin- und herlaufen machen.
Fig. 28. ist
eine End-Ansicht der verbesserten Scher-Maschine. a, ist der Schertisch oder die Scherlatte,
woruͤber das zu scherende Tuch gezogen wird. b,
ist die sich drehende Walze, um welche die spiralfoͤrmigen Laͤufer
oder oberen Blaͤtter der Schere gewunden sind. c,
ist der Lieger oder das Hintertheil der spiralfoͤrmigen Laͤufer, gegen
welche diese laufen, und mit welchen sie vereint als Scheren wirken. Die sich
drehenden Laͤufer und auch die Lieger sind in einem Gestelle aufgezogen,
welches sich auf Angeln oder um eine Achse dreht, damit das Tuch sich zwischen die
Laͤufer und den Scher-Tisch hineinziehen kann.
Diese Maschine wird mittelst eines Laufriemens in Umtrieb gesezt, der von dem
drehenden Theile einer Dampfmaschine oder irgend einer Triebkraft her laͤuft.
Dieser Laufriemen laͤuft uͤber ein Reibungsrad, d, welches an dem Ende der Hauptachse, e,
angebracht ist, und an dem entgegengesezten Ende dieser Achse ist ein noch
groͤßeres Reibungsrad, f, befestigt, von welchem
ein Laufriemen zu der Scher-Walze, b,
laͤuft, welche dadurch schnell umgetrieben wird. Vorne an der Maschine ist
eine hohle Roͤhre, g, in welche Dampf oder irgend
ein Waͤrmungs-Mittel eingebracht wird, um das Tuch waͤhrend
seines Durchganges zu erwaͤrmen. h, ist eine mit
Karden bedekte Walze, durch deren Umdrehung das Tuch uͤber den Schertisch
oder die Scherlatte vorgezogen wird. Diese Karden-Walze wird durch einen
Laufriemen von einer Rolle auf der Hauptachse getrieben. Bei k, befindet sich eine Stange, welche laͤngs der Vorderseite der
Maschine hinlaͤuft, und gegen das Tuch druͤkt, um dasselbe dicht
uͤber den Schertisch zu spannen. l, ist eine
Walze unter der Karden-Walze, durch welche das Tuch abwaͤrts geleitet,
und gehindert wird, sich um die Karden-Walze zu wikeln. m, ist eine sich drehende Buͤrste zum Aufrichten
des Haares, waͤhrend das Tuch seiner Laͤnge nach geschoren wird.
Die verschiedenen Theile der Maschine, die Laͤufer, die Lieger und der
Schertisch lassen alle durch Schrauben sich stellen, so daß man sie bei
verschiedenen Arten von Tuͤchern und Wollenzeuge benuͤzen kann.
Auf dieser Maschine kann das Tuch der Laͤnge nach durch ununterbrochene
umdrehende Bewegung, oder der Breite nach geschoren werden, indem es naͤmlich
von Zeit zu Zeit auf seinem Lager gewechselt wird, so daß alle verschiedenen Theile
des Tuches nach und nach unter die Scheren kommen, wodurch das breiteste Tuch seiner
Breite nach geschoren werden kann, ohne daß es mehr Raum brauchte, als ein
schmaͤleres.
Die Verbesserung an der Scher-Maschine betrifft auch den Bau der
Laͤufer und des Schertisches. Zu den ersteren nimmt er
„Blech- oder duͤnnen Stahl, oder Stahl und Eisen
zusammengeschweißt, etwas breiter und laͤnger als der Laͤufer
werden soll, und bildet daraus durch Haͤmmern oder Streken einen Kreis
von solchem Durchmesser, daß, wenn man sich eine Linie durch den Mittelpunct
desselben von einer Kante des Laͤufers zur anderen gezogen denkt, diese
mit den Radial-Linien der Walze auf jeden Theil der ganzen Laͤnge
der Laͤufer beinahe zusammenfaͤllt, wenn diese in die
gehoͤrige schneidende Laͤnge ausgezogen sind.“
„Ich fuͤge“, sagt er, „diese Laͤufer in
Furchen ein, die in eine walzenfoͤrmige Stange, oder in eine metallene
Roͤhre eingeschnitten sind, oder sonst durch Stangen oder Rippen gebildet
werden, die man auf eine walzenfoͤrmige Stange oder
Metall-Roͤhre unter dem gehoͤrigen Schneide-Winkel
anbringt: dann hize und tauche ich die Stange, oder die Roͤhre und die
Laͤufer in die haͤrtende Fluͤßigkeit.“
Die Verbesserungen bestehen ferner noch „in gefurchten Walzen mit sich
drehenden Laͤufern zur Aufnahme spiralfoͤrmiger Laͤufer,
und in Befestigung spiralfoͤrmiger Laͤufer mittelst Drahtes oder
kleiner Metall-Streifen, die mit den Laͤufern in Furchen
eingetrieben sind, wodurch ich im Stande bin, spiralfoͤrmige
Laͤufer in Furchen zu befestigen, deren Tiefe die Breite
uͤbersteigt, und wodurch man eine leichte und dauerhafte Befestigung, und
zugleich auch mehr Staͤrke an der Walze erhaͤlt.“
Die verbesserte Einrichtung des Schertisches oder Bettes bezieht sich
vorzuͤglich auf die Diagonal-Schermaschine, auf welche der
Patent-Traͤger sich im Jahre 1821. ein Patent ertheilen ließ.
(Vergl. London Journal of Arts II. B. S. 88. Polyt.
Journ. B. VI. S. 69.) Der Zwek derselben
ist das Abscheren der Sahlleisten zu hindern, waͤhrend das Tuch
uͤber den Schertisch laͤuft. Fig. 29. zeigt das
Innere des verbesserten Schertisches: die neuen Theile, welche die Sahlleisten
schuͤzen sollen, sind der Schieber, a, der
durch die Schraube, b, gestellt wird; eine Reihe von
Metallstuͤken, cc, die einzeln durch
ihre eigene Schwere niedersinken, wie der keilfoͤrmige Theil des
Schiebers zuruͤkweicht. Fig. 30. ist eine
vergroͤßerte Darstellung des Endes eines Bettes oder Schertisches, der
von dem vorigen abweicht, vorzuͤglicher, zugleich aber auch theuer
ist.“
1) ist das Gehaͤuse; 2) eine an demselben befestigte hervorstehende Rippe;
3) eine Walze; 4) eine Feder; 5) ein Metall-Stuͤk, wovon zwei
Reihen vorhanden sind, die sich auf Stiften drehen; der hervorstehende Theil von
5 wirkt in einer Richtung als Haͤlter, gibt aber in der anderen Richtung
nach. 6) Federn; 7) Streifer oder Heber; 8) eine Stange; 9) eine Bolzen,
uͤber dessen Ende das Tuch zum Scheren laͤuft. Die ganze
notwendige Lange des Bertes ist mit Bolzen, g,
versehen, zwischen deren jedem ein duͤnnes Metall-Stuͤk als
Scheidewand eingefuͤgt werden kann, das zum Theile in
Saͤgespaͤnen in dem Gehaͤuse stekt. Die Zahl der Heber
kommt der Zahl der Bolzen gleich. Der Theil des Hebers, der die Stange 8 umgibt,
hat eine Hervorragung oder eine Sperre auf einer, und eine Vertiefung auf der andern Seite, um die
Hervorragung des naͤchstfolgenden Nachbars aufzunehmen. Der Raum des
einen wird nicht ganz durch die Hervorragung des anderen ausgefuͤllt: der
Unterschied betraͤgt beinahe ein Viertel eines Kreises. Einer der
Ende-Heber ist an der Stange befestigt; die Stange kann sich aber frei in
allen uͤbrigen bewegen. Es ist demnach klar, daß, wenn die Stange nach
einer Richtung gedreht wird, die Bolzen nach und nach in derselben Richtung
folgen, und umgekehrt; dieß geschieht aber bloß durch Einen Heber, indem er sich
an der Stange nach der Richtung der Laͤnge bewegt, nicht aber in die
Runde. Nachdem das Ende des Hebers einen Bolzen bewegt hat, laͤuft es
durch einen Raum in der hohlen Platte, wodurch der Heber zu dem naͤchsten
Bolzen geleitet wird. Die Stange 8 wird von einem der bewegenden Theile der
Maschine getrieben, wenn das oberste Ende des Tuches durchgeht. Zuweilen braucht
man auch zwei Stangen und zwei Heber, um die Bolzen in verschiedener Richtung zu
treiben.“
Die Verbesserungen an den Schermaschinen bestehen ferner an gewissen
Veraͤnderungen und Abaͤnderungen eines von Steph-Price zu Stroud Water erfundenen Apparates, worauf dieser ein
Patent nahm, das der gegenwaͤrtige Patent-Traͤger kaufte. Fig. 31. ist
ein Querdurchschnitt dieser Maschine, deren Verbesserungen nicht besonders aus
einander gesezt sind. Der Patent-Traͤger sagt bloß: „a, ist das Gestell; b,
ein Gestell, das sich schieben laͤßt, und den Schertisch, k, traͤgt; c, der
Heber; d, eine Schraube, um den Schertisch zu heben
oder zu senken; e, ein Hebel, der an der Achse des
Hebers befestigt ist; f, ein Reibungsrad; g, ein Reibungsrad auf der Achse einer der
Buͤrsten, h: i, die Walze, von welcher das
Tuch sich abrollt; j, die Zugwalze; l, Ruͤken, auf welchem das flache Bett
befestigt ist; m, das Lager der sich umdrehenden
Laͤufer; n, ein hoͤlzerner Haspel,
uͤber welchen das Tuch aufgezogen wird; o,
eine Stange oder ein Haspel, unter welchem das Tuch weggezogen wird; p, die Bolzenloͤcher, um die beiden
Ende-Gestelle mit Halsbolzen zu befestigen.“
Tafeln