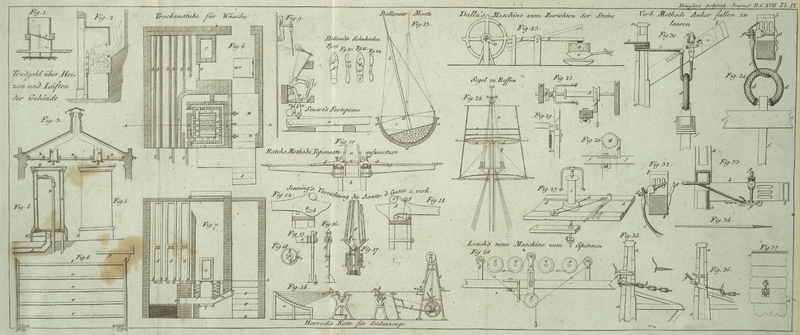| Titel: | Trokenstube für die Wäsche im Spitale zu Derbyshire. |
| Fundstelle: | Band 17, Jahrgang 1825, Nr. LXXXIV., S. 416 |
| Download: | XML |
LXXXIV.
Trokenstube fuͤr die Waͤsche im
SpitaleWir geben diese Beschreibung einer Trokenstube eines Spital-Waschhauses in
England nicht bloß unserer Spitaͤler wegen, die wir, wenigstens nach
einer großen Krankenanstalt zu urtheilen, immer schlechter statt besser werden
sehen; sondern der Fabriken wegen, die in manchem deutschen Lande allerdings
wohl auch bald das Loos eines Spitales werden theilen muͤssen. Von dem
Nuzen dieser Bauart der Trokenstuben in Spitaͤlern hatte der Uebersezer
Gelegenheit sich in England dadurch zu uͤberzeugen, daß sie beinahe in
allen englischen Spitaͤlern, nicht bloß zu Derby (wo er nicht war)
eingefuͤhrt ist. A. d. Ueb. zu Derbyshire.
Aus dem Mercure technologique. N. 63. S. 268 im
Auszuge.
Mit Abbildungen auf Tab.
IX.
Trokenstube für die Wäsche im Spitale zu Derbyshire.
Das Troknen und Plaͤtten (Baͤgeln in Baiern)
geschieht in einem großen Saale, bei einem aͤhnlichen Ofen, wie jener,
welcher das ganze Haus heizt.
Fig 6. zeigt den Grundriß, nicht in einem streng horizontalen Durchschnitte, sondern
so, daß die verschiedenen Gegenstaͤnde in verschiedenen Erhoͤhungen
dargestellt werden. Fig. 7. (dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde)
ist ein senkrechter Durchschnitt nach der Linie, AB, des Grundrisses. SS, sind drei
Stufen, uͤber welche man von dem Fußboden, AB, nach F, herab gelangt, einer Art von
Vertiefung, die man in dem Grundrisse Fig. 6. sieht. Von da
steigt man uͤber zwei andere Stufen nach M,
herab, wo der Heizer sich befindet, um das Feuer anzuschuͤren, der das
Brenn-Material durch die Oeffnung, m, einschiebt.
Der Herd ist mittelst einer eisernen Gloke bedekt, die, statt wie am Ofen in diesem
Hanse, gewoͤlbt zu seyn, oben mittelst einer gegossenen Platte geschlossen
ist, die einer kleinen, mittelst der Thuͤre, D,
verschlossenen, Zelle als Fußboden dient. Der obere Rand dieser Gloke dient zum
Hizen der Plaͤtt- (Baͤgel-) Eisen, um die Waͤsche zu
plaͤtten, waͤhrend die Seitenwaͤnde mit eisernen
Roͤhren, tt, umgeben sind, wie jene an dem
großen Ofen des Hauses. Diese Roͤhren sind in einer engen Mauer
eingeschlossen, die den leeren Raum, k, von demjenigen
scheidet, der die Gloke unmittelbar umgibt. Die frische Luft steigt durch einen
unterirdischen Gang unter M, auf, der mit der
aͤußern Luft in Verbindung steht; sie tritt durch die Roͤhren, tt etc. ein, und schlaͤgt an die erhizten
Waͤnde der Gloke; hebt sich in der Kammer fuͤr warme Luft, Fig. 7. empor,
und geht dann in die Trokenstube, die die Gestelle, ddd, zum Aufhaͤngen der zu troknenden Waͤsche
enthaͤlt. Die Luft zieht durch die Thuͤre, w, die man waͤhrend des Troknens der Waͤsche geschlossen
haͤlt. Laͤngs der Trokenstube, so wie laͤngs des Waschhauses,
sind Schienen oder Falzen aus Gußeisen (Eisenbahnen) angebracht, in welchen die
Gestelle fortrollen; ddd, Fig. 8. im Aufrisse, nn, sind Raͤderchen oder Waͤlzchen
aus Gußeisen mit Furchen, damit die Gestelle auf den Schienen, b, laufen koͤnnen, Fig. 7. Jedes Gestell hat
2 Raͤder ruͤkwaͤrts, und eines vorne. Jedes Gestell hat ferner
5 Reihen uͤber einander befindlicher Stangen, wovon 4 doppelt sind, welches
also in Allem 9 Stangen gibt, worauf die Waͤsche ausgebreitet wird. Diese
Gestelle werden, wie man sieht, aus dem Waschhause in die Trokenstube, und
umgekehrt, gefahren, um die Waͤsche darauf aufzuhaͤngen, und von
denselben abzunehmen: in jedem Falle schließen ihre Enden genau alle Oeffnungen, um
der kalten Luft jeden Zutritt in die Trokenstube zu versagen. Jedes derselben wird
nebenher noch durch einen an der Deke befestigten Leiter, g, in seiner Lage
gehalten.
In dem Maße, als die warme Luft sich abkuͤhlt, sinkt sie, zugleich mit den
Wasserdaͤmpfen, welche sie der Waͤsche entzogen hat, herab, und
entweicht durch die Roͤhre, C, an dem Boden der
Trokenstube. Durch diese Vorrichtung muß die erhizte Luft die Stube von oben nach
unten durchziehen, und gewaͤhrt auf diese Weise das kraͤftigste
Mittel, alle Feuchtigkeit mit dem mindesten Aufwande an Brenn-Material zu
beseitigen.
Es waͤre uͤberfluͤßig, eine Vergleichung zwischen dieser
Trokenstube und den gewoͤhnlichen Trokenstuben fuͤr Waͤsche
anstellen zu wollen. Selbst dort, wo man, statt mittelst des gewoͤhnlichen
Feuers, bei einem eisernen Ofen troknet, weiß man nichts Besseres, als den Ofen in
die Mitte dieser Stube zu stellen, oder in der lezteren die Blechroͤhre herum
zu fuͤhren. Die obere Flaͤche dieses Ofens dient zum Hizen der
Plaͤtteisen, und die Waͤsche wird in der Stube aufgehaͤngt, die
die Waͤscherin bewohnt. Gewoͤhnlich ist der Ofen so gut geheizt, daß
man in Gefahr ist, die trokene Waͤsche an demselben zu verbrennen, was nur zu
haͤufig zu großem Schaden geschieht. Das Waschhaus, nach diesem Plane erbaut,
ist von allen diesen Maͤngeln befreit:
1) Kann, bei warmer Witterung, alle Verbindung zwischen der Trokenstube, aus welcher
die Waͤrme ausstroͤmt, und dem Orte, wo die Waͤscherinnen sich
befinden, unterbrochen werden, waͤhrend man im Winter einen Theil der warmen
Luft aus der Trokenstube dahin leiten kann.
2) Ist der Ort, wo die Eisen gehizt werden, von dem Arbeits-Zimmer vollkommen
abgeschieden: der Herd oͤffnet sich an einem ganz abgeschiedenen Orte, so daß
alle Feuersgefahr unmoͤglich wird.
3) Um alles Vorurtheil fuͤr das Troknen in freier Luft zu zerstreuen, wollen
wir hier nur dieß bemerken, daß, da bestaͤndig ein neuer Luftstrom durch die
Trokenstube streicht, in gleichen Zeitraͤumen eine groͤßere Menge Luft
mit der Waͤsche in Beruͤhrung kommt, als wenn das Troknen in freier
Luft geschaͤhe. Und darin liegt die wesentliche Bedingung zur Erhaltung jener
Weiße, die der Waͤsche eigen ist. Das Licht ist uͤberdieß das Einzige,
was irgend einen nachtheiligen Einfluß in dieser Hinsicht erzeugen kann: denn man
weiß, daß es eine dem Bleichen entgegengesezte Wirkung hervorbringt, indem dieses
Bleichen lediglich von Feuchtigkeit und Sauerstoff abhaͤngt.
4) Ist die Waͤsche bei diesem Troknen weder dem Zimmer-Staube, noch
irgend einer Gefahr vom Schmuze beflekt zu werden, ausgesezt. Dieselbe Trokenstube kann auch zum
bequemen und gehoͤrigen Durchluͤften der Waͤsche dienen, die
darin so lange haͤngen kann, bis man sie braucht.
Man bedient sich zuweilen auch noch eines anderen Gestelles, welches so eingerichtet
ist, daß ein Theil desselben sich in einem Gewinde oͤffnet, so daß man ein
ganzes Bett darauf legen kann. Das Ganze laͤuft dann in der Trokenstube auf
Eisenbahnen hin. Es kann keine leichtere und zwekmaͤssigere Methode geben, um
naßgewordene Betten auszuluͤften.
Die Beheizung dieser Trokenstube wurde schon vor langer Zeit im Großen zum Troknen
des Baumwollen-Garnes und der Baumwollen-Zeuge in der Fabrik der HHrn.
Strutt angewendet: sie koͤnnte auch
Papiermachern, Toͤpfern, in Zuker-Raffinerien u. d. gl. dienen. Die
HHrn. Strutt fanden sie wohlfeiler, als irgend eine
andere. Um eine Idee von den Wirkungen derselben zu geben, wollen wir folgende, an
Calico-Stuͤken gemachte, Erfahrung hier anfuͤhren. Man fing um
9 Uhr an, als das Feuer im vollen Gangen war, und fuhr bis um 3 Uhr Nachmittags
fort, waͤhrend welcher Zeit das Feuer immer unterhalten wurde.
Waͤhrend dieser Zeit hat man 104 Stuͤke, jedes von 23 Meter in der
Laͤnge, getroknet, die, naß, 1140 Pfund wogen, und getroknet, 547 Pfund: das
ausgeduͤnstete Wasser betrug demnach 593 Pfund. Das Gewicht der hierzu
verwendeten Steinkohlen betrug 338 Pfund: Ein Pfund Steinkohle verdampft demnach
1,56 Pfund Wasser. Die Luft und der Dampf entweichen aus der Trokenstube unter einer
Temperatur von 41° (R?). Die Menge Wassers in einem kubischen Meter war nicht
groͤßer, als jene, welche eine mit Daͤmpfen gesaͤttigte Luft
unter einer Temperatur von 21° enthalten wuͤrde, so daß, wenn die
warme Luft unter diesen Waaren noch mehrere Mahle umher gezogen waͤre, sie in
derselben Zeit, bei demselben Brenn-Materiale, noch weit mehr Wasser entzogen
haben wuͤrde. Wenn das Mittel bei 41° mit Dampf gesaͤttigt
worden waͤre, so waͤre die Fluͤssigkeit bei einer Temperatur
von 32°
hinausgetreten, und haͤtte, statt 593 Pfund Wasser, etwas mehr als 1200 Pfund
weggefuͤhrt.
Tafeln