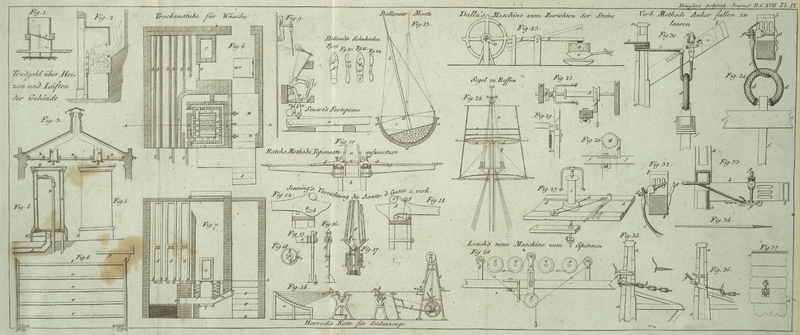| Titel: | Instrument zur Verhütung der unzeitigen Entweichung des Gases, und der dadurch entstehenden Gefahr und Nachtheile, worauf Heinr. Constantin Jennings, Esqu., Devonshire-Street, Parish of St. Mary-le-bone, Middlesex, sich am 14. August 1823 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 17, Jahrgang 1825, Nr. C., S. 458 |
| Download: | XML |
C.
Instrument zur Verhütung der unzeitigen
Entweichung des Gases, und der dadurch entstehenden Gefahr und Nachtheile, worauf
Heinr. Constantin Jennings,
Esqu., Devonshire-Street, Parish of St. Mary-le-bone, Middlesex,
sich am 14. August 1823 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. N. 51. S.
183.
Mit Abbildungen auf Tab.
IX.
Jennings's, Instrument zur Verhütung der Entweichung des Gases, und
der dadurch entstehenden Gefahr und Nachtheile.
Eine sehr sinnreiche Zugabe zu einer Gaslampe, die auf dem
Grundsaze beruht, daß zwei verschiedene an einander befestigte Metalle unter
derselben Temperatur sich ungleich ausdehnen, wie dieß bei der
Compensations-Unruhe an Chrometern der Fall ist. Die Oeffnung, durch welche
das Gas aus der Roͤhre zu der Lampe aufsteigt, wird, wenn das Gas nicht brennt, mittelst einer
Kugel geschlossen, die in einer Hoͤhlung oben bei der Oeffnung ruht. Diese
Kugel wird von einem gekruͤmmten Arme getragen, der oben in dem Brenner an
einem Stifte haͤngt; der Arm besteht aus zwei verschiedenen Metallen, z.B.
zwei Streifen aus Stahl und Messing, die durch Gelenke, die sich in einander
schieben lassen, mit einander verbunden sind. Sobald der Stift, an welchem der Arm
haͤngt, durch die Flamme gehizt wird, theilt er die Hize den beiden
duͤnnen Metall-Streifen mit, welche, indem sie sich ausdehnen, sich
kraͤuseln, und dadurch die Kugel an einer Seite aus ihrer Hoͤhle
ziehen, wodurch dann dem Gase der Weg zur Spize der Lampe geoͤffnet wird.
Fig. 17.
zeigt die verbesserte Gaslampe mit diesem neuen Apparate im Durchschnitte. Das Gas
steigt aus der Roͤhre a, des befestigten
Stiefels, cc, auf, und wuͤrde in die
Roͤhre der Gaslampe treten, wenn nicht die Kugel, b, in der ausgehoͤhlten Oeffnung oben an dem Stiefel den Durchgang
verschloͤße. Um dem Gase den Durchgang in den Brenner zu gestatten und
dasselbe anzuzuͤnden, muß der obere Theil des Brenners gehoben werden, was
leicht geschehen kann, indem der untere Theil des Brenners sich in dem Stiefel, cc, schiebt. Wenn man nun den Brenner mit der Hand
in die Hoͤhe zieht, hebt man auch die Kugel b,
aus dem Stiefel, und das Gas geht durch den Canal a nach
d, und durch die Seitenroͤhren, ee, hinauf zu dem Brenner.
Nachdem das Gas um den Brenner ungefaͤhr eine Viertel-Minute lang in
Flammen stand, ist der Stift, f, den die Flamme
umhuͤllt, heiß geworden, und hat seine Hize dem gekruͤmmten Arme, g, mitgetheilt, der, wie die punctirten Linien zeigen,
auflaͤuft, weil die beiden verschiedenen Metalle in verschiedenem Maße sich
ausdehnen. Da die Kugel auf diese Weise aus ihrem Lager gebracht wurde, kann man den
Brenner wieder in seine vorige Lage zuruͤklassen, und das Gas wird fortfahren
durch die Oeffnung durchzustroͤmen, solang naͤmlich der Arm durch
seine Ausdehnung aufgelaufen bleibt; wenn aber die Flamme endlich
ausgeloͤscht und der Stift und der gebogene Arm kalt wird, tritt die Kugel wieder in ihre
vorige Lage zuruͤk, und verschließt dem Gas den Ausgang, wenn auch der
Sperrhahn aus Nachlaͤßigkeit offen geblieben waͤre.
Die Vorrichtung, wie das Gas zugelassen und abgesperrt wird, d.h. der Sperrhahn
gedreht wird, erhellt am deutlichsten aus dem horizontalen Durchschnitte, Fig. 18. Der
aͤußere Ring, cc, zeigt den weitesten
Durchmesser des Stiefels, in welchem der Stiefel, wie gesagt, sich auf und nieder
schiebt. In dem unteren walzenfoͤrmigen Theile des Brenners befindet sich ein
Ausschnitt, h, der uͤber den vierten Theil eines
Kreises hinlaͤuft: ein Stift, i, geht durch den
aͤußeren Rand in diesen Ausschnitt, und hindert den Brenner sich weiter, als
in dieser Entfernung, zu drehen. Im Mittelpuncte dieses horizontalen Durchschnittes
sieht man die kreisfoͤrmige Oeffnung a, durch
welche das Gas aus der Roͤhre unten heraufsteigt. An der Seite dieser
Oeffnung ist eine Seiten-Oeffnung, durch welche das Gas in eine
halbkreisfoͤrmige Hoͤhlung, k, an dem
unteren walzenfoͤrmigen Theile des Brenners eintritt. Diese Hoͤhlung
ist in Fig.
18. als weggedreht von der Seiten-Oeffnung dargestellt, so wie sie
naͤmlich dann gelagert ist, wann der Sperrhahn geschlossen ist. In dem
verticalen Durchschnitte, Fig. 17. findet man aber
diesen Durchgang offen, da die Hoͤhlung k, der
Seiten-Oeffnung gegenuͤber steht, und in dieser Lage kann das Gas aus
der unteren Oeffnung durch die Hoͤhlung k, in den
oberen Theil des Brenners gelangen.
Durch diese Vorrichtung wird also die Oeffnung des Brenners geschlossen, sobald das
Licht ausgeloͤscht ist, auch wenn der Sperrhahn offen bliebe, wodurch
zugleich auch alle Gefahr und alle Nachtheile, die durch den Ausfluß des Gases außer
der Brennzeit entstehen, beseitigt sind.
Tafeln