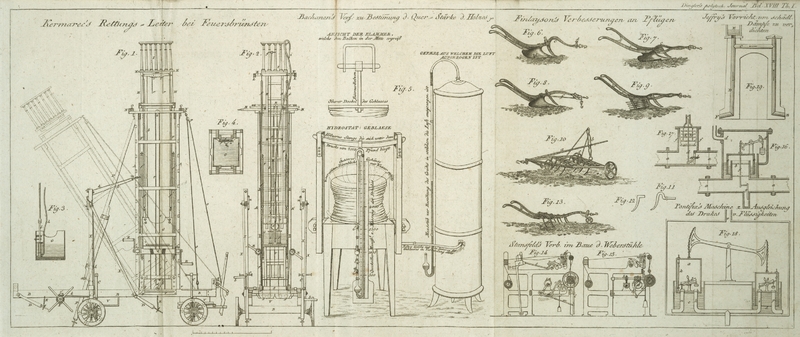| Titel: | Methode zur Stellung und Ausgleichung des Drukes der Flüßigkeiten in Röhren, und verbesserte Methode, diese Flüßigkeiten zu messen, worauf Wilh. Pontifex, d. jüng., Kupferschmid und Mechaniker in Shoe-lane, City of London, am 1. Jul. 1824 sich ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 18, Jahrgang 1825, Nr. VI., S. 40 |
| Download: | XML |
VI.
Methode zur Stellung und Ausgleichung des Drukes
der Fluͤßigkeiten in Roͤhren, und verbesserte Methode, diese
Fluͤßigkeiten zu messen, worauf Wilh. Pontifex, d. juͤng., Kupferschmid und Mechaniker in
Shoe-lane, City of London, am 1. Jul. 1824 sich ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Junius.
1825. S. 356.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Pontifex's, Methode zur Stellung und Ausgleichung des Drukes der
Fluͤßigkeiten in Roͤhren, und Fluͤßigkeiten zu messen.
Diese Verbesserung laͤßt sich unter drei Gesichtspuncte bringen: 1) ist sie
Verbesserung an bereits vorhandenen Maschinen zur Stellung und Ausgleichung des
Drukes der Fluͤßigkeiten, vorzuͤglich in Hinsicht auf Auslassung des
Gases zur Beleuchtung und Regulirung der Staͤrke, mit welcher das Gas durch
die Brenner ausstroͤmen soll. 2) enthaͤlt sie eine Modifikation
derselben Grundsaͤze, anwendbar auf Regulirung der Entladung des Wassers
durch Roͤhren; 3) auf den Bau der Gasometer, zur Bemessung und Regulirung der
Menge Gases, welche durch den Apparat in einer gegebenen Zeit entweicht.
Fig. 16.
zeigt die Art, wie man diese Vorrichtung zur Ausladung der Gasladung benuͤzen
kann, und stellt den Apparat, der sich ganz unter der Erde befindet, im
Durchschnitte bar. aa, ist ein Theil einer
Hauptroͤhre fuͤr die Gasausleitung, in welcher b, eine Oeffnung oder senkrechte Roͤhre ist. cc, ist ein umgestuͤrztes Gefaͤß,
einem Gasometer aͤhnlich: der untere Theil desselben ist in Wasser
eingetaucht, welches den Canal des Gefaͤßes, dd, um die Roͤhre, b, einnimmt: der
obere Theil des Gefaͤßes erhaͤlt Luft durch eine Seitenroͤhre,
die aufwaͤrts uͤber die Erde aufsteigt. Das Gefaͤß, c, haͤngt mittelst einer Kette an einem Hebel,
e, welcher durch ein Gewicht an dem entgegengesezten
Ende im Gleichgewichte erhalten wird. Innenwendig im Mittelpunkte des
Gefaͤßes, c, ist eine Stange, f,
angebracht, die senkrecht durch Loͤcher in den Querstangen niedersteigt, und
dadurch bei ihrem Auf- und Niedersteigen geleitet wird. Der untere Theil dieser
Stange, f, ist gebogen, und an der Stange ist eine
Platte oder Scheibe, g, angebracht, die unten in eine
Aushoͤhlung einfaͤllt, und dazu dient, den Durchgang der
Roͤhre, a, theilweise oder ganz, nach
Umstaͤnden, zu verschließen.
Nachdem das Gasometer, c, mittelst eines gewissen Drukes
durch eben aufgelegte Gewichte gehoͤrig gestellt wurde, laͤßt man Gas
durch die Hauptroͤhre, a, laufen, und solang als
dieses den Druk nicht uͤbersteigt, welcher zur regelmaͤßigen Entladung
bei den Brennern nothwendig ist, laͤßt man den Apparat in Ruhe: sobald aber
das Gas etwas mehr Kraft zu aͤußern beginnt, steigt das Gefaͤß, c, empor, und mit diesem zugleich die Stange, f, und die Platte oder Scheibe, g, wodurch der Ausgang durch die Hauptroͤhre zum Theile geschlossen
wird, und das Gas bloß durch die verengte Oeffnung ausstroͤmen kann, folglich
der Druk bei dem Brenner die verlangte Entladung gibt. Wenn soviel Gas verbraucht
wurde, als zur Verminderung des Drukes noͤthig war, steigt das Gasometer, c, wieder hinab, und die Platte oder Scheibe, g, sinkt
in die Hoͤhlung hinab, und laͤßt den Ausweg durch die
Hauptroͤhre offen.
Die zweite Modification dieser Erfindung, zur Regulirung des Einflußes des Wassers,
ist in Fig.
17. im Durchschnitte dargestellt. aa,
ist die Hauptwasserroͤhre unter der Erde, in welcher b, eine scheibenfoͤrmige Klappe ist, die sich in senkrechter
Richtung auf Zapfen dreht, je nachdem der Hebel, c,
steigt oder faͤllt. Dieser Hebel wird von einer gegliederten Stange, d, in Bewegung gesezt, die an der unteren Seite des
Schwimmers, e, befestigt ist, welcher in der aufrechten
Roͤhre, ff, auf- und niedersteigt. Wenn der
Druk des Wassers in der Roͤhre, a, zu groß ist,
so wird dadurch der Schwimmer, e, in die Hoͤhe
getrieben, und dieser wird mittelst der Stange, d, und
dem Arme, c, die Klappe, b,
umdrehen, und zum Theile dem Wasser den Ausgang verschließen.
An der oberen Seite des Schwimmers, und an dem Rande, der oben rings um die
Roͤhre laͤuft, befindet sich ein biegsamer lederner Sak, wodurch das
Wasser, welches sich jenseits des Schwimmers eindraͤngen mag, gehindert wird,
gegen die obere Oderflaͤche zu wirken. Oben auf dem Schwimmer ist eine Stange
befestigt, welche durch einen Leiter sich in die offene Luftroͤhre, g, schiebt. hh, sind
verschiedene Gewichte, die an Schnuͤren von dem Dekel der Roͤhre, f, herabhaͤngen, um auf den Schwimmer zu
druͤken. Eines, zwei oder drei dieser Gewichte, oder auch mehrere,
laͤßt man auf den Schwimmer druͤken, je nachdem der vermehrte Druk des
Wassers denselben in der Roͤhre mehr oder minder hebt, und dadurch wird die
Klappe, b, zum Theile geschlossen, so daß sie den Lauf
des Wassers durch die Roͤhre, a, anhaͤlt,
und zwar im Verhaͤltnisse des angebrachten Drukes. Dadurch wird dem zu
heftigen Ausstroͤmen desselben bei dem Auslaufhahne vorgebeugt.
Die dritte Vorrichtung dient zur Messung der Menge Gases, welche waͤhrend
einer gegebenen Zeit durch eine Roͤhre ausstroͤmt: die Menge desselben
wird durch eine Zaͤhl-Maschine und durch ein Zifferblatt angedeutet. Fig. 18. zeigt
diesen Apparat in einem luftdichten Gehaͤuse eingeschlossen, a und b, sind zwei
umgestuͤrzte Gefaͤße, die in Suͤmpfen, c und d, wie Gasometer spielen. Diese
Gefaͤße sind mit Ketten an den Enden eines Wagebalkens, ee, aufgehaͤngt, der sich auf dem Pfeiler,
f, als auf seinem Stuͤzpuncte, schwingt.
Eine Roͤhre, g, fuͤhrt das Gas auf die
gewoͤhnliche Weise aus einem Gasbehaͤlter herbei, und ist in zwei
Arme, h und i, getheilt,
welche durch die Suͤmpfe aufsteigen, und sich jeder in sein
umgestuͤrztes Gefaͤß, a und b, oͤffnen.
Man nehme nun an, das Gas steige aus der Roͤhre, g, durch den Arm, h, auf, und entlade sich
uͤber dem Wasser in dem Gefaͤße, a,
welches folglich in dem Sumpfe, c, aufsteigt; das
Gefaͤß b, steigt aber gleichzeitig in dem Sumpfe
d, nieder. Wenn nun das Gefaͤß, a, voll, und bis auf seine hoͤchste Hoͤhe
gehoben ist, wird es noͤthig die Muͤndung der Roͤhre, h, zu schließen. Dieß geschieht mittelst einer Hemmung
auf der Seitenstange, k, innerhalb des Sumpfes, die an einen Arm
anschlaͤgt, welcher an dem Ende des Wagebalkens, l, hervorragt, und dadurch denselben in die Hoͤhe zieht. Dieser
Hebel ist hohl, und mit einer gewissen Menge Queksilber gefuͤllt, welches,
wenn ein Ende dieses Hebels gehoben wird, gegen das andere hin fließt, und so mit
bedeutender Kraft auf das Ende des Hebels, m,
schlaͤgt, von dessen Enden die kegelfoͤrmigen Klappen oder
Stoͤpsel herabhaͤngen. Auf diese Weise gelangt der
kegelfoͤrmige Stoͤpsel in die Muͤndung der Roͤhre, h, und wird daselbst durch das uͤberwiegende
Gewicht der Kugel auf dem Hebel, m, gehalten, und
schließt die Muͤndung. Dafuͤr wird aber die kegelfoͤrmige
Klappe an dem entgegengesezten Ende aus der Muͤndung der Roͤhre, n, herausgezogen; das Gas, welches das Gefaͤß,
a, fuͤllt, kann durch die Roͤhre, n, entweichen, und sich in das aͤußere
Gefaͤß, oder in das vierekige Gehaͤuse entleeren, aus welchem es oben
durch die Ausgangsroͤhre, c, austritt.
Auf aͤhnliche Weise wird nun auch die Muͤndung der Roͤhre, i, geoͤffnet, das Gas durchgelassen, welches
aufsteigen und das Gefaͤß, b, fuͤllen
wird, das, nach seiner Fuͤllung, sich wieder durch die Roͤhre, p, in das aͤußere Gefaͤß entleert. Auf
diese Weise sezt das immer zustroͤmende Gas den Wagebalken, e, bestaͤndig in eine Schaukelbewegung, und da
der kubische Inhalt der Gefaͤße bekannt ist, so wird es bloß noͤthig
durch eine Zaͤhlmaschine die Zahl der Schwingungen zu zaͤhlen, welche
waͤhrend einer gewissen Zeit Statt hatten, wodurch man auf der Stelle die
Menge Gases bestimmen kann, welche waͤhrend dieser Zeit durch den Apparat
durchlief. In dieser Absicht kann eine Achse aus dem Wagebalken an die Außenseite
des Gehaͤuses laufen, daselbst mit einer Zaͤhl-Maschine verbunden
werden, oder man kann das Zifferblatt durch eine mit einer Glastafel geschlossene
Oeffnung bemerkbar machen.
Tafeln