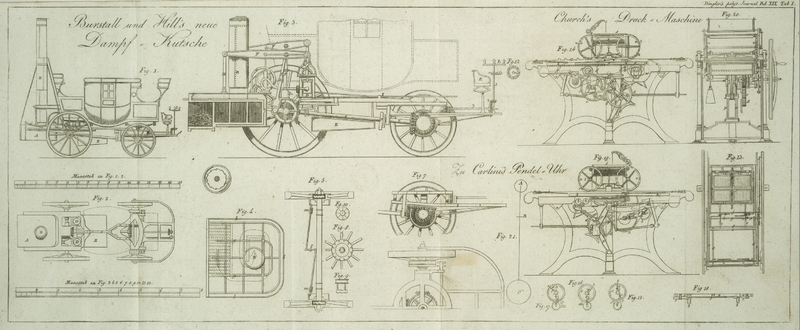| Titel: | Beschreibung der neuen Patent-Dampfkutsche, von den Erfindern, HHrn. Timoth. Burstall, und Joh. Hill, Mechanikern, mitgetheilt im Edinburgh Philosophical Journal. October 1825. S. 349. |
| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. I., S. 1 |
| Download: | XML |
I.
Beschreibung der neuen Patent-Dampfkutsche, von
den Erfindern, HHrn. Timoth.
Burstall, und Joh.
Hill, Mechanikern,Diese Dampfdiligence ist nach dem Berichte eines Augenzeugen, des k. bayerschen
Akademikers v. Yelin bereits ausgefuͤhrt und
fuͤr die gemeinen Heerstraßen bestimmt. Nach demselben Berichterstatter
wurde den 27. September die Fahrt auf der neu angelegten Eisenbahn zwischen Darlington und Stokton
mittelst durch Dampfmaschinen bewegter Fuhrwerke eroͤffnet. Der
ausfuͤhrliche Bericht uͤber den uͤberaus gluͤklichen
Erfolg der Dampffuhrwerke auf jener Eisenbahn ist in den Nr. 188 und 190 der in
Muͤnchen erscheinenden Zeitschrift Flora
nachzulesen. D. mitgetheilt im Edinburgh Philosophical Journal. October 1825. S.
349.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Burstall's, Beschreibung der neuen Patent-Dampfkutsche.
Die Erfindung dieser Dampfkutsche besteht in Verbindung und
Anwendung von Grundsaͤzen, deren einige neu, andere allgemein bekannt und
gebraͤuchlich sind. Die Hauptzuͤge derselben sind: 1) die Einrichtung
der Maschine und gewisser Theile derselben zur Erzeugung der an einem solchen Wagen
nothwendigen Evolutionen. 2) Der neue Bau des Kessels oder Dampf-Erzeugers, und die
besondere Art von Roͤhre, durch welche der Dampf zu der Maschine geleitet
wird; 3) die Art, den Kessel mit Wasser zu fuͤllen mittelst, einer
pneumatischen Presse.
Tab. I. Fig. 1.
zeigt den Seiten-Aufriß des Wagens mit dem Kasten. Fig. 2. zeigt denselben im
Grundrisse. Fig.
3. ist ein Durchschnitt des Kessels und der Maschinerie im
vergroͤßerten Maßstabe. Fig. 4. stellt den oberen
Theil des Kessels mit der Speisungs-Roͤhre und den Wasserbehaͤltern
dar: die punctirten Linien in dieser Figur zeigen den Feuerherd und die
Zuͤge, der Pfeil deutet die Richtung der Flamme nach dem Schornsteine an.
Fig. 5,
6, 7, 8, 9, 10. sind
Grundrisse und Durchschnitte verschiedener Theile der Maschine mit verschiedenen Modificationen. Fig. 11. ein
Grundriß der Buͤchse des Schiebrades mit einem Theile der Nabe. Fig. 12. eine
an der Spindel des Steuerrades befestigte Platte von oben gesehen, um dem
Fuͤhrer die Schiefheit der beiden Achsen zu zeigen. Dieselben Buchstaben
bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde.
A, ist der Kessel aus starkem Gußeisen oder aus irgend
einem anderen tauglichen Metalle. Er ist in einem starken Gehaͤuse aus
geschlagenem Eisen oder Kupfer eingeschlossen, wie Fig. 3. im Durchschnitte
zeigt, A, der Plaz fuͤr das Brenn-Material ist.
aaa, sind Theile des Zuges. Der obere Theil
ist, wie Fig.
4. zeigt, aus einer Menge seichter Troͤge zusammengesezt zur
Aufnahme einer geringen Menge Wassers in einem Zustande, in welchem es bereit ist in
Dampf uͤberzugehen, der aus dem Behaͤlter durch die kleine
Roͤhre, ggg, zugelassen wird. bbb, ist das aͤußere Gehaͤuse aus
geschlagenem Metalle zur Aufnahme des Dampfes, der bei der Maschine verbraucht
werden soll. B, ist der Schornstein, der aus der Witte
der Zuͤge aufsteigt. DD, sind die beiden
Cylinder, mit ihren Staͤmpeln und Klappen zur abwechselnden Wirkung des
Dampfes uͤber und unter dem Staͤmpel auf die gewoͤhnliche Weise
versehen. Der Kessel haͤngt in den Federn d, und
der Dampf wird zu der Maschine durch die schnekenfoͤrmige Roͤhre, c, geleitet, der man deßwegen diese Form gab, damit der
Kessel sich schwingen kann, ohne daß die Verbindungen der Roͤhren dabei
leiden. E, ist die Cisterne, die Wasser fuͤr eine
Station enthaͤlt, naͤmlich 50 bis 80 Gallons; sie ist aus starkem
Kupfer und luftdicht, so daß sie einen Druk von ungefaͤhr 60 Pfund auf den
Quadrat-Zoll ertragen kann. Bei e, ist eine Luft-Pumpe
angedeutet (es koͤnnen deren auch mehrere seyn), die von den Balken der
Maschine getrieben wird, und Luft in das Wassergefaͤß preßt, damit durch den
Druk derselben durch eine schikliche Roͤhre das Wasser in den Kessel
getrieben wird, so oft es in demselben fehlt, und in der Menge, in der es fehlt. FF, sind die beiden Balken, die an einem Ende mit
den Staͤmpelstangen, und an dem anderen mit den Schaukelpfosten HH, versehen sind. In ungefaͤhr einem
Viertel der Laͤnge der Stangen von den Staͤmpelstangen aus sind die
zwei Verbindungs-Stangen, gg, deren untere Enden
an den beiden Kurbeln befestigt sind, die unter Winkeln von 90° von einander
angebracht sind, und durch die Kraft des Dampfes dem Rade eine anhaltende umdrehende Bewegung
ertheilen, ohne daß ein Flugrad noͤthig waͤre. Die vier Raͤder
sind an dem Wagen, wie gewoͤhnlich, angebracht; nur daß ein Schiebrad auf dem
hinteren Theile der Nabe angebracht ist mit einer Buͤchse, die in die Achse
eingekeilt, und mit einem am Ruͤken mit einer Feder versehenen Sperrkegel
ausgestattet ist; dadurch werden die Raͤder getrieben, wenn die Achse sich
dreht, und zugleich, wenn der Wagen eine krumme Linie beschreiben soll, das
aͤussere Rad schneller getrieben, als das innere, jedoch so, daß es immer dem
Impulse der Maschine folgt, so bald der Wagen gerade laͤuft. Diese
Buͤchse und der Sperrkegel sind in Fig. 11. besonders
bezeichnet.
Fig. 5, 8, 9, 10. zeigt eine
verschiedene Methode, dasselbe zu leisten, wobei noch der Vortheil ist, daß der
Wagen zu gleich durch die Maschine verstaͤrkt, und mit dieser aufgesezt wird.
Die Naben sind hier mit einer Vertiefung in der Mitte gegossen, in welcher sich ein
doppeltes Getriebe befindet, womit die innere Seite der Nabe correspondirt. Auf
diese Getriebe wirken gleichzeitig die Stangen, und der kleine Hebel, b, mit den Spiralfedern, mm, die, je nachdem sie rechts oder links getrieben werden, den Wagen
ruͤkwaͤrts oder vorwaͤrts treiben. An den vorderen Naben sind
zwei walzenfoͤrmige Metallringe befestigt, um welche zwei
Reibungs-Laufbaͤnder laufen, die mittelst eines durch den Fuß des
Fuͤhrers zu leitenden Hebels gespannt werden koͤnnen, so daß der Wagen
dadurch aufgehalten und selbst leicht still stehen gemacht werden kann, wenn es
bergunter geht. K, ist der Siz des Fuͤhrers mit
dem vorne angebrachten Steuerrade, L, welches an der
kleinen aufrechten Spindel, 1, befestigt ist, und die zwei kegelfoͤrmigen
Triebstoͤke, 2, dreht, und die Spindel 3, mit ihrem kleinen Triebstoke 4,
welcher, in einen Zahnstok an dem Ausschnitte eines Kreises an dem Vorderwagen
eingreifend, die beiden Achsen unter jeden Winkel bringen laͤßt, der da
noͤthig ist, um die Kutsche auf der Straße umkehren zu machen: der
Mittelpunct der Bewegung ist der Reißnagel.
Das Vorder- und Hinter-Gestell des Wagens ist durch die Langwied 5, verbunden, die an
einem Ende bei der Gabel fest gebolzt ist, wie Fig. 2. zeigt, an dem
anderen Ende durch zwei Halsbaͤnder befestigt wird, welche die Vorder- und
Hinter-Raͤder
den Ungleichheiten des Weges sich anschmiegen lassen.
Wenn man steile Streken auf der Straße hinauffahren, oder auf Eisenbahnen fahren,
oder einen anderen Wagen hinten nachziehen soll, ist mehr Reibung auf der Straße
noͤthig, als die beiden Hinteren Raͤder nicht gewaͤhren
koͤnnen: daher hat man eine Vorrichtung angebracht, um alle vier
Raͤder zu treiben. Diese besteht in einem Paare kegelfoͤrmiger
Raͤder, 4, deren eines an der Hinteren Achse, das andere an der der
Laͤnge nach hinlaufenden Spindel, 6, sich befindet, auf welcher sich
unmittelbar unter dem Reibnagel 1 bei 7 eine sogenannte allgemeine Einfuͤgung
befindet. Dadurch wird die Spindel, 7, in den Stand gesezt sich zu drehen, wenn auch
der Wagen gesperrt ist. An einem Ende der Spindel 7, ist eines der 2
kegelfoͤrmigen Raͤder, wovon das andere sich an der vorderen Achse
befindet. Diese Raͤder stehen in demselben Verhaͤltnisse gegen
einander, in welchem sich die hinteren Raͤder zu den vorderen befinden, und
dadurch werden ihre Umfaͤnge mit gleicher Geschwindigkeit umgetrieben.
Fig. 6. ist
ein anderer Grundriß, und Fig. 7. ein anderer
Durchschnitt alle Raͤder zugleich zu bewegen, wo der Neidnagel uͤber
dem Mittelpuncte der Achse ist. 8, ist ein Rad, das sich darauf dreht, und das, wenn
es durch das Rad 9, in Bewegung gesezt wird, mittelst des Rades 10, die Vorderachse,
und dadurch die Raͤder in Umtrieb sezen wird.
Sicherheitsklappen, Sperrhaͤhne zum Zulassen, Absperren und Reguliren des
Dampfes etc. sind hier angebracht, koͤnnen aber hier, wegen des kleinen
Maßstabes, nicht in der Zeichnung dargestellt werden: jeder Mechaniker kennt sie
ohnedieß.
Der Kessel, der von 250 bis auf 600 und 800° Fahrenh. geheizt wird, wird hier
ein Magazin von Waͤrmestoff. Da die Patent-Traͤger das Wasser in einem
besonderen Gefaͤße halten, und es nur dann in den Kessel bringen, wann Dampf
noͤthig ist, so erfuͤllen sie den großen Wunsch bei Anwendung des
Dampfes auf gewoͤhnlichen Wegen jedes Mahl nur soviel Dampf zu erzeugen, als
noͤthig ist; so daß, wo es bergab geht, aller Dampf und alle Hize erspart,
und fuͤr die naͤchste Streke, die bergan geht, oder wo der Weg
schlecht ist, aufbewahrt werden kann.
Die Maschine ist eine Maschine mit hohem Druke, und von der Kraft von 10 Pferden.
Der Dampf wird in ein Zwischen-Gefaͤß abgelassen, und durch einen Hahn oder
durch mehrere Haͤhne regulirt.
Tafeln