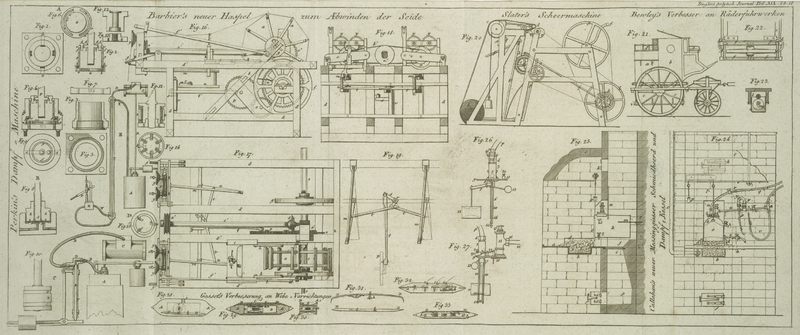| Titel: | Beschreibung eines neu erfundenen Messing-Gießers, Schmiedherdes und Dampfkessels. Von Hrn. J. J. Callahan, Lampen-Fabrikanten und Gasleiter etc. Exeter-Street, Strand. |
| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. III., S. 11 |
| Download: | XML |
III.
Beschreibung eines neu erfundenen
Messing-Gießers, Schmiedherdes und Dampfkessels. Von Hrn. J. J. Callahan, Lampen-Fabrikanten und
Gasleiter etc. Exeter-Street, Strand.
Aus Hrn. Gill's technical Repository. September 1825.
S. 149. (Im Auszuge.)
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Callahan's, Beschreibung eines neu erfundenen Messing-Gießers,
Schmiedherdes und Dampfkessels.
Herr Gill lobt im Eingange Hrn. Callahan's, in England allerdings seltenen Gemeingeist,
eine nuͤzliche Erfindung ohne Patent bekannt zu machen. Hr. Callahan, der bei dem sel. Hrn. Penton, einem der ersten Argand'schen Lampen-Fabrikanten, arbeitete, ist
Mitglied der Society of Encouragement, und wandte Franklin's selbstthaͤtigen Speiser zum
Nachfuͤllen des Wassers, den er zugleich sehr vereinfachte, und auf vier Zoll
reducirte, wofuͤr er auch von der Gesellschaft belohnt wurde, bei
Dampfkesseln an.
Hrn. Callahan's Dampfkessel ist nur 14 Zoll lang, und 8
Zoll breit und tief. Er ist aus stark vernietetem Kupfer, und wird aus einer
Roͤhre mit Wasser gespeiset, die aus einem Gefaͤße herabsteigt,
welches ungefaͤhr 9 Fuß uͤber demselben angebracht ist. Außer Franklin's Speiser sind auch hier die
gewoͤhnlichen Druk- und Leere-Klappen, der Aichhahn etc. vorgerichtet, nebst
den Roͤhren, um den Dampf in die Arbeitszimmer hinauf zu leiten, wo er
Wasser, die Bronzir-Fluͤßigkeiten u. d. gl. hizt. Der Dampf wird auch unten
benuͤzt, indem man ihn durch bohle Koͤrper, wie Argand'sche Lampen,
Saͤulen fuͤr Gas-Lampen-Roͤhren etc. laufen laͤßt, um
sie gleichfoͤrmig in Zeit von einer Minute zu erhizen, damit man sie lakiren
kann, was auch der Hauptzwek des Hrn. Callahan bei dieser
Vorrichtung gewesen ist, obschon er nebenher dabei auch den Vortheil hat, immer eine
hinlaͤngliche Menge heißen und siedenden Wassers bei der Hand zu haben, z.B.
bei dem Beizen seiner Messing-Arbeiten in Scheidewasser, wobei die Arbeit
abwechselnd zuerst in Saͤure, dann in kaltes Wasser so lang getaucht wird,
bis die gehoͤrige Wirkung dadurch hervorgebracht wird. Er findet es jedoch
gut, die gebeizten Stuͤke am Ende der Arbeit in heißes Wasser zu tauchen,
damit sie bei dem Abtroknen in den Saͤgespaͤnen schnell troken werden, und
bei dem Lakiren keine Fleken bekommen, oder matt werden, was bei den
gegenwaͤrtigen Messing-Arbeiten, in welchen England mit den Arbeiten der
Franzosen in sogenanntem Mahlergolde (or moulu)
wetteifert, jezt nothwendig geworden ist.
Hrn. Callahan's Schmiedeherd weicht nicht sehr von den
gewoͤhnlichen Herden dieser Art ab: sein Verdienst besteht vorzuͤglich
in seiner Verbindung mit einem Dampfkessel. Man wird in den Figuren bemerken, daß
die Gußeisenplatte des Herdes gleich hoch mit den Roststangen unter dem Kessel
liegt; daß die Kohlen zum Theile in der Pfanne aus geschlagenem Eisen, zum Theile
auf der Gußeisenplatte des Schmiedeherdesliegen, und seitwaͤrts durch zwei
bewegliche Baken aus geschlagenem Eisen zusammengehalten werden. Man wird sehen, daß
eine eiserne Register-Platte vorne an dem Ende des Dampfkessels an einem
Gegengewichte haͤngt, und mehr oder minder den unter dem Kessel zum Ofen
leitenden Zug oͤffnen oder schließen kann. Ein Thuͤrchen fuͤhrt
zur Aschengrube unten, und ein anderes ist oben im Zuge des Schornsteines unter dem
Hute der Schmiede angebracht. Die Roͤhre, die von dem Blasebalge herabsteigt
(der uͤber dem Hute angebracht ist, so daß er in der Schmiede nicht im Wege
steht), laͤuft nicht in die Pfanne des Schmiede-Herdes, oder der Esse,
sondern ist dem Loche der Pfanne, durch welches der Wind in das Feuer eintritt,
gegenuͤber angebracht, und laͤßt einen Raum von einem halben Zoll
zwischen dem Ende der Roͤhre des Blasebalges und der Pfanne oder Esse, so
daß, wenn die leztere sehr geheizt wird, wie z.B. wenn man Messing in einem Tiegel
in derselben schmelzen soll, um kleinere Artikel aus Sandmodeln auszugießen,
Schlagloch zu bereiten etc. die Roͤhre des Blasebalges nicht im Mindesten
leidet. Hr. Callahan fand, daß auf diese Weise Gas-Coke,
ein Feuer-Material, das schwer zu unterhalten ist, wenn es Morgens
angezuͤndet wird, haͤufig noch den ganzen Tag fortbrennt, und
lediglich von der Luft, die horizontal durch dasselbe in den Schornstein streicht,
unterhalten wird. Wenn die Thuͤre des Aschenloches dann geschlossen gehalten,
und die Register-Platte auf die Flaͤche der Cokes herabgelassen wird, so
bleibt das Wasser in dem Kessel bestaͤndig gehizt, da die heiße Luft frei
unter und ringsum denselben herumzieht. Wenn man den Dampf in dem Kessel zu irgend einer Zeit auf den
gehoͤrigen Grad von Hize bringen will, so darf man das Feuer bloß dadurch
anregen, daß man die obere Thuͤre schließt, oder, wenn eine groͤßere
Kraft des Dampfes noͤthig ist, darf man nur etwas brennende Cokes unter den
Kessel schieben, und die Aschenthuͤre oͤffen, so wird der Dampf bald
einen außerordentlichen Grad von Staͤrke erhalten. Sobald er seinen Dienst
verrichtet hat, wird das Feuer wieder unter dem Kessel hervorgezogen, die
Aschenthuͤre geschlossen, die Thuͤre unter dem Hute geoͤffnet,
und die Register-Platte, wie vorher, gestellt; wo dann das Feuer
fortwaͤhrend, wie gewoͤhnlich, sanft fortbrennt, jeden Augenblik zum
Dienste bereit ist, und nur eine sehr geringe Ausgabe veranlaͤßt, wenn man
sie mit jener fuͤr anderes Feuermaterial, z.B. fuͤr Holzkohlen,
vergleicht. Dieses Feuer, wenn es mit Blasebaͤlgen angefacht wird, wirkt
außerordentlich stark, und zeichnet sich durch die Dichtheit und Reinlichkeit des
Brenn-Materiales aus, da dieses keine Flamme gibt, und frei von allem Schwefel ist:
es dient vorzuͤglich gut zum Loͤthen, besonders da es unter dem
daraufgelegten Artikel nicht nachgibt, wie dieß bei den Holzkohlen der Fall ist.
Bei dem Lakiren dichter Koͤrper bediente Hr. Callahan sich ehevor des gewoͤhnlichen Lakir-Ofens, der aus einer
auf dem Feuerherde aufgelegten Gußeisenplatte, und aus Baksteinen gemauerten
Zuͤgen besteht. Außer dem, daß dieser Ofen, wenn er geheizt werden soll,
große Auslagen fuͤr Brenn-Material fordert, muß man auch noch lang warten,
bis das Feuer gehoͤrig brennt, da es oͤfters ausgeht, und nicht so
frei vor Augen liegt, wie das Feuer auf dem Schmiedeherde. Er legt
gegenwaͤrtig nur eine Platte aus Gußeisen uͤber das Feuer in der Esse,
die er auf zwei eisernen Baken ruhen laͤßt, und erhaͤlt dadurch
mittelst der Blasebaͤlge in kurzer Zeit die gehoͤrige Hize. Das Feuer
ist immer zum Loͤthen seiner Waaren bei der Hand, die
Loͤthloͤffel sind im Feuer etc. Mit einem Worte, er dankt alle
Bequemlichkeit bei seinen Arbeiten diesem Ofen.
Das Thuͤrchen, welches oben unter dem Hute in den Zug des Schornsteines
fuͤhrt, dient zur Ableitung aller schaͤdlichen Daͤmpfe von der
Esse in den Schornstein, und reinigt die Luft in der Werkstaͤtte. Wir haben
bemerkt, daß Hr. Callahan seine Arbeiten aus gutem Grunde
in einem oberen Zimmer beizt und bronzirt, welches gleichfalls gehoͤrig geluͤftet ist, um
alles salpetrige Gas und alle sauren Daͤmpfe frei in die Luft entweichen zu
lassen; waͤhrend dort, wo, wie gewoͤhnlich, in dem untersten Stokwerke
gebeizt wird, zum Verderben der Arbeit und mit Belaͤstigung der Arbeiter,
diese Daͤmpfe aufsteigen, und sich in der Werkstaͤtte verbreiten.
Durch Leitung des Dampfes in die oberen Stokwerke kann er sich daselbst leicht
warmes Wasser verschaffen, und auch seine Bronzir-Fluͤßigkeiten hizen. Das
Gefaͤß mit kaltem Wasser, aus welchem der Dampfkessel gefuͤllt wird,
befindet sich gleichfalls in dem oberen Gemache.
Erklaͤrung der Zeichnung.
Tab. II. Fig.
24. zeigt den Schmiedeherd oder die Esse und den Kessel von vorne, und
Fig. 25.
im Durchschnitte oder von der Seite. a, ist die Platte
aus Gußeisen vorne mit einem aufsteigenden Rande. b, ist
die Pfanne oder Esse aus geschlagenem Eisen, c, die
Roͤhre, welche die Luft aus den Blasebaͤlgen herbeifuͤhrt. d, die Oeffnung an der Seite der Esse, durch welche der
Wind eingelassen wird, e, der Hut der Schmiede, wie
gewoͤhnlich auf einer flachen gekruͤmmten Eisenstange gebaut, deren
Ende in die Mauern eingelassen sind; sie wird uͤberdieß noch von einer
eisernen Stange gestuͤzt, welche oben an einem Balken aufgehaͤngt oder
befestigt ist, durch die flache Eisenstange durchlaͤuft, und mittelst einer
Schraube und eines Nietes an derselben befestigt wird. f, ist die untere Thuͤre, die zu dem Aschenloche des Ofens g, fuͤhrt, h, ist die
obere Thuͤre unter dem Hute, hier durch punctirte Linien angedeutet. i, in Fig. 25. sind die
Roststangen des Ofens, gleich hoch gestellt mit der Platte des Schmiede-Ofens a. j, ist der Ofen; k, der
Kessel, der auf den beiden Seitenmauern des Ofens ruht: sein hinteres Ende
naͤhert sich bis auf zwei und einen halben Zoll dem Hinteren Theile des Zuges
in dem Schornsteine, l. m, ist eine eiserne Platte mit
einem Ausschnitte, in welchen das Ende und ein Theil der Seiten des Kessels genau
paßt. Sie noͤthigt die erhizte Luft, da sie in die Endwand und in die
Seitenwaͤnde des Ofens eingelassen ist, nachdem diese unter dem Kessel
durchgegangen und bis an das Ende desselben hinaufgestiegen ist, wieder auf jeder
Seite zuruͤkzukehren, und oben uͤber dem Kessel in den Schornstein zu
entweichen: es ist hier naͤmlich eine Oeffnung zwischen der Platte, m, und der eisernen Platte, n, gelassen, die die Vorderseite des Zuges genau schließt, und zugleich genau auf den oberen
Theil des Kessels paßt. Der Zug haͤlt neun Zoll in der Tiefe, und ist
vierzehn Zoll weit, und da der Kessel vierzehn Zoll lang, und 8 Zoll breit und tief
ist, so steht er nach vorne um zwei und einen halben Zoll vor, um eben so viel, als
er von der Hinterwand des Zuges absteht: die Zuͤge zu jeder Seite desselben
sind drei Zoll weit.
Die Mauer steht vorne zu jeder Seite so weit hervor, daß sie dem Ende des Kessels
gleich kommt, jedoch eine Hoͤhlung uͤber dem Hauptloche laͤßt,
um die Dampf- und Wasserroͤhren zuzulassen. Eine flache eiserne
Register-Platte, o, ist an einer Kette
aufgehaͤngt, die uͤber zwei Rollen laͤuft, und mit einem
Gegengewichte versehen ist, p, welches an dem anderen
Ende der Kette haͤngt, und so schiebt sich die Platte in Beruͤhrung
mit dem Vordertheile des Kessels und den Endmauern auf und nieder, und reguliert den
Durchgang der erhizten Luft unter demselben, und zum Theile um und uͤber den
Kessel. q, ist die Roͤhre, welche das Wasser oben
von dem Behaͤlter herableitet zu dem Speiser des Kessels: sie ist mit einem
Sperrhahne, r, versehen. s,
ist die Roͤhre, welche den Dampf nach aufwaͤrts leitet. Sie ist bei
t, mit der Haupt-Dampfroͤhre, u, verbunden, und hat eine gekruͤmmte
Roͤhre v. unter ihr, um alles Wasser und
Fluͤßige, und alle Saͤure aufzunehmen, die allenfalls von oben
Herabkommen koͤnnte, wenn sich zufaͤllig theilweise ein leerer Raum in
dem Kessel bildet; sie laͤßt dieselbe bei ihrem Ende ausstießen. W, ist ein Sperrhahn in der Hauptdampfroͤhre, und
x, eine daran eingefuͤgte gekruͤmmte
Roͤhre, die jede erforderliche Lage annimmt, wie die Sprizroͤhre an
einer Feuermaschine: diese Beweglichkeit erhaͤlt sie durch Drehung der
dampfdichten Gefuͤge, yy. Diese
Roͤhre ist es, welche, wenn der Sperrhahn z,
geoͤffnet wird, den Dampf durch irgend einen der hohlen Koͤrper durch
fahren laͤßt, welche vor dem Lakiren erhizt werden muͤssen. 1, ist die
Aichroͤhre zur Bestimmung, ob die gehoͤrige Menge Wassers in dem
Dampfkessel enthalten ist. 2, ist eine Roͤhre, um noͤthigen Falles,
heißes Wasser aus dem Kessel abfließen zu lassen. 3, ist der Theil, welcher die
Roͤhre, die das Wasser zufuͤhrt, mit dem Kessel verbindet. Dieser
Theil ist mit dem abgeaͤnderten Franklin'schen
Speiser, und mit anderen Theilen, in Fig. 26 und 27. in
vergroͤßertem Maßstabe besonders dargestellt. q, ist die
Wasserroͤhre, verbunden durch das Verbindungs-Gelenk, 4, mit dem Theile, 3.
5. in Figur
26. ist eine beladene kegelfoͤrmige Klappe (hier durch punctirte
Linien angedeutet), so daß der breitere Theil des Kegels oben steht. An dieser
Klappe befindet sich ein Draht-Staͤngelchen, das durch die Roͤhre, 6,
niedersteigt, und dessen Ende unten uͤber dem Boden dieser Roͤhre
etwas hervorsteht. 7, ist ein gabelfoͤrmiger Hebel, welcher an dem Arme, 8,
haͤngt, der an der unteren Seite der Platte oder des Dekels des Hauptloches,
9, befestigt ist. Von den beiden Seiten der Gabel steigen die Stangen, 10, 10, unter
den Boden der Roͤhre, 6, hinab, und fuͤhren eine flache Platte, 11,
die zwischen denselben aufgehaͤngt ist, und mit dem Klappendrahte
zusammentrifft. Dadurch wird die Klappe gehoben, sobald es nothwendig wird neues
Wasser in den Kessel nachzuschuͤtten, was man daran erkennt, daß der hohle
kupferne Schwimmer, 12, der an dem Ende des gabelfoͤrmigen Hebels, 7,
haͤngt, durch das Sinken des Wassers in dem Kessel niedergedruͤkt
wird; wo dann unmittelbar das kuͤrzere Ende, sammt den daran befestigten
Stangen und der Platte, in die Hoͤhe steigt, und die Klappe, 5, aus ihrer
Lage hebt, wodurch dann das Wasser solang in den Kessel zustießen kann, bis es die
gehoͤrige Hoͤhe erreicht hat, und dann die Klappe wieder schließt. 13,
ist ein Gegengewicht an einem Arme, der von einer der Gabeln des Hebels, 7,
auslaͤuft, und zwar an dem entgegengesezten Ende des Hebels: dadurch wird der
Schwimmer auf der Oberflaͤche des Wassers schwebend erhalten. Alle diese
Theile gehen leicht durch das Hauptloch des Kessels. Außer der Platte, 11,
fuͤhren die Stangen, 10, 10, gleichfalls noch einen Ring, 14, der die
Roͤhre, 6, umfaßt, und zur Leitung der Bewegungen derselben auf- und
abwaͤrts fuͤhrt. 15, ist das Verbindungs-Stuͤk fuͤr die
Haupt-Dampfroͤhre, u, welche mittelst des
Vereinigungsstuͤkes, 16, damit verbunden wird. Oben ist die beladene Druk-
oder Sicherheitsklappe, 17; die Stange der kegelfoͤrmigen Klappe wird durch
ein Loch in dem Mittelpuncte der Kreuzstange, unter dem Size der Klappe, wie
gewoͤhnlich, durchgefuͤhrt. 18, ist die Klappe fuͤr das Vacuum:
der Kegel derselben wird nach unten weiter; sie wird durch ein Gegengewicht, 19, in
ihrer Lage erhalten, das durch eine Stellschraube, 20, auf einem Ende des Hebels,
21, befestigt ist, der
sich um einen kleinen Pfeiler, 22, als um seine Unterlage dreht: dieser Pfeiler
steht oben auf dem Dekel des Kessels, 9. Der kupferne Schwimmer, 12, besteht aus
einem kurzen Cylinder, mit zwei verkehrt sphaͤrischen Enden, welchen Hr. Callahan dem gewoͤhnlichen Marmorbloke in den
Kesseln der Dampfmaschinen vorzieht.
Nach dieser Figur und Beschreibung wird sich wahrscheinlich eine aͤhnliche
Vorrichtung leicht nachmachen lassen. Es ist wirklich merkwuͤrdig zu sehen,
wie schnell, wenn die Kohlen unter den Kessel gebracht werden, und die Luft durch
das Feuer von unten durchgelassen wird, bloß durch diesen Zug, wenn man die beiden
Thuͤren schließt (da der senkrechte Zug an 10 Fuß hoch ist), das immer heiß
gehaltene Wasser zu kochen anfaͤngt, und Dampf entwikelt. Wenn man die Arbeit
unterbrechen will, oͤffnet man bloß die obere Thuͤre, und das Feuer
verliert auf der Stelle seine Kraft, bis man es neuerdings wekt.
Tafeln