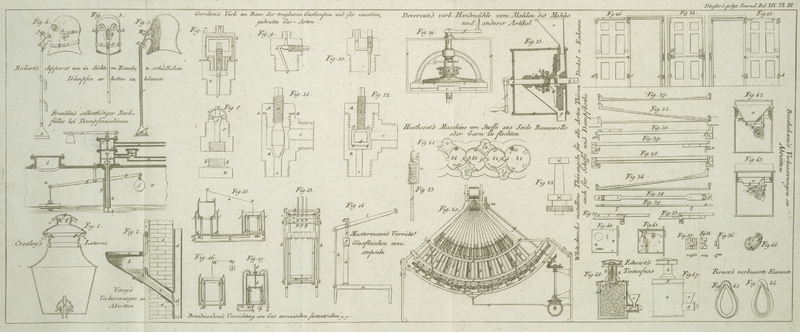| Titel: | Verbesserungen und Zusäze an Abtritten, worauf sich Jak. Viney, Oberst der Artillerie auf der Insel Wight, am 6. Mai 1824 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. XLIII., S. 173 |
| Download: | XML |
XLIII.
Verbesserungen und Zusaͤze an Abtritten,
worauf sich Jak. Viney,
Oberst der Artillerie auf der Insel Wight, am 6. Mai 1824 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. N. 58. S.
140.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Viney's, Verbesserungen und Zusaͤtze an
Abtritten.
Der Zweck dieser Verbesserung ist, den Unrath aus den
Abtritten auf eine einfachere und bequemere Weise, als bisher, wegzuschaffen. Der
Hr. Oberst schlaͤgt vor, den Abtritt und seine Roͤhren auf die hier
Tab. III. Fig.
2, dargestellte Weise zu bauen. aa, ist
der Durchschnitt der Mauer des Hauses, an welcher der Abtritt sich befindet. b, ist der Abtritt oder das Becken, in welches der
Unrath entleert wird. c, ist die
Ableitungsroͤhre, die sich mittelst einer Fallthuͤre in eine außen an der
Wand senkrecht hinabsteigende Roͤhre, dd,
oͤffnet. Diese Roͤhre, d, steht oben nach
der Luft zu offen, und fuͤhrt unten in den Canal oder in die Kloake. e, ist eine Roͤhre, die aus einem
Wasserbehaͤlter uͤber, b, Wasser
herabfuͤhrt, und sich unten in zwei Arme theilt, f. In der Roͤhre, d, befindet sich eine
Klappe, um den Zufluß des Wassers zu reguliren. Wenn diese Klappe geoͤffnet
wird, fließt das Wasser durch den Arm der Roͤhre, f, in die Roͤhre, g, die an dem oberen
Rande des Bekens herumlaͤuft. Diese Roͤhre, g, ist entweder unten mit einem Laͤngenspalte oder mit mehreren
Loͤchern versehen, durch welche das Wasser ausfließt, und die Waͤnde
des Bekens abwaͤscht.
Wenn der Abtritt nicht gebraucht wird, laͤßt man das Fallbrettchen, h, herab, so daß es die Muͤndung der
Roͤhre, c, schließt, und das Wasser in dem Beken
bis zur punctirten Linie hinauf stehen laͤßt, so daß kein uͤbler
Geruch durch diese Roͤhre heraufdringen kann: das uͤberfluͤßige
Wasser wird durch die punctirte Roͤhre nach, d,
abgefuͤhrt.
Nachdem der Abtritt gebraucht wurde, wird die Schnur, i,
gezogen, die an dem Fallbrettchen, h, befestigt ist, und
oben uͤber Rollen laͤuft; dadurch wird das Fallbrettchen gehoben, und
was in dem Beken enthalten ist, fließt aus, indem es die Fallthuͤre am Ende
der Roͤhre oͤffnet; diese schließt sich hierauf sogleich wieder, so
daß kein Geruch durch die Roͤhre, c,
heraufdringt. Der Geruch aus, d, entweicht in die
LuftWir haben im polyt. Journ. B. XV. S.
436. einen bequemeren Abtritt angegeben. Bei uns wuͤrden
diese Fallthuͤren im Winter einfrieren. Auch ist die obere Oeffnung
bei, d, ganz uͤberfluͤßig. A. d.
Ueb..
Tafeln