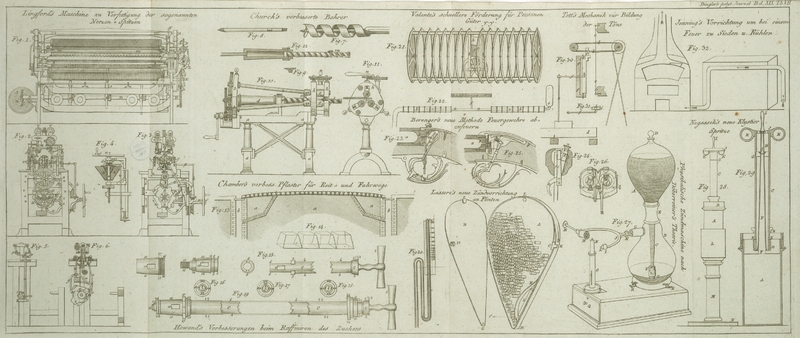| Titel: | Verbesserung, oder neue Methode, Feuergewehre abzufeuern, worauf Karl Random Baron de Berenger am 27. Julius 1824 sich ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. LXXXI., S. 330 |
| Download: | XML |
LXXXI.
Verbesserung, oder neue Methode, Feuergewehre
abzufeuern, worauf Karl Random
Baron de Berenger am 27. Julius
1824 sich ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. N. 58. S.
129.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Random's Verbesserung, oder neue Methode, Feuergewehre
abzufeuern.
Wir haben den langen Titel dieses Patentes im Polytechn.
Journ. B. XV, S. 120. zu seiner Zeit
mitgetheilt. Der Zwek des Patent-Traͤgers ist, den groͤßten Theil des
Mechanismus an den gewoͤhnlichen Flintenschloͤssern zu beseitigen, und
nur eine Hauptfeder anzubringen, welche mit Huͤlfe eines Hebels zum Abfeuern
des Gewehres vollkommen hinreicht, eben so gut als die gewoͤhnlichen
Schloͤsser ist, und durchaus nicht so hoch zu stehen kommt. Die
Grundsaͤze, auf welchen diese Verbesserung beruht, lassen sich auf
verschiedene Weise anwenden: eine derselben hat der Hr. Baron Tab. VII, Fig.
23–26 abgebildet, und auf folgende Weise beschrieben.
Fig. 23. ist
der Laͤngen-Durchschnitt eines Theiles des Laufes und Schaftes der Flinte;
Fig. 24.
ist ein Querdurchschnitt, wo die wirkenden Theile des Schlosses von ruͤkwarts
dargestellt sind. In beiden Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben dieselben
Gegenstaͤnde, a, ist der Lauf; b, die sogenannte Patent-Kammer (Patent-breach) mit einer concaven Kammer zur Aufnahme der Pulver-Ladung.
An dem Hintertheile der Kammer ist ein kegelfoͤrmiger Ausschnitt, und eine
kleine Oeffnung aus der Kammer nach ruͤkwarts zu dem Zuͤndloche, c. d, ist eine Buͤchse oder Behaͤlter,
worin sich das Knallpulver zum Abfeuern befindet: diese Buͤchse schiebt sich
von der Seite her und zuruͤk. e, ist die
Hauptfeder, an welcher der Zapfen angebracht ist, der in das Zuͤndloch
schlaͤgt und das Stuͤk abfeuert.
Die Hauptfeder ist an dem Hebel, f, angebracht. Wenn man
denselben vorwaͤrts schiebt, wird die Feder, wie Fig. 23. zeigt,
zuruͤkgezogen, wo dann ein kleiner Stift, g, der
von dem unteren Theile des Hebels auslaͤuft, gegen einen
Feder-Haͤlter, h, ansteht, und die Hauptfeder in
einem Zustande von Spannung erhaͤlt, i, ist der
Druͤker, welcher, wenn man ihn, wie gewoͤhnlich bei dem Abfeuern,
zuruͤkzieht, den Feder-Halter h,
niederdruͤkt, den Hebel, f, frei macht, wo dann
die Kraft der Hauptfeder diesen vorwaͤrts treibt, und den Zapfen, m, in das Zuͤndloch, c, schlagen laͤßt, wodurch das Gewehr abgefeuert wird.
Wenn man wieder aufschuͤtten will, wird der Hebel, k, der an dem Schwanzstuͤke des Behaͤlters, d, angebracht ist, einwaͤrts gedruͤkt
werden, wodurch die Oeffnung vorne an dem Behaͤlter dem Zuͤndloche
gegenuͤber gestellt wird, wo dann eine hinlaͤngliche Menge
Knallpulvers zum Abfeuern der Flinte in das Zuͤndloch kommen, und der
Behaͤlter in seine vorige Lage, wie in Fig. 24. durch die Kraft
der kleinen Seitenfeder, e, zuruͤktreten wird,
welche Feder ein Stuͤk Metall fuͤhrt, das die Oeffnung des
Behaͤlters dekt, wenn das Gewehr in Ruhe ist, damit das Pulver in demselben
zuruͤkgehalten wird, aber wieder weggeschoben wird, wenn es gegen den
Ruͤken der Kammer kommt, sobald das Magazin oder der Behaͤlter in die
Lage zum Abfeuern kommt.
Eine kleine Finger-Schraube, n, schließt eine Oeffnung
oben an dem Behaͤlter, d, bei welcher Oeffnung
das Knallpulver in die Kammer eingefuͤhrt, und der untere Theil des Hebels,
f, in die Hoͤhe gekehrt wird auf einer Feder,
die gegen die Aussenseite des Waͤchters eingefuͤgt ist, damit sie
nicht zu weit vorsteht. Es sind mehrere Abaͤnderungen dieser Vorrichtung
angegeben, der Grundsaz bleibt aber uͤberall derselbe.
Wenn diese Erfindung auf ein Gewehr mit Doppellaͤufen angewendet werden soll,
ist eine andere Vorrichtung angegeben, die in Fig. 25. im
Laͤngen-Durchschnitte dargestellt ist, und in Fig. 26. im
Quer-Durchschnitte. a, ist der Lauf, b, die Pulverkammer mit einem kegelfoͤrmigen
Einschnitte mit einem Durchgange zum Zuͤndloche, c, welches das cylindrische Stuͤk, d,
ist, das von der Kammer vorragt. Auf diesen cylindrischen Stuͤken, d, die von den beiden Laͤufen auslaufen, sind
gezaͤhnte Ringe, ee, befestigt, die man in
Fig. 26
sieht, und auf diesen Ringen sind Buͤchsen, ff, zur Aufnahme des Knallpulvers. Es sind auch Zahnstoͤke, gg, angebracht, die in die Zahnringe eingreifen,
und wenn man diese Zahnstoͤke aufwaͤrts und abwaͤrts schiebt,
was mittelst eines unten befindlichen Knopfes geschieht, so drehen sich die Ringe
auf den cylindrischen Stuͤken und mit diesen die Pulverbuͤchsen.
Wenn der Zahnstok aufwaͤrts geschoben wird, wird die Buͤchse f, an der unteren Seite seyn, wie bei dem Laufe zur
Linken in Fig.
26; wenn aber der Zahnstok niedergezogen wird; wie bei dem Laufe rechts,
so wird die Buͤchse, f, oben seyn, und in dieser
Lage wird sie durch eine Oeffnung im Boden der Buͤchse in das
Zuͤndloch etwas weniges von dem Knallpulver absezen. Dieses Umdrehen der
Zuͤndbuͤchsen kann ohne die Zahnstoͤke, g, bewirkt werden; ein Stift der durch den Schaft hinter der Kammer
laͤuft, wie, zz, in punctirten Linien
zeigt, mit einem Rosenknopfe, und einer Schraube ohne Ende, greift in die gezahnten
Ringe, und dient eben so gut, als die Zahnstoͤke. An den Seiten der
Buͤchse befinden sich Thuͤrchen zur Aufnahme des Knallpulvers.
Der Schlag, der das Gewehr abfeuert, wird durch das Niedersteigen eines Stiftes an
der Hauptfeder, p, hervorgebracht. Diese Feder wird
durch eine Schneke, q, (Fig. 27.Diese Figur fehlt im Originale. A. d. U. ) oben auf dem Schafte, r, hinauf, gebogen und
dadurch gespannt. Unten auf dem Schafte, r, befindet sich ein
gekruͤmmter Hebel, s, der, wenn er umgekehrt
wird, den unteren Theil der schiefen Flaͤche oder Schneke unter die
Hauptfeder hineinbringt (ihre Lage ist fuͤr diesen Fall durch Puncte
angedeutet), und so wie diese Schneke sich fort aufrollt, hebt sie die Feder in den
Zustand von Spannung, den die Figur zeigt. Dieses Drehen des gekruͤmmten
Hebels, s, bringt ein kleines durchgeschlagenes Loch an
seinem Schweife uͤber einen Feder-Halter, t, der
in dieses Loch einschluͤpft, wenn die Feder in ihre hoͤchste Spannung
gebracht ist, und dann ist die Flinte schußfertig.
Wenn der Druͤker, v, mit dem Finger
gedruͤkt wird, wird ein Stift an der unteren Seite desselben die Feder des
Halters, t, niederdruͤken, welche, wenn sie aus
dem durchgeschlagenen Loche heraustritt, den Hebel, s,
befreit; zu gleicher Zeit treibt aber eine kleine schiefe Flaͤche an der
Seite des Halters den Hebel etwas weiter herum, und bringt dadurch die gerade Seite
der Schneke q, in eine solche Lage, daß die Hauptfeder
herausschluͤpft, wo dann der Stift mit Gewalt in das Zuͤndloch
einfaͤllt, das Knallpulver entzuͤndet, und das Gewehr abfeuert.
Der Zwek ist, die Hauptfeder den Schlag fuͤhren zu machen, und alle kleineren
Theile zu ersparen.
Tafeln