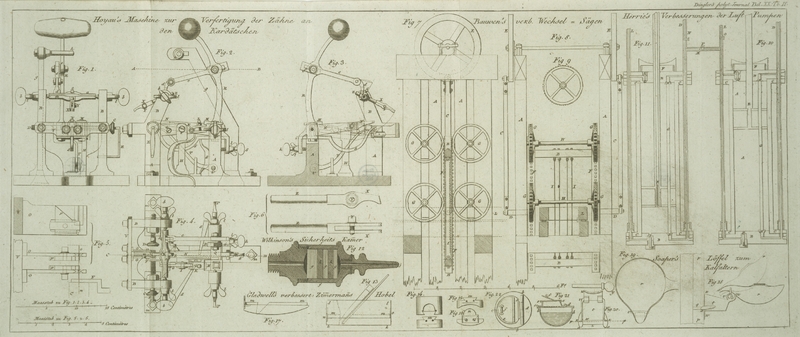| Titel: | Beschreibung einer Maschine zur Verfertigung der Zähne an den Kardätschen; von Hrn. Hoyau. |
| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. V., S. 19 |
| Download: | XML |
V.
Beschreibung einer Maschine zur Verfertigung der
Zähne an den Kardätschen; von Hrn. Hoyau.
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement
pour l'Industrie nationale N. 255. S. 271.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Hoyau's, Beschreibung einer Maschine zur Verfertigung der Zähne an
den Kardätschen.
Die Fabrication der Kardaͤtschen ist ein wichtiger Zweig der Kunst des
Spinn-Muͤllers; um einen gleichen Faden zu erhalten, muß das zu spinnende
Material gehoͤrig zugerichtet seyn, und die erste Operation,Dieß ist nicht ganz technisch richtig. A. d. Ueb. welcher man dasselbe unterzieht, ist das Kardaͤtschen. Die
Vervollkommnung der Kardaͤtschen hat folglich einen ausgezeichneten Einfluß
auf den Erfolg des Spinnens. Man kann sich dieß leicht erklaͤren, wenn man
bedenkt, daß der Stoff, aus welchem der Faden gesponnen werden soll, erst in
Blaͤtter, und dann in Wikel gebracht, hierauf ausgezogen, und dann alsogleich
auf die Werkbank kommen muß, um darauf in Faden gesponnen werden zu koͤnnen. Die
Gleichheit des Fadens waͤhrend seines Durchganges durch alle diese
verschiedenen Operationen haͤngt aber wesentlich von der Gleichheit ab, mit
welcher die erste Vertheilung des zu spinnenden Stoffes geschehen ist. Das
Kardaͤtschen muß demnach als die wichtigste Operation der
Spinn-Muͤhlen betrachtet werden.
Die Kardaͤtschen, bloß in jenem Theile betrachtet, welcher die Vertheilung des
Stoffes bewirkt, bestehen aus Leder-Streifen, in welchen man kleine Zaͤhne
aus Eisendraht einfuͤgt, die die Form eines Rechtekes, darbiethen, an welchem
man eine der kleineren Seiten weggelassen hat, und dessen beide groͤßere
Seiten gegen die Mitte ihrer Laͤngen und nach einer schiefen Richtung gegen
die Ebene des Zahnes gekruͤmmt sind.
Um eine gute Kardaͤtsche zu machen, muß der Zahn eine regelmaͤßige Form
haben; es muͤssen die beiden Spizen, die ihn bilden, von gleicher
Laͤnge seyn; das Querstuͤk, das sie verbindet, muß genau einen rechten
Winkel mit den Seiten bilden, und der Abstand dieses Querstuͤkes von den
Seiten, oder die Laͤnge desselben muß mit den in das Leder gestochenen
Loͤchern in genauem Verhaͤltnisse stehen.
Die Maschine, die wir hier beschreiben wollen, ist diejenige, deren man sich
allgemein zur Verfertigung der Zaͤhne bedient. Man bedient sich derselben
beinahe in allen Kardaͤtschen-Fabriken, und sie hat bei ihrer ersten
Entstehung nur wenige Veraͤnderungen erlitten.
Der Grundsaz, nach welchem sie gebaut ist, beruht auf den Operationen, welche den
Draht nach und nach zur Annahme der Form eines Zahnes fuͤhren:
1) den Draht in der gehoͤrigen Laͤnge abschneiden; 2) denselben so
biegen, daß die beiden Seiten-Theile einen vollkommen rechten Winkel mit dem
Querstuͤke bilden; 3) die beiden Enden so neigen, daß sie einen
gehoͤrigen Winkel bilden, den man den Biß des Zahnes (le croc de la dent) nennt.
Diese drei Wirkungen erhaͤlt man mittelst verschiedener beweglicher
Stuͤke, die den Mechanismus der Maschine bilden.
Die Maschine besteht aus einem kupfernen Gestelle, A,
Fig. 1,
2, 3, 4., welches aus
einer Basis oder einer Sohle besteht, auf welcher diejenigen Stuͤke, die den
beweglichen Theilen der Maschine als Stuͤze dienen, aufgezogen, und
gehoͤrig befestigt sind. Durch zwei Baken, BB, laufen zwei staͤhlerne Schrauben, C und D; die erstere, C, ist in
ihrem Mittelpuncte durchbohrt, und in diesem Loche wird ein kleiner Cylinder
aufgenommen, welcher einen der Arme des Stuͤkes, E, bildet. Ueber diesem Cylinder, und in dem Theile, welcher in die
Schraube eintritt, hat man eine kleine Vertiefung, n, in
Fig. 5.,
angebracht, die den Draht, o, aufnimmt, der die
Zaͤhne bilden soll. Durch diese Vorrichtung kann man, da das kleine
Stuͤk, E, sich leicht aus dem Loche der Schraube
herausnehmen laͤßt, den Durchgang fuͤr den Draht leicht puzen, und
alle Abfaͤlle, die demselben den Eingang verlegen koͤnnten,
koͤnnen weggeschafft werden. Die andere Schraube, D, dient dem Drahte als Aufhaͤlter, und beschraͤnkt die
Laͤnge des Theiles, welcher den Zahn bilden soll.
An dem Ende der ersten Schraube, C, hat man ein Messer,
F, angebracht, welches an dem Ende der Schraube
hinstreift, und den Draht schneidet. Dieses Messer besteht aus mehreren
zusammengeschraubten Stuͤken: 1) aus der Klinge, welche einen doppelten
Elbogen, F, darbiethet. 2) aus dem Hebel, G, auf dessen Ende die Klinge befestigt ist. 3) aus
einer Stuͤze, H, deren oberes Ende eine Kappe
zeigt, die den Hebel aufnimmt, und durch welche, so wie durch den Hebel, ein Bolzen,
I, quer durchlaͤuft, welcher den Mittelpunct
der Bewegung des Messers bildet. 4) aus einem kleinen Stuͤke mit einem
Gewinde, K, welches auf dem Ende dieses Hebels
aufgezogen ist, und mittelst der kleinen Schraube, L,
sich heben oder senken kann. Es dient zur Regulirung der Hoͤhe, in welcher
das Messer gehoben werden muß, welches durch die Taste, M, bewegt wird.
Nachdem der Draht auf diese Weise nach seiner Laͤnge abgeschnitten wurde, wird
er von dem Stuͤke, N, gebogen, welches denselben
zwischen die kleinen Stuͤke, OO, treibt.
Der Bieger, N, hat seinen Mittelpunct der Bewegung in
den zwei Zapfen-Schrauben, PP, welche in zwei
Pfannen laufen, die an den beiden Enden der Achse, Q,
angebracht sind. Diese Achse traͤgt einen Hebel, R, dessen Ende mit einem Griffe versehen ist, an welchem man die Hand
anlegt, um die Maschine in den Gang zu bringen. Unter dem Bieger, N, befindet sich das Stuͤk, S, welches den Draht aufnimmt, so daß, wenn man den
Bieger, N, niederlaͤßt, der Draht in der Mitte
gekneipt wird. Ein anderes kleines Stuͤk, T,
laͤuft zwischen, N und S, um den Zahn, nachdem er gebildet wurde, wegzustoßen. Das Stuͤk, S, hat seinen Mittelpunct der Bewegung in der Achse der
Spindel, Q; deßwegen befindet sich in dieser Achse ein
bis auf den Mittelpunct eindringendes vierekiges Loch, in welches eine kleine
Huͤlse paßt, welche die Achse des Stuͤkes, S, fuͤhrt. Sie biegt sich hierauf, und nimmt eine Schraube, S', auf, welche den Lauf derselben beschraͤnkt,
wenn sie sich hebt. Die Feder, S'', strebt sie in die
Hoͤhe zu heben, und die Lage, wie in Fig. 3., anzunehmen. Das
Stuͤk, T, dreht sich um den Mittelpunct, U. Die beiden Zwillings-Stuͤke, OO, sind auf einem Querbalken, V, befestigt, und koͤnnen sich in Falzen
schieben, die in demselben angebracht sind: dadurch koͤnnen sie sich von
einander entfernen, oder sich einander naͤhern, um genau jene Entfernung zu
halten, die die Groͤße des Zahnes fordert; d.h., ihre Entfernung ist so groß,
daß der Bieger, N, zwischen beide eintritt, und zu jeder
Seite soviel Abstand laͤßt, als der Durchmesser des Fadens betragt. Alle
diese Stuͤke dienen bloß dazu, um die beiden Arme des Zahnes zu biegen. Das
Stuͤk, X, dient, die beiden Enden
zuruͤkzuschlagen, und den sogenannten Biß des Zahnes zu bilden; es sieht aus
wie eine kleine Gabel, deren Arme als Feder dienen, und mittelst einer Schraube, Y, sich einander naͤhern koͤnnen. Der
Schweif, Z, laͤuft durch eine Spindel, a, deren beide Enden sich auf Zapfen auf den
Spizen-Schrauben, bb, drehen. Dieser Schweif, der
walzenfoͤrmig ist, und durch ein in der Spindel angebrachtes Loch
laͤuft, ist mittelst einer kleinen Drukschraube, c, auf dem gehoͤrigen Puncte befestigt. Die Spindel, a, erhaͤlt ihre Bewegung durch den Hebel, R, der die ganze Maschine mittelst eines kleinen
Hebel-Armes, d, welcher darauf befestigt, und dessen
Ende wie der Kopf eines Zirkels gebaut ist, und eine Verbindungs-Stange, e, aufnimmt, in Thaͤtigkeit sezt. Das Ende dieser
Stange nimmt einen kleinen Drehezapfen auf, der an dem Hebel, R, befestigt ist, und sich in einem Loche dreht, welches in demselben
Hebel angebracht ist. Man kann, mittelst des Ausschnittes, f, diesen Zapfen in eine solche Entfernung stellen, daß der Beisser, X, den Zahn in dem schiklichen Augenblike ergreift. Um
den Lauf des bewegenden Hebels, R, zu
beschraͤnken, hat man einen eisernen Arm, g,
angebracht, dessen oberes Ende in einem Falze einen Aufhaͤlter, h, aufnimmt, den man in der gehoͤrigen Entfernung
befestigt. Die Spindel des Hebels, R, fuͤhrt
einen kleinen Arm, i, der eine Schraube, k, aufnimmt, die den Ruͤkgang des Hebels, R, beschraͤnkt: alle Schrauben und Zapfen der
Baͤume und der uͤbrigen Stuͤke sind mit kupfernen
Gegenschrauben, llll, versehen, welche sie in der
Lage festhalten, in welche man sie gebracht hat. Die Maschine selbst ist auf einer
hoͤlzernen Bank, mittelst dreier Schrauben-Nieten, m, befestigt.
Nach dieser Beschreibung der Maschine wird man das Spiel derselben leicht begreifen.
Der Arbeiter schiebt zuvoͤrderst mit der Hand den Draht, welcher auf einem
neben ihm stehenden Haspel aufgewunden ist, so lange vor, bis er an dem Kopfe der
Schraube, D, ansteht. Dann laͤßt er den Hebel,
R, wirken, welcher die auf der Spindel, Q, befestigten Stuͤke mit in Bewegung bringt. Die
Taste, M, druͤkt, in dem ersten Theile der
Bewegung, auf das Stuͤk, K, des Hebels, welches
das Messer, F, fuͤhrt; dieses schneidet den
Draht, welcher, in demselben Augenblike, zwischen den Stuͤken, N und S, gekneipt, und
gezwungen wird, sich unter rechten Winkeln nach beiden Seiten uͤber dem
Bieger, N, zu biegen. Nachdem dieses geschehen ist,
aͤußert der Bieger, N, seine Wirkung auf die
beiden Enden des Drahtes, und bildet die beiden Spizen des Zahnes, indem er
denselben den Bug oder den Biß gibt. So wie die Bewegung fortfaͤhrt, kommt
der Zahn niedriger, als die beiden kleinen Stuͤke, OO, und das Stuͤk, T, tritt zwischen, N und S, wodurch er herausgeschafft wird.
Auf diese Weise vorgerichtet, kann diese Maschine nur mit der Hand getrieben werden.
In einigen Fabriken hat man aber eine Vorrichtung angebracht, welche den Faden
einfuͤhrt, so daß diese Maschine dann durch irgend eine Triebkraft in
Thaͤtigkeit gesezt werden kann. Diese Vorrichtung besteht in einem gegen die
Schraube, C, angebrachten kleinen Walzenwerke, welches
von zwei Walzen gebildet wird, deren untere den Draht fuͤhrt, und auf ihrer
Achse ein Sperrrad, in dessen Zaͤhne das hakenfoͤrmige Ende eines
Hebels eingreift, der mit der Triebkraft in Verbindung steht. Dieser Hebel, der bei
jedem Stoße geschoben wird, dreht das Sperr-Rad, und folglich auch den Cylinder, um
eine bestimmte Streke, wodurch eine zur Bildung eines jeden Zahnes noͤthige
Drahtlaͤnge nachgeschoben wird.
Es ist aber nicht genug, die Zaͤhne der Kardaͤtsche gebildet zu haben:
man muß dieselben auch noch einziehen, und sie in den durchaus gleichbreiten
Leder-Streifen befestigen, welche mit einer Menge kleiner, in regelmaͤßiger
Entfernung stehender Loͤcher versehen sind. Diese Arbeit, die
gewoͤhnlich das Werk der Weiber ist, und die man das Stechen (bouter) nennt, ist langweilig, und
wird oͤfters schlecht gemacht. Man hat versucht, sie durch eine Maschine zu
ersezen, die diese drei Operationen zugleich verrichtet, den Zahn bildet, den
Lederstreifen durchsticht, und die Haken darin befestigt. Hr. Ellis, Buͤrger der vereinigten Staaten, hat diese Maschine nach
Frankreich gebracht: man findet sie in dem Artikel Cardier
des Dictionnaire technologique beschrieben. Es gibt in Frankreich mehrere
andere Maschinen dieser Art; sie scheinen aber im Allgemeinen zu sehr
zusammengesezt, und gerathen zu leicht in Unordnung. In einigen Fabriken
fuͤgt man auch noch jezt die Zaͤhne mit der Hand ein. Das Leder wird
gewoͤhnlich mittelst einer Maschine durchstochen, die mehrere Loͤcher
auf ein Mahl sticht.
Erklaͤrung der Figuren.
Fig. 1. Die
Maschine zur Verfertigung der Kardaͤtschen von vorne.
Fig. 2. Aufriß
derselben von jener Seite, auf welcher man den Faden einfuͤhrt.
Fig. 3.
Durchschnitt nach der Linie, CD, des
Grundrisses.
Fig. 4.
Grundriß der Maschine nach der Linie, AB, in Fig. 2.
Fig. 5.
Mechanismus zum Biegen des Drahtes, einzeln im Grundrisse und im Aufrisse nach einem
groͤßeren Maßstabe gezeichnet.
Fig. 6.
Ansicht von der Seite und Grundriß des Beissers oder der Gabel zur Bildung der Haken
der Zaͤhne der Kardaͤtschen.
Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in allen Figuren.
A, Gestell der Maschine aus Kupfer, auf einer Sohle aus
demselben Metalle. BB, Pfeiler oder Balken,
zwischen welchen die beweglichen Theile der Maschine spielen. C, Schraube mit einem Loche in ihrem Mittelpuncte zur Aufnahme eines
kleinen Cylinders, welcher den Draht durchlaͤßt; D, andere Schraube, welche dem Drahte als Aufhaͤlter dient. E, Cylinder, welcher unter einem rechten Winkel gebogen
ist, und in die Schraube, C, eingreift. F, Messer, welches den Draht abschneidet. G, Hebel, auf dessen Ende die Klinge des Messers
befestigt ist. H, Stuͤze, welche den vorigen
Hebel aufnimmt. I, Schraube, welche den Mittelpunct der
Bewegung des Messers bildet. K, ein Stuͤk mit
einem Gewinde, auf dem Ende des Hebels, G, aufgezogen.
L, kleine Schraube, welche die Hoͤhe regelt,
in welcher das Messer gehoben werden soll. M, Taste,
welche das Messer bewegt. N, Stuͤk, welches den
Draht in Form eines doppelten rechten Winkels biegt. OO, andere Stuͤke, zwischen welchen der Draht gebogen wird. PP, Schraube mit einem Zapfen, die als Achse auf
der horizontalen Spindel, Q, dient. R, Hebel mit einem Griffe, an welchen man die Hand legt.
S, Stuͤk unter, N, welches den Draht aufnimmt. S', Schraube,
welche den Lauf des vorigen Stuͤkes beschraͤnkt. S'' S'', Federn, wovon die
eine den Bieger, N, die andere das Stuͤk, S, hebt. T, kleines
Stuͤk, welches den Zahn nach seiner Bildung hinaustreibt. V, Querstuͤk, auf welchem die beiden
Stuͤke, OO, sich der Laͤnge
desselben nach hin und her schieben. X, Beisser in Form
einer kleinen Gabel. Y, Schraube, welche die
Zaͤhne dieser Gabel einander naͤhert. Z,
Schwanz des Beissers.
a, Spindel, durch welche der Schweif, Z, laͤuft. bb,
Schraubenspize, die dieser Spindel als Zapfen dient. c,
Drukschraube, die auf den Schweif, Z, wirkt. d, Hebelarm, der auf dem Arme, R, befestigt ist. e, Verbindungs-Stange dieses
Armes. f. Einschnitt, welcher den Drehezapfen der
Stange, e, in bestimmte Entfernung stellen laͤßt;
g, eiserner Arm, welcher den Lauf des Hebels, R, beschrankt. h,
Aufhaͤlter, gegen welchen dieser Hebel stoͤßt. i, kurzer Arm, welcher den Ruͤkgang des Hebels beschraͤnkt.
k, Schraube dieses Armes. llll, kupferne Gegenschrauben der Schrauben, m, Schrauben-Niete, welche die Maschine auf einer
hoͤlzernen Bank beschraͤnken. n, Furche,
die den Draht, o, aufnimmt. pp, kleine Stuͤke aus gehaͤrtetem Stahle, die durch
Schrauben zwischen den Stuͤken, OO,
befestigt sind, und die man ersezen kann, wenn sie durch die Reibung des Drahtes
unbrauchbar geworden sind.
Tafeln