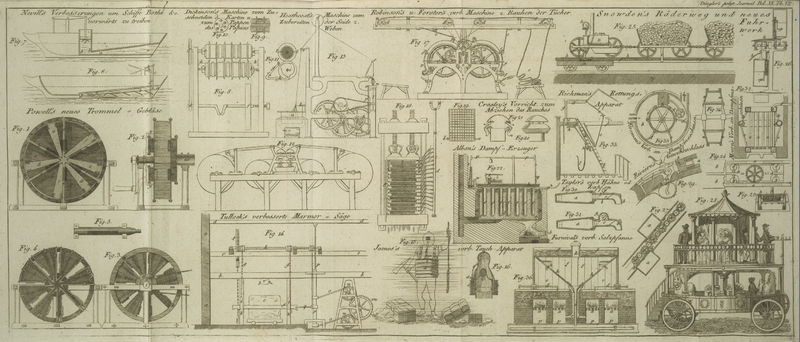| Titel: | Neu erfundenes Trommel-Gebläse, worauf Karl Powell, Gentleman zu Rockfield in Monmuthshire, sich am 7. Junius 1825 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. XCIV., S. 338 |
| Download: | XML |
XCIV.
Neu erfundenes Trommel-Gebläse, worauf Karl Powell, Gentleman zu
Rockfield in Monmuthshire, sich am 7. Junius
1825 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. N. 52. S.
343.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Powell's, neu erfundenes Trommel-Gebläse.
Dieses verbesserte Trommel-Geblaͤse enthaͤlt mehrere
Scheidewaͤnde, welche das Innere desselben in mehrere Abtheilungen oder Luftkammern theilen, in
deren jeder sich ein Staͤmpel in der Richtung des Halbmessers befindet. So
wie die Trommel sich um ihre Achse dreht, fallen die Staͤmpel von einer Seite
nach der anderen durch ihre Schwere, und treiben die Luft aus durch Klappen, die
sich nach auswaͤrts oͤffnen, und erhalten neue Luft fuͤr die
Luftkammern durch Klappen, die sich nach innen oͤffnen.
Die Anwendung des obigen Grundsazes erlaubt einige Abaͤnderungen im Baue
dieser Maschine; der Patent-Traͤger waͤhlt jedoch die auf Fig.
1–5 dargestellten Formen. Fig. 1. ist ein
Durchschnitt des Geblases, wovon die eine Wand abgenommen ist, um die innere
Einrichtung der Trommel mit ihren Scheidewaͤnden, und der Lage der
Staͤmpel innerhalb derselben zu zeigen. Fig. 2. ist ein
Quer-Durchschnitt desselben, in welchem man die Klappen und die
Entleerungs-Roͤhre noch deutlicher sieht.
Die Trommel steht in einem Gestelle, und dreht sich auf der einen Seite um ihre
Achse, auf der anderen um die Entleerungs-Roͤhre. Sie kann durch eine Kurbel,
oder mittelst eines Laufbandes und einer Trommel, die durch eine Dampf-Maschine,
oder durch irgend eine Triebkraft in Bewegung gesezt wird, gedreht werden. a, b, c, d, e, f sind sechs keilfoͤrmige
Staͤmpel, und schwingen sich auf Achsen oder Zapfen, um den Mittelpunct der
Trommel. g, h, i, k, l, m, sind sechs
Scheidewaͤnde, welche den inneren Raum der Trommel in eben so viele
Faͤcher, n, o, p, q, r, s, theilen. Die Klappen,
tt, (Fig. 2.) oͤffnen
sich nach innen, und sind außen in Gehaͤusen an der sich drehenden Trommel,
um die Luft frei in die Kammern gelangen zu lassen. Die Klappen, uu, sind an der gegenuͤberstehenden Seite,
und oͤffnen sich nach auswaͤrts, wodurch die Luft in die
aͤußere Kammer oder Buͤchse, vv,
gelangt, und aus dieser durch die Roͤhre, w, in
ununterbrochenem Strome ausfaͤhrt.
Wenn die Trommel sich dreht, kommen die verschiedenen Staͤmpel nach und nach
auf folgende Weise in Thaͤtigkeit. Man seze der Staͤmpel, a, ruhe auf der Scheidewand, g. Sobald diese Scheidewand eine senkrechte Lage erhaͤlt, wird
dieser Staͤmpel, a, links abfallen durch seine
eigene Schwere, und alle in der Kammer, n, enthaltene
Luft durch die Klappe, u, in der Scheidewand, h, austreiben. Die Klappe, t, in der Scheidewand, g, wird sich zugleich nach
innen oͤffnen, und der Luft neuen Zutritt in die Kammer, n, hinter dem Staͤmpel gestatten. Waͤhrend der Zeit, als die
Trommel ein Sechstel ihres Umlaufes vollendete, wird der Staͤmpel, a, in die Lage des Staͤmpels, b, gekommen seyn, und beinahe alle Luft aus der Kammer
auf jener Seite, welche sich unter dem Staͤmpel befindet, durch die Klappe,
u, ausgetrieben haben. Neue Luft wird dafuͤr
durch die Klappe, t, in der Scheidewand, g, auf obige Weise in die Kammer treten, und diese
fuͤr die naͤchste Wirkung des Staͤmpels fuͤllen. Nachdem
die Trommel zwei Sechstel ihres Umlaufes vollendet hat, wird die Scheidewand, g, in der Lage der Scheidewand, i, sich befinden, und der Staͤmpel, a,
wird in die Lage des Staͤmpels, c, gefallen seyn,
wofuͤr die Staͤmpel, f, und e, in die Lage von, b, und
a, vorgeruͤkt seyn werden, wo dann jeder auf
die oben angegebene Weise die Luft aus seiner Kammer ausgetrieben haben wird.
So wie die Trommel sich weiter dreht, kommen die Staͤmpel nach und nach in die
oben angezeigten Lagen, jeder treibt die Luft aus dem Fache oder aus der Kammer, in
welcher er arbeitet, und bringt sie in die aͤußere Kammer oder
Buͤchse, vv, aus welcher sie in einem Zuge
durch die Roͤhre, w, vor den Ofen, oder
uͤberhaupt dort hin gelangt, wo man Wind haben will.
So wie die Trommel sich dreht, entsteht eine doppelte Wirkung der Staͤmpel,
wodurch zwei verschiedene Luftstroͤme auf ein Mahl ausgetrieben werden. Man
seze irgend ein Staͤmpel, sey, in der Lage, c,
und ruhe an der Scheidewand, k. So wie die Trommel sich
fortdreht, kommt die Scheidewand, k, in die Lage von l, wo dann die Schwerkraft des Staͤmpels
denselben in die Lage von, d, herabzufallen
noͤthigen wird, und die Luft in dem Fache durch die Klappe, u, in die aͤußere Kammer, v, ausgetrieben wird, und die sich oͤffnende Klappe, t, auf der entgegengesezten Seite des Staͤmpels
neue Luft zulaͤßt. Auf dieselbe Art macht jeder Staͤmpel
waͤhrend der Umdrehung der Trommel seine ruͤkgaͤngige Bewegung,
und bewirkt hierdurch ein zweites Austreiben der Luft aus seiner Kammer, nachdem er
aus seiner unteren Lage gekommen ist. Auf diese Weise wird also ein ununterbrochenes
Ausstroͤmen der Luft unterhalten, so lauge die Trommel in Bewegung
bleibt.
Der Patent-Traͤger beschraͤnkt sich nicht auf die Zahl von 6 Kammern
und Staͤmpeln; sondern er wendet, nach der Groͤße der Trommel, und nach der
Groͤße der verlangten Wirkung, deren mehr oder weniger an, pakt aber die
Kanten derselben so, daß sie, bei der moͤglich geringsten Reibung, das
Entweichen der Luft unmoͤglich machen.
Der Patent-Traͤger schlägt diese Vorrichtung auch als einen Exhaustor, zum
Ausziehen der verdorbenen Luft aus Bergwerken, Schiffsraͤumen, und
uͤberhaupt dort, wo ein Ventilator noͤthig ist, vor. Die innere
Einrichtung und die Wirkung bleibt an dieser Vorrichtung, wo sie als Erhaustor
wirkt, dieselbe, nur mit dem Unterschiede, daß, in diesem Falle, eine feststehende
Kammer, oder Buͤchse, yy, außen auf der
Trommel angebracht worden seyn muß, wo die Klappen, tt, sich befinden, und die Trommel sich zugleich mit einer Roͤhre,
x, die aus dem Bergwerke, oder irgend einem Orte,
der gereinigt werden soll, drehen muß. Diese Buͤchse und die Roͤhre
sind durch punktirte Linien in Fig. 2. angedeutet.
Wenn diese Buͤchse angebracht ist, und die Trommel gedreht wird, erhalten die
Klappen, tt, ihre Luft aus der Roͤhre, x, die durch die Kammer, y,
lauft, und treiben sie bei den Klappen, uu, durch
die oben beschriebene Wirkung der Staͤmpel hinaus. Dieser Exhaustor wird auch
ohne die Buͤchse, v, und die Roͤhre, w, wirken, wenn man statt der Roͤhre, w, eine Achse anbringt, auf welcher die Trommel sich
dreht: die verdorbene Luft wird dann in die Atmosphaͤre entweichen.
Eine Abaͤnderung an diesem verbesserten Gebläse zeigt Figur 3 und 4. Eine Reihe
gewoͤhnlicher Blasebaͤlge steht hier um eine Roͤhre oder einen
hohlen Cylinder in der Richtung der Halbmesser desselben, dreht sich um diesen
Cylinder, als um ihre Achse, und wirkt durch ihre Schwerkraft auf folgende
Weise:
Jeder Blasebalg besteht aus zwei vierekigen Brettchen, wovon das eine fest steht, das
andere als Falldekel wirkt, und sich um Angeln dreht. Beide dieser Brettchen sind an
drei Kanten, wie gewoͤhnliche Blasebaͤlge, mittelst weichen Leders
verbunden, und bilden eine luftdichte keilfoͤrmige Kammer, deren Weite
wechselt, wie der Falldekel um seine Angeln sich dreht, und sich hebt oder
senkt.
Fig. 3. ist
ein Seiten-Aufriß der vollendeten Maschine; Fig. 4. ein Durchschnitt,
der den inneren Bau derselben zeigt, a, b, c, d, e, f, g,
h, sind acht Blasebalge in gleicher Entfernung von den Central-Platten, i, und dem aͤußeren Ringe, kk. Das untere Brettchen eines jeden Blasebalges
ist an den Central-Platten befestigt, und an den aͤußeren Ringen,
waͤhrend das obere Brettchen, oder der Falldekel, frei auf seinem
Angelgewinde steigt oder faͤllt. I, ist eine
hohle walzenfoͤrmige Roͤhre auf dem Querbalken, mm, der in Fig. 5. abgenommen
dargestellt ist. Auf dieser Roͤhre dreht sich die Maschine, die
vorlaͤufig gehoͤrig abgewogen seyn mußte, n, ist eine Lauftrommel an der Seite der Maschine, uͤber welche ein
Laufband von einer Dampfmaschine, oder von irgend einer Triebkraft herlaͤuft.
Dadurch wird nun die Maschine um die feststehende Achse, I, in Bewegung gesezt, und die Blasebaͤlge wirken durch ihre
Schwere.
Man sieht aus der Figur, daß der Blasebalg, a,
zusammengefallen, und außer Thaͤtigkeit ist; wenn er aber, so wie die
Maschine sich dreht, in die Lage, b, gekommen ist, wird
die Schwere des beweglichen Brettes dasselbe von dem feststehenden entfernt, die
Klappe geoͤffnet, und Luft in den inneren Raum desselben eingelassen haben.
Waͤhrend der Zeit, als der Blasebalg in die Lage, c, gekommen ist, hat er sich beinahe in den groͤßten Winkel
geoͤffnet, und sein Inneres mit Luft erfuͤllt. Die Blasebaͤlge
kommen, so wie die Maschine sich dreht, nach und nach in die Lagen, d, und e; wenn sie aber
nach, f, kommen, beginnt das Gewicht des Dekels
denselben niederzudruͤken, und die Luft wird durch seinen Schnabel in die
hohle Roͤhre, I, ausgetrieben, indem eine
Oeffnung in derselben angebracht ist, die beinahe ein Viertel ihres Umfanges
betraͤgt, und so lange als die Breite des Schnabels des Blasebalges ist. Man
sieht dieß deutlicher in der Figur 5, wo diese
Roͤhre abgenommen dargestellt ist. So wie die Maschine fortfaͤhrt sich
zu drehen, wird die Luft immerdar ausgetrieben, indem das obere Brett auf das untere
niedersteigt, wie man bei, g, sieht, und wenn der
Blasebalg endlich in die Lage, h, gekommen ist, ist die
Luft gaͤnzlich ausgetrieben. Auf diese Weise fuͤllen sich nun die
Blasebaͤlge immerdar, und treiben ihre Luft aus: die Roͤhre, I, auf welcher die Maschine sich dreht, wirkt als
Klappe, und schließt den verschiedenen Baͤlgen den Ausgang, außer an jener
Stelle, wo sie in Wirkung treten sollen.
Der Patent-Traͤger zieht vierekige Blasebaͤlge vor. Er glaubt dadurch
viel Kraft zu ersparen, und meint, daß zu dem Treiben aller dieser Balge nicht mehr Kraft erfordert
wird, als zu dem Treiben eines einzigen.
Tafeln