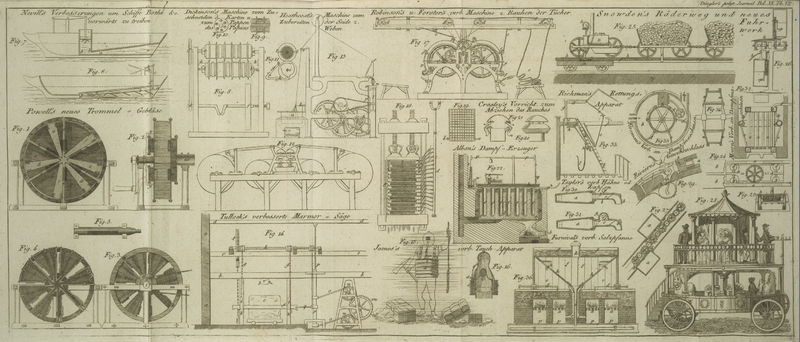| Titel: | Verbesserung an den Maschinen und an dem Verfahren zum Rauhen der Tücher und anderer Stoffe, und auch zum Pressen, worauf Sam. Lord, Jak. Robinson und Joh. Forster, alle Kaufleute und Fabrikanten zu Leeds in Yorkshire, sich am 11. August 1825 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. XCIX., S. 350 |
| Download: | XML |
XCIX.
Verbesserung an den Maschinen und an dem
Verfahren zum Rauhen der Tücher und anderer Stoffe, und auch zum Pressen, worauf
Sam. Lord,
Jak. Robinson und
Joh. Forster, alle
Kaufleute und Fabrikanten zu Leeds in Yorkshire, sich am 11. August 1825 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem London Journal of Arts. N. 62. S.
5.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Lord's, Verbesserung an den Maschinen und an dem Verfahren zum
Rauhen der Tücher u. anderer Stoffe, und auch zum Pressen.
Diese Verbesserungen bestehen 1) in einer besonderen Art von sogenannter
Gig-Muͤhle, welche zwei Cylinder oder Gig-Trommeln fuͤhrt, die sich in
entgegengesezter Richtung drehen, und so eingerichtet sind, daß ein Cylinder in
Umtrieb ist, und das Haar in einer Richtung aufrichtet, waͤhrend der andere
Cylinder stillsteht, und Zeit gewahrt, die Karden-Staͤbe zu wechseln, d.h.,
die abgenuͤzten weg zu thun, und frische dafuͤr einzusezen. Durch
diese Vorrichtung wird es nun nicht mehr noͤthig, die Endstuͤke des
Tuches, welche zusammengenaͤhet werden, so daß das Stuͤk Tuch eine Art
von Laufband uͤber den Cylinder bildet, aufzutrennen und neuerdings
zusammenzunaͤhen, wenn die Richtung, in welcher das Stuͤk laufen,
d.h., die Wolle aufgerauht werden soll, geaͤndert werden muß; denn bei dieser
Gig-Muͤhle ist es bloß noͤthig, die beiden Walzen zu wechseln, wodurch
das Tuch von einem Cylinder entfernt, und mit dem anderen unmittelbar in
Beruͤhrung gebracht, und daselbst in entgegengesezter Richtung gerauht wird.
Die Verbesserungen bei dem Pressen der Tuͤcher und anderer Fabrikate, als der
zweite Theil dieser Verbesserungen, bestehen in der Anwendung hohler Platten, die
mit Dampf geheizt werden, nachdem sie in die Presse eingesezt wurden, und dann mit
Wasser abgekuͤhlt werden, sobald die Waare den gehoͤrigen Grad von
Hize und Pressung erhalten hat. Durch diese Vorrichtungen kann die Temperatur der
Platten nach Umständen, und nach Verschiedenheit der Waaren regulirt werden.
Fig. 17. ist
ein Seiten-Aufriß der verbesserten Gig-Muͤhle. a
und b, sind die zwei Cylinder, die in eisernen Lagern
laufen, und auf deren Umfange die Karden-Staͤbe auf die gewoͤhnliche
Weise angebracht sind. Diese Cylinder werden mittelst Fangen gedreht, die sich auf ihren
Achsen schieben lassen, und die sie an große Zahnraͤder sperren, welche in
der Figur nicht angedeutet sind, weil sie an der Hinterseite vorkommen. Diese
Raͤder greifen in einander, und werden durch irgend ein schikliches Triebwerk
in Umlauf gesezt, welches mit einer Dampfmaschine, oder mit irgend einer anderen
Triebkraft in Verbindung steht. Sobald die Achse des Cylinders, a, mittelst ihres Fanges an ihr hinteres Rad gesperrt
ist, dreht sich die Walze nochwendig mit derselben um, und der Cylinder, b, bleibt stehen, wenn der Fang von der Achse desselben
abgezogen wird.
Das Tuch bildet das Band ohne Ende, ccc, welches
uͤber eine Reihe von Walzen, ddd, lauft,
die demselben als Leiter oder Fuͤhrer dienen. Die Walze, e, gibt dem Tuche die gehoͤrige Spannung, und
druͤkt es gegen den Umfang des Gig-Cylinders. Dieser Druk, so wie die Gewalt
der Wirkung des Gig's gegen das Tuch, kann vermehrt oder vermindert werden, je
nachdem man den Zahnstok, f, welcher diese Walze, e, fuͤhrt, und der durch den Triebstok, g, getrieben wird, hebt oder senkt. Die
Triebstoͤke, hh, schieben sich loker auf
den Achsen der Gig-Cylinder, drehen sich aber mit denselben, wenn sie durch ihre
Fange, ii, an dieselben gesperrt werden. Diese
Triebstoͤke und die Zahnraͤder, kk
und l, greifen in einander, drehen sich mit einander,
und sezen die Walze, m, in umdrehende Bewegung, wie die
punctirten Linien andeuten. Oben auf der Walze, in, liegt die Walze, n, die durch Reibung gedreht wird. Diese beiden Walzen
ziehen das Tuch uͤber den Gig-Cylinder, und treiben zugleich die
Baͤnder, welche die Leitungs-Walzen, ddd,
oben in Bewegung sezen.
Man wird nun einsehen, daß, wenn der Gig-Cylinder, a, in
Thaͤtigkeit ist, das Tuch rechts gezogen wird, unter der Spannungs-Walze, e, und uͤber den Gig-Cylindern, a, zwischen den Zugwalzen, n
und m, durch, und von da zu den Leitungs-Walzen
hinauflauft, wo es dann, nachdem es oben heruͤberlaͤuft, in derselben
Richtung wieder herabfallt, und so ohne Ende nach einer und derselben Richtung
fortzieht.
Nachdem das Tuch in dieser Hinsicht hinlaͤnglich bearbeitet wurde, wird es von
dem Gig-Cylinder, a, weggenommen, und mit dem Cylinder,
b, in Beruͤhrung gebracht, indem man die
Spannungs-Walze, e, abnimmt, und eine aͤhnliche
bei, o, in dem Lager oben an dem Zahnstoke, p, anbringt. Wenn diese mit dem darunter befindlichen Tuche herabgezogen
wird, so haͤlt sie dasselbe auf dem Umfange des Cylinders, b, an, so wie vorher, e, es
auf, a, that. Die Faͤnge werden nun gewechselt,
der Cylinder, b, wird in Umtrieb gebracht, und das Tuch
in entgegengesezter Richtung gerauht, welches nun links abfaͤllt.
Die Patent-Traͤger nehmen an dieser Gig-Muͤhle bloß die Art, die zwei
Cylinder auf obige Weise aufzustellen, und die noͤthige Vorrichtung,
dieselben abwechselnd in und außer Umlauf zu sezen, dann die Walzen zum Leiten und
Wechseln des Tuches von einem Cylinder auf den anderen, damit es in beiden
Richtungen gerauht werden kann, ohne daß die Naht an den Endstuͤken wieder
aufgetrennt werden darf, als ihr Patent-Recht in Anspruch.
Was die hohlen Platten zum Pressen betrifft, so koͤnnen diese auf verschiedene
Weise eingerichtet, und der Dampf und das Wasser kann auf verschiedene Art in
dieselben geleitet werden. Eine bequeme und zwekdienliche Weise ist in Fig. 18 und
19.
dargestellt. Fig.
19. zeigt eine solche hohle Platte, von welcher der obere Theil
weggenommen ist, um die innere Einrichtung derselben zu zeigen. Sie besteht aus zwei
eisernen Platten von ungefaͤhr 1/8 Zoll Dike, welche die obere und untere
Oberflaͤche derselben bilden. Die Seiten werden von einem eisernen Reife
gebildet, der ungefaͤhr 1/3 Zoll breit, und 3/4 Zoll tief ist. Innerhalb
dieses Reifes kommen die Scheidewaͤnde zu liegen, oder die sich
durchkreuzenden Rippen, wodurch die obere und die untere Platte gestuͤzt
wird. Die Rippen werden dadurch unter einander verbunden, daß sie in einander
eingeschnitten werden, und zwischen den Verbindungen sind Theile weggeschnitten,
damit das Wasser und der Dampf uͤber die innere Oberflaͤche der hohlen
Platte wegfließen kann, indem die beiden. Platten dampfdicht schließen. An der Seite
der Platte ist auf irgend einer schiklichen Stelle eine kleine Roͤhre, a, angebracht, durch welche der Dampf in das Innere der
Platte geleitet wird, und an einer anderen schiklichen Stelle ist auf der
entgegengesezten Seite eine Roͤhre, b, mit einem
Sperrhahne, durch welche der Dampf und das Wasser ausgelassen wird.
Fig. 18.
stellt eine gewoͤhnliche Presse dar, in welcher Tuͤcher und andere
Waaren auf die bekannte Weise zwischen heißen Platten gepreßt werden. In diese Presse kommen die hohlen
Platten bei, ccc, wo auch die Art und Weise
dargestellt ist, wie der Dampf in dieselben geleitet wird. dd, ist eine Roͤhre, die von irgend einem
Dampfkessel in einer schiklichen Entfernung den Dampf herleitet, und, e, ist eine Roͤhre, die kaltes Wasser aus einem
oben befindlichen Behaͤlter herabfuͤhrt. Bei der Vereinigung dieser
Roͤhren befindet sich ein Hahn mit drei Roͤhren, wodurch, nach
Belieben, Dampf oder Wasser in den unteren Theil der Roͤhre, d, herbeigeleitet werden kann. An der Seite der
Roͤhre, d, befindet sich eine Reihe gegliederter
Roͤhren, fff, welche mit den kleinen
Roͤhren, aa, an der Seite der hohlen
Platten in Verbindung gebracht werden muͤssen. Diese Verbindung geschieht
mittelst Cylinder-Stuͤken, die entweder auf die Enden der Roͤhren
geschraubt werden, oder sich daruͤber hin und her schieben lassen, welche
Verbindung man ein Vereinigungs-Geschiebe (union joint)
nennt. Auf diese Weise wird der Dampf in die hohlen Platten gelassen, und da diese
niedersteigen, wenn die Presse angezogen wird, so gestatten die Gefuͤge den
Roͤhren, ff, sich zu
verlaͤngern.
Ehe der Dampf eingelassen wird, werden die Haͤhne der Roͤhren, bb, geoͤffnet, damit der Dampf durchblasen,
und das in denselben allenfalls verdichtete Wasser hinausjagen kann. Man schließt
nun die Haͤhne, und die Platten werden durch den Dampf auf einen Grad erhizt,
den man mittelst eines kleinen Thermometers vorne an mehreren Platten leicht
bemessen kann.
Nachdem die Waaren den gehoͤrigen Grad von Hize erhalten haben, sperrt man,
wenn man sie schnell abkuͤhlen will, den Dampf mittelst des dreiwegigen
Hahnes ab, und laͤßt kaltes Wasser in den unteren Theil der Roͤhre,
d, welches durch die Roͤhren, f und a, zufließt, die
Platten, c, fuͤllt, und bei den Hahnen, b, abfließt, wodurch die Platten in wenigen Minuten
vollkommen kalt werden.
Um zu hindern, daß das Wasser nicht auf die Waaren kommt, ist ein zinnernes
Gefaͤß, g, an der Seite angebracht, welches an
einer Seite mit Oeffnungen versehen ist, die Lippen bilden, in welche die
Roͤhren, b, eingefuͤhrt werden. Dieses
Gefaͤß kann entweder mit einem Abzuge versehen, oder so weit seyn, daß es
alles ablaufende Wasser aufnehmen kann.
Uebrigens beschraͤnken die Patent-Traͤger sich nicht bloß auf die hier gezeichnete
Vorrichtung, da es mehrere Methoden gibt, diese hohlen Platten mit Dampf und Wasser
zu fuͤllen; sie nehmen die hohlen Platten und die Fuͤllung derselben
in Anspruch, durch welche sie den Zwek des Pressens besser, leichter und schneller
zu erreichen meinen, indem die Hize dadurch auf jeden Grad gebracht und
gleichfoͤrmig unterhalten werden kann, was durch das gewoͤhnliche
Heizen der Platten im Ofen nicht moͤglich ist. Man erspart uͤberdieß
einen Ofen, da ein kleiner Kessel, irgendwo im Hause angebracht, statt desselben
dienen kann.
Tafeln