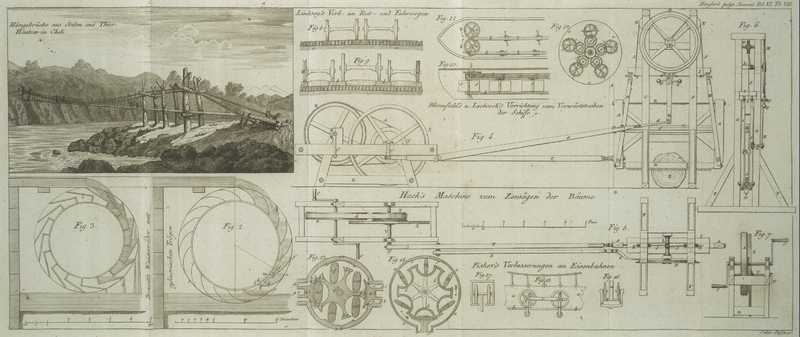| Titel: | Beschreibung einer von Hrn. Hacks, Mechaniker zu Paris, erfundenen Maschine zum Zersägen der Bäume. |
| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. CXVII., S. 454 |
| Download: | XML |
CXVII.
Beschreibung einer von Hrn. Hacks, Mechaniker zu
Paris, erfundenen Maschine zum Zersägen der
Bäume.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement. N. 254. S. 256.
Mit Abbildungen auf Tab.
VIII.
Hacks's, Beschreibung einer erfundenen Maschine zum Zersägen der
Bäume.
Wir haben im Bulletin de la Société, Junius
1822, S. 181. (Polytechn. Journ. Bd. XI. S.
265.) eine tragbare Saͤgemaschine des Hrn. Hacks zum Absaͤgen der Baͤume auf der Wurzel beschrieben.
Bei dieser Maschine, die zur Faͤllung eines Waldes in Louisiana bestellt war,
befand sich eine zweite zum Zersaͤgen der Baͤume, sobald sie
gefaͤllt waren. Auch diese Maschine ist tragbar; wir machten sie aber damahls
nicht bekannt, weil sie uns weniger wichtig schien, als die erstere, von der sie
sich vorzuͤglich dadurch unterscheidet, daß sie sich in einer senkrechten
Ebene bewegt.
Wir haben indessen die Zeichnungen, die zu derselben gehoͤren, erhalten, und
daran bemerkt, daß der Mechanismus, durch welchen die Saͤge auf den zu
zersaͤgenden Baum angebracht wird, sinnreich ist, und eine Idee darbiethet,
die auch noch andere nuͤzliche Anwendungen gestattet. Dieß bestimmte uns zur
Bekanntmachung folgender Beschreibung derselben.
Die Tab. VIII. zeigt sie im Grundrisse, Durchschnitte
und Aufrisse. Sie besteht 1) aus einem feststehenden Gestelle, in welchem die
Saͤge spielt; 2) aus der Vorrichtung zum Drehen der Kurbeln, mittelst welcher
man die Saͤge hin und her bewegt.
Der Rahmen, AA, Fig. 4. ist jenem in der
ersten Maschine aͤhnlich, jedoch mit dem Unterschiede, daß er nicht
horizontal, sondern vertical ist. Dieser Rahmen, der sich zwischen vier Pfosten, GG, des Gestelles, F,
bewegt, ist so aufgehaͤngt, daß die Saͤge nur in dem Maße in das Holz
eindringt, als die Arbeit fortschreitet; denn man hat bemerkt, daß, wenn sie ihrem
eigenen Gewichte uͤberlassen waͤre, sie zu sehr einbisse und sich
verlegte.
Jedes Ende des Rahmens, A, haͤngt in
hoͤlzernen Leisten, HH, die durch Gewinde,
aa, mit einer Querbuͤhne, I, verbunden sind, die zwischen den beiden Pfosten, GG, auf- und niedersteigt. Diese Bewegung
erhaͤlt sie durch die Schnuͤre, JJ,
die an einem Ende an der Buͤhne bei, bb,
befestigt sind, und mit dem anderen uͤber die Rollen, kk, laufen. Diese Schnuͤre laufen um die
Walze, L, so, daß, wenn diese Walze sich dreht, sie
beide zu gleicher Zeit niedergelassen werden, um das regelmaͤßige und
gleichfoͤrmige Niedersteigen der Saͤge zu bewirken.
Man begreift, daß, wenn der Rahmen, A, seinem eigenen
Gewichte uͤberlassen waͤre, er die Walze, L, drehen, und fest auf dem zu zersaͤgenden Baume aufliegen
wuͤrde; dadurch wuͤrde die Bewegung der Saͤge hart und sehr
erschwert werden; wenn aber, im Gegentheile, diese Walze befestiget waͤre;
koͤnnte der Rahmen nicht niedersteigen. Man mußte also ein Mittel finden,
diesen doppelten Nachtheil zu beseitigen, was Hr. Hacks
auf folgende Weise bewirkte.
Er zog auf der Achse der Walze, L, ein Schieberad, M, auf, in dessen Zaͤhne abwechselnd zwei
Sperrkegel, N, O, so eingreifen, daß sie nicht beide
zugleich daß Rad festhalten. Die Bewegung dieser Sperrkegel um ihren
gemeinschaftlichen Mittelpunct, g, ist so berechnet, daß, wenn der eine
gegen einen Zahn sich stuͤzt, der andere in die Mitte eines anderen Zahnes
einfaͤllt. Wenn also der Zahn, N, aus dem Zahne
los wird, den er hielt, wird das Schiebrad, M, von der
Schwere der Saͤge gezogen, sich so lang drehen, bis es dem Sperrkegel, O, begegnet, d.h., um einen halben Zahn. Dann stemmt
sich der Sperrkegel, N, gegen die Mitte des folgenden
Zahnes, und befindet sich in derselben Lage, in welcher ehevor der Sperrkegel, O, gewesen ist. Diese Bewegung geschieht bei jedem Zuge
der Saͤge mittelst der beiden Arme des Hebels, PQ, die die Verlaͤngerung der Sperrkegel bilden, und mit Zwei
kupfernen Kugeln versehen sind, die auf derselben Achse, g, schwanken. Bei jeder Schwankung, wo der Arm des Hebels, Q, sich hebt, wird der Sperrkegel, N, los, waͤhrend der Arm, P, der durch das Gewicht der Kugel sich senkt, den Sperrkegel, O, in einen der Zaͤhne des Schiebrades eingreifen
macht, und so geht es abwechselnd fort.
Die Arme des Hebels, PQ, erhalten ihre
Thaͤtigkeit durch die eiserne Schiene, R, die
mittelst eines Gewindes an dem Puncte, d, mit einer
hoͤlzernen Ziehstange, S, verbunden ist, welche
an der Laufstange, T, befestigt ist, deren Bewegungen
sie folgt.
Dieß ist der Mechanismus, welcher der Saͤge den hinlaͤnglichen Grad von
Druk auf das zu saͤgende Holz gibt. Damit aber das Saͤgeblatt nicht
zwischen den Wangen wakelt, hat man an jedem Ende der Fassung, A, die Leiter, ee,
angebracht, die gleichzeitig mit dem Rahmen in den hohlen Falzen an der inneren
Seite der Pfosten, GG, auf- und niedersteigen.
Diese Leiter vereinigen sich 1) mit dem Rahmen durch eine Verdikung, f, des Querbalkens, C, der
sich in dazu eigens angebrachten Einschnitten einsenkt. 2) unter sich an ihrem
unteren Ende mittelst einer Querstange aus Eisen, die ihrer Breite nach gespalten
ist, damit das Blatt der Saͤge, D, frei
durchlaufen kann. Die sechste Figur gibt nur eine undeutliche Idee von diesen
Leitern, die durch andere Stuͤke verstekt sind; es ist aber leicht, den Bau
derselben zu begreifen.
Da die Saͤge nur durch die Leiter, HH,
aufgehaͤngt erhalten wird, so bewegen sich, wenn die Saͤge in
Thaͤtigkeit gesezt wird, diese Schienen auf ihren oberen Gewinden, aa, und wirken wie eine Schwinge; wie daher eines
der Enden der Saͤge sich von dem Mittelpuncte des Baumes entfernt, hebt es
sich in die Hoͤhe, waͤhrend das andere sich senkt, und umgekehrt, was
nothwendig ist, um die Zaͤhne bei jedem Stoße frei zu machen.
Die Saͤge erhaͤlt ihre Bewegung hin und her durch ein in einiger
Entfernung angebrachtes Zugwerk, das aus zwei Rollen, YZ, besteht, die durch einen Laufriemen, A',
verbunden sind, den man mittelst zweier Kurbeln, C'C',
treibt; an jeder Kurbel steht ein Mann. Die Achse, V,
der Rolle, Y, hat ein Flugrad, X, und eine Kurbel, U, durch deren Umdrehung
eine Laufstange, T, abwechselnd gezogen und gestoßen
wird, die mittelst eines Gewindes an dem Rahmen befestigt ist, der die Saͤge
fuͤhrt. Diese Vorrichtung macht alles Raͤderwerk der ersten Maschine
uͤberfluͤßig.
Diese Saͤge kann nicht bloß zum Faͤllen der Waͤlder, sondern
auch bei Verarbeitung des Bauholzes mit Vortheil angewendet werden. Die
Geschwindigkeit derselben ist beinahe eben so groß, wie an der ersten Maschine,
d.h., sie fuͤhrt 80 Schnitte in einer Minute.
Erklaͤrung der Figuren.
Fig. 4. Die
Maschine sammt ihrem Zugwerke von der Vorderseite.
Fig. 5.
Grundriß derselben.
Fig. 6. Das
Gestell, welches die Vorrichtung an der Saͤge traͤgt, von der Seite
nach der Linie, AB, in Fig. 4.
Fig. 7. Das
Zugwerk der Saͤge von hinten.
AA, Aufzug der Saͤge; B, eiserne Querstange zur Spannung der Saͤge; C, hoͤlzerner Querbalken mit einer Verdikung zur
Vereinigung der beiden Pfosten, A, in ihrer Mitte; D, das Blatt der Saͤge; E, der zu zersaͤgende Baum; F, Gestell
der Maschine; GG, Pfosten, zwischen welchen die
Saͤge sich bewegt; HH, hoͤlzerne
Schienen, welche die Saͤge an ihren Enden aufgehaͤngt halten; I, Querbuͤhne, an welcher die Schienen, HH, angebracht sind, und die zwischen den Pfosten
auf- und niedersteigt; JJ, Schnuͤre, welche
diese Buͤhne schwebend erhalten; KK,
Rollen, uͤber welche diese Schnuͤre laufen; L Walze, um welche sich diese Schnuͤre winden; M, Schiebrad, welches auf der Achse dieser Walze
aufgezogen ist; NO, Sperrkegel, die abwechselnd in
die Zaͤhne des Schiebrades eingreifen; PQ,
Hebelarme dieser Sperrkegel, die eine Schwinge bilden, und deren jeder an seinem Ende eine kupferne Kugel
traͤgt; R, senkrechte Eisenstange, die die
Schwinge in Bewegung sezt; S, großer hoͤlzerner
Hebel, der mittelst eines Gewindes mit der Stange, R,
verbunden ist, und dieser eine schwingende Bewegung um ihre Achse, c, mittheilt. T, Laufstange,
die die Saͤge hin und her bewegt; U, die Kurbel
dieser Laufstange auf der Achse, V, des Flugrades, X, aufgezogen; Y, kleine
Rolle auf der Achse des Flugrades; Z, große Rolle, die
die vorige mittelst des Laufriemens, A', mit welchem
beide umgeben sind, in Bewegung sezt; B', Gestell,
welches das Flugrad und die Rollen traͤgt; C'C',
Kurbeln, an welchen zwei Maͤnner angestellt sind, die die Saͤge in
Bewegung sezen.
aa, Gewinde, welche die Schienen, HH, mit der Platte verbinden; bb, Befestigungspuncte der Schnuͤre, JJ, unter der Buͤhne; c, Mittelpunct der Bewegung der Stange, R: d, Stange mit einem Gewinde an dem Ende des Hebels,
S; ee, Leiter, die
sich in einem Falze zwischen den beiden Pfosten, GG, bewegen; f, Verdikung des Querbalkens, C, der sich in zwei Einschnitte in den Leitern
einfuͤgt; g, Achse, um welche sich die Sperrkegel
und die Schwingen, PQ, drehen.
Tafeln