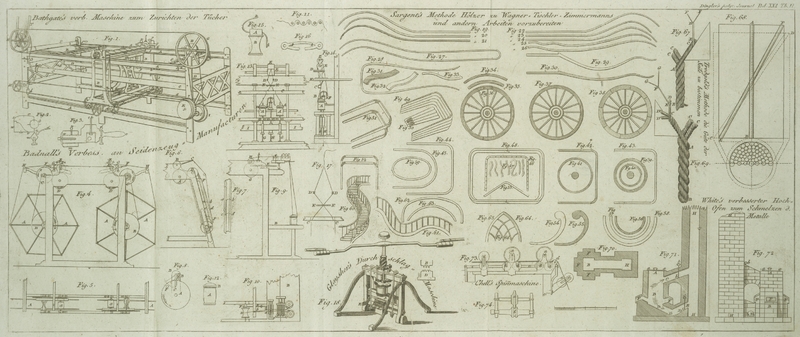| Titel: | Hrn. Bathgate's verbesserte Maschine zum Zurichten der Tücher und anderer Zeuge. |
| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. IV., S. 17 |
| Download: | XML |
IV.
Hrn. Bathgate's verbesserte Maschine zum Zurichten der Tücher und anderer
Zeuge.
Aus dem Glasgow Mechanics' Magazine. N. 116. S.
17.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Bathgate's, verbesserte Maschine zum Zurichten der
Tücher.
„Vorliegende Maschine,“ sagt ein Hr. T. A., „ward in
America erfunden, und vor 6 oder 7 Jahren in unserem Lande eingefuͤhrt.
Man hat seit dieser Zeit verschiedene Verbesserungen an derselben angebracht:
folgende, die Hr. Bathgate zu Gallashiels errichtete,
ist eine der neuesten und besten.“
„Der Zwek dieser Maschine ist, die Oberflaͤche des Tuches oder
Zeuges von allen Fasern zu reinigen, die das Ansehen derselben entstellen, und
eine schoͤne und glatte Oberflaͤche auf demselben zu
erzeugen.“
„Fig.
1. zeigt diese Maschine im Perspective. Fig. 2. zeigt die
Scheren im Quer-Durchschnitte. Fig. 3. ist ein
Laͤngen-Durchschnitt des Handgriffes und des Hauptstuͤkes, wodurch
das spiralfoͤrmige Blatt der Schere gefuͤhrt wird, und zeigt die
Art, wie dasselbe mit dem anderen Blatte verbunden ist.“
„A, A, A, A, Fig. 1. ist ein großes
Gestell aus Gußeisen. B, B, B, ist ein sich
bewegender Rahmen oder Schlitten, der auf zwei Achsen und vier Raͤdern
sich bewegt, die der Quere nach liegen. Die Raͤder laufen laͤngs
den unteren Schienen in dem eisernen Gestelle, A, A,
an den Seiten der Sperren, d, d, die an diesen
Furchen angeschraubt sind. E, ist eine gefurchte
Rolle, die sich um einen an dem großen Gestelle fest geschraubten Zapfen dreht,
wodurch die ganze Maschine in Thaͤtigkeit gebracht wird. F, sind zwei Laufraͤder, wovon das eine an
die Rolle, E, festgeschraubt ist, und diese mittelst
des Laufriemens, Y, in Umtrieb sezt, welcher von
einem Triebwerke herlaͤuft, waͤhrend das andere los ist, und sich
um seinen Zapfen dreht. N, ist eine Rolle am Ende
des spiralfoͤrmigen Blattes der Schere, die von einer Schnur getrieben
wird, welche ein Mahl um die Rolle, E,
laͤuft. G, ist eine Rolle, uͤber
welche dieselbe Schnur laͤuft, und welche sich auf dem Gestelle, A, A, schiebt, um das Laufband anzuziehen, wenn es
nothwendig ist. H, ist eine kegelfoͤrmige
Rolle mit drei Furchen, an der Rolle, G, fest
geschraubt. I, ist eine andere, der Rolle, H, aͤhnliche kegelfoͤrmige Rolle, die
von derselben getrieben wird, jedoch so, daß die Basis derselben sich in
entgegengesezter Richtung dreht: die drei Furchen dienen dazu, um den Schlitten,
B, B, verschiedene Bewegungen zu geben. 5, ist
ein an der Rolle, I, befestigter Triebstok. J, ein Rad, welches von dem Triebstoke, 5, bewegt
wird. K, eine an das Rad, J, geschraubte Rolle. L, eine Rolle auf
einer Spindel an dem beweglichen Rahmen, welche von, K, bewegt wird. M, eine lose Rolle, welche
sich auf dem Gestelle, A, schiebt: eine sogenannte
Spann-Rolle (stenting pulley). O, ein spiralfoͤrmiges Scherenblatt aus einem
Guß-Eisen-Cylinder, in welchem ringsumher in einer Spiral-Linie Furchen
eingeschnitten sind, worin duͤnne Stahlblaͤtter eingelassen sind,
die ungefaͤhr einen halben Zoll hervorstehen: das andere Scherenblatt ist
eine duͤnne an die Metallschiene, v, Figur 2.
angeschraubte Stahlplatte, welche, wenn das spiralfoͤrmige Blatt sich
dreht, wie eine Schere wirkt, m, eine vierekige,
oben gerade, Eisenstange, die unmittelbar unter der Schneide des unteren
Blattes, v, liegt. Ein Stift mit zwei Nieten ist an
jedem Ende dieser Stange unter rechten Winkeln mit derselben befestigt: mittelst
dieser Stifte kann sie an die obere Stange, n, des
mittleren Theiles des Schlittens, B, B,
festgeschraubt, und mittelst der Nieten jedes Mahl zu der mit den
Blaͤttern der Schere correspondirenden Hoͤhe erhoͤht
werden, o, ist ein Griff, der das
spiralfoͤrmige Blatt stuͤzt: das andere Ende dieses Griffes paßt
in einen Ausschnitt an dem Ende der Metall-Stange, woran das untere Blatt
angeschraubt ist. In dieser Hinsicht ist an jedem Ende der Stange ein dikes
Stuͤk angegossen, wovon man bei, v, einen
Theil sieht. Es schiebt sich in diesem Ausschnitte mittelst einer Schraube mit
zwei Halsstuͤken, die in einer Platte arbeitet, wie man an, v, in Fig. 3. sieht, und
wird durch die Schraube, u, in der erforderlichen
Lage festgehalten. Auf diese Weise wird das Scherenblatt, O, in die gehoͤrige Lage gebracht, um mit, v, schneiden zu koͤnnen, und es ist offenbar,
daß, so wie, v, sich abnuͤzt, o zuruͤkgezogen werden muß, damit die
Schneiden auf einander wirken. Um das Scherenblatt, O, zu heben oder zu senken, was gleichfalls nothwendig ist, ist das
Lager, auf welches dasselbe ruht, mittelst einer Furche in dem Griffe, o, eingepaßt, wodurch es nach der Seite hin
festgehalten wird, sich aber frei auf und nieder bewegen kann. Dieß geschieht
mittelst des Stiftes, t, welcher mit einer Schraube
in dem Griffe arbeitet, und mit einem Halsstuͤke in dem messingenen Lager
des Scherenblattes. Siehe Fig. 3. In jedem Ende
der Stange, v, ist ein kleiner Stift
eingefuͤgt, der bei, m, Fig. 3. durch Puncte
angedeutet ist. Diese Stifte ruhen auf Lagern in den Metallplatten, 6, 6, welche
auf den Enden des Schlittens, B, B, angeschraubt
sind, und da dieser Rahmen Ausschnitte hat, so koͤnnen sie
ruͤkwaͤrts und vorwaͤrts bewegt werden, so daß die Schneide
des unteren Blattes gerade uͤber die Stange, m, kommt.
Die Scherenblaͤtter bewegen sich auf den punctirten Stiften bei, m, Fig. 3. als Mittelpunkten,
wenn der Griff, o, gehoben wird, und werden in dieser
Lage durch eine Feder, p, festgehalten, die einen Knopf
außen an dem Griffe faͤngt, wodurch das Tuch frei zwischen den
Scherenblaͤttern und der Stange, m, durch kann,
wenn die Maschine in Ruhe ist. Ein in dem Griffe, o,
eingeschraubter Stift, s, ruht auf einem
hervorspringenden Stuͤke, 8, der Platten, 6, 6, und dient die
Scherenblaͤtter in
jeder erforderlichen Entfernung von der Stange, m, nach
der Dike des Tuches zu halten, oder nach der Kuͤrze, in welcher dasselbe
geschoren werden soll. a und b, sind zwei Hebel, die sich um, a und b, als Mittelpuncte bewegen, und an ihrem
kuͤrzeren Ende die Achse der Rolle, L,
fuͤhren, auf welcher zwei Triebstoͤke, c,
c, befestigt sind, die in die Zahnstoͤke, d,
d, eingreifen, und den Schlitten, B, B,
vorwaͤrts treiben. Die anderen Enden dieser Hebel sind mittelst dieser
Stange, e, e, fest unter einander verbunden. Die Schwere
dieser Stange, welche auf das laͤngere Ende der Hebel wirkt, haͤlt die
Rolle, L, mit ihrer Achse im Gleichgewichte, und hebt
so, wenn sie frei gelassen wird, die Triebstoͤke aus. Um die
Triebstoͤke in den Zahnstoͤken zu erhalten, faͤngt ein anderer
Hebel, der in einem Mittelpuncte, g, arbeitet, das Ende
des Hebels, a, und wird daselbst oben von einer Feder
gehalten. Der Hebel, b, ist dem Griffe, x, mittelst einer kleinen. Stange, l, verbunden; der Griff, x,
dreht sich um den Mittelpunct, y, und bei, x, ist eine kleine Rolle. Zwei aͤhnliche Rollen
sind an dem Gestelle, B, bei, z, angenietet; ein Ende der Schnur laͤuft unter diesen lezteren und
uͤber die Rolle bei, x, ist an dem Ende des
großen Rahmens, A, bei 7, mittelst eines Stiftes und
eines Sperrrades befestigt, waͤhrend das andere Ende mit dem Arme der Kurbel,
2, verbunden ist. Die Kurbel ist mit dem Hebel, 3, verbunden, welcher den
Laufriemen, Y, abwechselnd auf das feste und lose
Laufrad bei, F, schnellt.
S, ist eine mit einem Haken versehene Stange, die sich
um Mittelpuncte an den Seiten des Gestelles, A, A,
bewegt, durch eine Feder-Sperre, w, aber, wenn sie
horizontal ist, fest gehalten wird. R, ist eine
aͤhnliche Stange, die sich laͤngs den hervorstehenden Stuͤken
der Seiten, A, A, schiebt, und mit der Walze, P, mittelst zweier Riemen verbunden ist.
Wenn mit dieser Maschine gearbeitet werden soll, wird das Tuch, welches der Breite
nach geschoren wird, zuerst auf der Walze, C, C,
aufgerollt, von wo das Ende desselben außen uͤber die obere Schiene des
großen Gestelles, A, gezogen wird. Die Scheren werden
zwischen demselben und der Stange, m, auf die andere
Seite der Maschine gehoben. Dann wird es an die Stangen, S und R, eingehaͤkelt, und durch das
Drehen der Walze, P, gespannt, welche mittelst eines
Sperrrades und einer Klinke, gleich den uͤbrigen Walzen, festgehalten wird.
Der Schlitten wird nun
zuruͤk nach, R, gezogen, die Feder, p, wird zuruͤkgedruͤkt, und die
Scherenblaͤtter werden herabgelassen. Hierauf wird der Griff, x, hinaufgezogen, wodurch die Triebstoͤke, c, c, in die Zahnstoͤke geworfen werden. Zu
gleicher Zeit verkuͤrzt die Rolle, x, durch ihr
Emporsteigen die Schnur, und zieht den Arm der Kurbel, 2, wodurch der Hebel, 3, in
jene Lage kommt, die man in der Figur sieht, und wodurch der Laufriemen, Y, auf das feste Laufrad, F,
geworfen wird. Nun ist alles im Gange, und der Schlitten, B, bewegt sich gegen S. Hier schlaͤgt
ein Zapfen, h, oben auf den Hebel, g, und indem er denselben zuruͤkdruͤkt,
befreit er die Hebel, a und b, wo die Stange, e, unmittelbar niederfallt,
die Triebstoͤke hebt, und den Griff, x,
niederzieht, welcher den Hebel, 3, verlaͤßt, und der Einwirkung des
Gewichtes, 4, uͤberlaͤßt. Auf diese Weise wird der Riemen, Y, auf das lose Laufrad geworfen, und alles steht still.
Die Scheren werden jezt gehoben, und das Tuch bei, S,
ausgehaͤkelt, indem man die Stange um ihren Mittelpunct dreht, in welcher
Lage diese durch die Feder, w, gehalten wird, die gegen
dieselbe druͤkt, dann wird das Tuch aus, R,
ausgehaͤkelt, und der vollendete Theil uͤber die andere Seite des
großen Gestelles gezogen, und an die Walze, D,
angehaͤkelt, auf welcher es aufgerollt wird, sobald es fertig ist. Die
Stange, S, wird dann in die vorige Lage gebracht, und
die Arbeit geht, wie gewoͤhnlich, fort.
Eine kleine Eisenstange, n, Fig. 2. ist durch drei
Arme mit der duͤnnen Stange, s, verbunden, die
oben auf dem Schlitten aufgebolzt ist, und die das Tuch waͤhrend seines
Ueberganges uͤber die Stange, m, ruhig
haͤlt. Auch ist an die Stange, v, bei, w, ein Stuͤk Eisenplatte, t, angeschraubt, damit die Scherwolle, welche abgeschnitten wird, nicht
uͤber das bereits vollendete Tuch kommt. An dem Vordertheile dieses Eisens,
bei, r, ist ein Stuͤk grobes Tuch
angenaͤhet, welches die Scheren bei, o,
beruͤhrt, und, gesaͤttigt mit Fett, die Scheren schmiert, und so die
Reibung vermindert.
Die Laͤnge der Maschine richtet sich nach der Breite des zu scherenden Tuches:
die hier gezeichnete ist fuͤr neun Viertel Tuch. Bei mittlerer Bewegung des
Schlittens macht das Spiral-Blatt der Schere Eine Umdrehung fuͤr ein Achtel
Zoll der Bewegung desselben nach vorwaͤrts, und, da vier Stuͤke Stahl
hervortreten, hat jedes nur 1/32 Zoll auf ein Mahl zu schneiden.
Tafeln