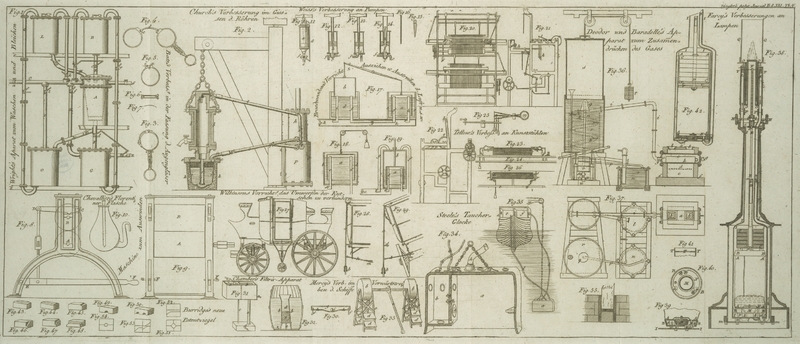| Titel: | Verbesserungen an Sauge-, Verdichtungs- und Einsprizungs-Pumpen, und den dazu gehörigen Apparaten, welche Verbesserungen sich auch zu anderen nüzlichen Zweken anwenden lassen, und worauf Joh. Weiss, Messerschmid und chirurgischer Instrumenten-Macher zu London, am Strand, sich am 18ten Dec. 1824 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. XXXVII., S. 201 |
| Download: | XML |
XXXVII.
Verbesserungen an Sauge-, Verdichtungs- und
Einsprizungs-Pumpen, und den dazu gehörigen Apparaten, welche Verbesserungen sich auch
zu anderen nüzlichen Zweken anwenden lassen, und worauf Joh. Weiss, Messerschmid und chirurgischer
Instrumenten-Macher zu London, am Strand, sich am 18ten Dec. 1824 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. May. 1826. S.
247.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Weiss's, Verbesserungen an Sauge-, Verdichtungs- und
Einsprizungs-Pumpen, und den dazu gehörigen Apparaten.
Diese Verbesserungen beziehen sich vorzuͤglich auf
chirurgische Sprizen, um mittelst derselben giftige Stoffe aus dem Magen ziehen und
andere Fluͤßigkeiten einsprizen zu koͤnnen, die das Gift
verduͤnnen oder neutralisiren, wenn es nicht ausgezogen werden kann.
Diese Verbesserung gestattet mehrere Modificationen. Figur 11. zeigt die
verbesserte Sprize von außen mit ihrem Zugehoͤre.
a, ist der Stiefel oder cylindrische Theil der
Sprize;
b, ist der Griff an dem durch Puncte angedeuteten
Staͤmpel, womit lezterer in dem Cylinder auf und nieder gezogen wird;
c, ist ein Hahn mit dreifachem Durchgange;
d, eine mit dem Hebel verbundene Stange, welche den
Hahn, c, dreht.
Diese Stange laͤuft durch kleine Loͤcher in den hervorstehenden
Raͤndern des Cylinders, beugt sich oben uͤber, und steigt, wie man an
der punctirten Linie sieht, etwas in dem Inneren des Cylinders herab. Sie ist etwas
duͤnn, und unten etwas biegsam, damit sie sich nach dem Bogen richten kann, in
welchem der Hebel des Hahnes sich dreht.
e und f, sind zwei
Oeffnungen, durch welche die Fluͤßigkeit in den Cylinder der Sprize gezogen
oder aus demselben ausgesprizt werden kann.
Man seze nun, der Hahn befinde sich in einer solchen Lage, daß die Muͤndung,
e, nach dem Inneren der Sprize offen steht; so wird,
wie man den Staͤmpel in die Hoͤhe zieht, jede Fluͤßigkeit, in
welche diese Muͤndung eingesenkt ist, in dem Cylinder in die Hohe steigen,
und denselben fuͤllen. Wenn der Staͤmpel in die Hohe kommt, wird er
gegen das Ende der Stange, d, anschlagen, die sich in
dem Cylinder befindet, diese heben, und dadurch den Hahn, c, drehen, die Oeffnung, e, schließen, die
Oeffnung, f, aber oͤffnen, die zu dem Inneren des
Cylinders fuͤhrt. Wenn man nun den Staͤmpel wieder
niederdruͤkt, so wird die bei der Oeffnung, e,
eingezogene Fluͤßigkeit durch die Oeffnung, f,
herausgesprizt, und so wie der Staͤmpel vorruͤkt, wird das Halsband,
g, in der Naͤhe des Griffes gegen das
gekruͤmmte Ende der Stange, d, schlagen, dadurch
die Stange nach abwaͤrts treiben, und den Hebel, welcher den Hahn dreht, in
seine vorige Lage bringen.
Fig. 12. ist
der Durchschnitt einer Sprize, welche etwas von der vorigen verschieden ist. Der
Staͤmpel bewegt sich in derselben auf die gewoͤhnliche Weise auf und
nieder; allein der Stiel des Staͤmpels ist hier hohl, und schiebt sich auf
einer vierekigen Stange, h, und der Hahn mit dreifacher
Oeffnung, c, dreht sich hier horizontal. Man seze die
Oeffnung, f, sey nun nach dem Inneren der Sprize offen,
und die Muͤndung dieser Oeffnung in irgend eine Fluͤßigkeit
eingesenkt; so wird, wie der Staͤmpel in die Hohe gezogen wird, die
Fluͤßigkeit in die Hoͤhlung der Sprize einstroͤmen. Da nun aber
diese Fluͤßigkeit wieder bei, e, herausgesprizt
werden muß, so muß der Griff in einer Viertelwendung gedreht werden, wodurch die
Stange, h, gleichfalls um so viel gedreht wird, und da
diese Stange mit dem Hahne, c, in Verbindung steht, so
fuͤhrt sie denselben in horizontaler Richtung herum, schließt die Oeffnung
bei, f, oͤffnet dafuͤr, e, und laͤßt bei dem Niedersteigen des
Staͤmpels die Fluͤßigkeit bei, e,
heraus.
Fig. 13. ist
eine bloße Abaͤnderung im Baue. Der Stiel des Staͤmpels ist hohl, und
schiebt sich eben so auf einer vierekigen Stange, wie in Fig. 12.; f und e, sind die Oeffnungen
zum Ein- und Ausgange der Fluͤßigkeit; statt des dreifachen Hahnes aber ist
eine kreisfoͤrmigen Platte, i, angebracht, mit
zwei Loͤchern, die in der Weite eines Viertelkreises von einander stehen, und
correspondirend mit diesen Loͤchern, ist die vierekige Stange, h, vorgerichtet.
Eines der Loͤcher dieser Platte, i, ist
unmittelbar uͤber der Oeffnung, l; folglich wird der Staͤmpel bei
seinem Hinaufsteigen durch diese Oeffnung die Fluͤßigkeit in den Cylinder der
Sprize ziehen, und wenn man den Staͤmpel und die vierekige Stange, h, wie oben bei Fig. 12. dreht, wird sich
die Platte, i, gleichfalls drehen, die Oeffnung, f, schließen, und das andere ihrer Loͤcher
uͤber die Oeffnung, e, bringen, die dadurch nun
zum Heraussprizen der Fluͤßigkeit offen steht.
Eine vierte Vorrichtung zeigt Fig. 14. f und e, sind die
Oeffnungen; c, ist ein dreifacher Hahn, der sich
horizontal dreht, und an dem Staͤngelchen, h,
angebracht ist, welches in dem hohlen Stiele in die Hoͤhe steigt.
Das Eigene an dieser Sprize ist, daß der Staͤmpel sich auf dem flachen
Staͤngelchen, h, auf und nieder schiebt, und daß
das obere und untere Ende dieses Staͤngelchens in einem Viertelkreise gedreht
ist, wodurch, wenn der Staͤmpel in die Naͤhe des Bodens des Cylinders
kommt, der gewundene Theil des Staͤngelchens so in den Ausschnitt des
Staͤmpels wirkt, daß der Stiel des lezteren und der Hahn, c, sich so dreht, daß ein Loch offen wird, und wenn der
Staͤmpel hinaufsteigt bis nahe an den oberen Theil des Cylinders, das andere
gewundene Ende des Staͤngelchens den Hahn, c, in
entgegengesezter Richtung so drehen wird, daß die andere Oeffnung offen wird. Auf
diese Weise oͤffnet und schließt der Staͤmpel durch sein bloßes Auf-
und Niedersteigen die Oeffnungen, und die Fluͤßigkeit, die bei dem einen
Loche eingezogen wird, wird bei dem anderen hinausgesprizt.
Ein kleiner kegelfoͤrmiger Stift, Fig. 15. wird in den Mund
des Kranken eingetrieben, um denselben zu oͤffnen, wenn er geschlossen ist,
damit man die Roͤhre dem Patienten in den Schlund bringen kann, an welcher
die Pumpe zum Heraufziehen der Fluͤßigkeit aus dem Magen des Kranken
angebracht wird Im Falle, daß der Mund nicht geoͤffnet werden koͤnnte,
wird eine kleine biegsame Stange, Fig. 16., durch die Nase
in den Rachen des
Kranken gefuͤhrt, um denselben dadurch zum Brechen zu reizen, und ihm so den
Mund zu oͤffnen.Wenn auch die wohlthaͤtige Absicht, zu welcher diese Pumpen bestimmt
sind, nur hoͤchst selten, wenn jemahls, erreicht werden sollte, so
laͤßt doch diese Vorrichtung sich zu manchem anderen Zweke
vorteilhaft benuͤzen. A. d. Ueb.
Tafeln