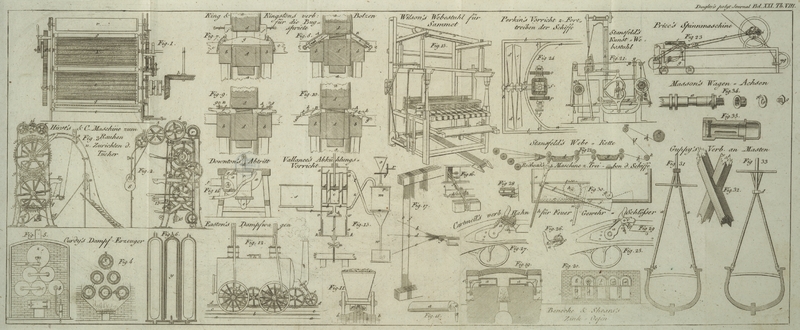| Titel: | Verbesserungen an den Kunst-Stühlen, und in Zurichtung der Kette für dieselben, worauf Thom Woolrich Stansfeld, Kaufmann zu Leeds, Yorkshire, am 27. Julius 1824 sich ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. XCI., S. 385 |
| Download: | XML |
XCI.
Verbesserungen an den Kunst-Stühlen, und in
Zurichtung der Kette für dieselben, worauf Thom Woolrich Stansfeld, Kaufmann zu Leeds, Yorkshire, am 27. Julius 1824 sich ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts, N. 65. S.
113.
Mit Abbildungen auf Tab.
VIII.
Stansfeld's, Verbesserungen an den Kunst-Stühlen, und in Zurichtung
der Kette für dieselben.
Diese Verbesserungen bestehen:
1) in gewissen, an dem Kunst-Stuhle angebrachten, Vorrichtungen, wodurch die Faden
von dem Garn- oder Kettenbaume nachgelassen, und der gewobene Zeug vortheilhafter,
als bisher, auf dem Tuchbaume aufgerollt werden kann.
2) in einer Weise, mehrere Stuͤhle mittelst einer sich drehenden Achse in Gang
zu bringen, und jeden dieser Stuͤhle einzeln still stehen zu lassen, ohne daß
die uͤbrigen dadurch in ihrer Arbeit unterbrochen wuͤrden.
3) in einem Verfahren und in einer Vorrichtung, die Kette zuzurichten, d.h. sie
zugleich zu faͤrben und zu schlichten.
Tab. VIII. Fig.
21. ist ein Quer-Durchschnitt des Kunst-Stuhles, an welchem alle die
Theile, welche nicht neu sind, (z.B. die Vorrichtung zur Bewegung des Geschirres)
weggelassen sind, um die neuen verbesserten Theile desto deutlicher darstellen zu
koͤnnen.
a, ist der Garnbaum, auf welchem die Kette aufgewunden
ist. Von diesem laufen die Kettenfaden uͤber eine Spannruthe, b, die an dem Hintertheile des Stuhles von einer Seite
zur anderen laͤuft, und unter einer zweiten Spannruthe, c, hin, die an dem Hintertheile eines langen Hebels, d, d, befestigt ist.
Von der Spannruthe, c, laufen die Kettenfaden
aufwaͤrts zu einer Walze, e, und von da
uͤber eine andere Walze, f, zu dem Geschirre, und
durch dieses, h, und durch das Rietblatt, i, in die Lade, k, wo die
Kreuzung derselben das Gewebe bildet, welches, wenn es vollendet ist, uͤber
den Brustbaum, l, und uͤber eine andere Spannruthe, m, hinab, die an dem vorderen Ende des Hebels, d, befestigt ist, aufwaͤrts auf den Tuchbaum, o, laͤuft.
Um den Stuhl in Gang zu bringen, wird die Achse oder Spindel, p, bewegt, wodurch die Arme, q, q, in Umlauf
gesezt werden: Klopfer oder Reibungs-Rollen an den Enden dieser Arme wirken
innerhalb des herzfoͤrmigen Hebels oder Rahmens, r, r,
r, und machen, daß dieser Rahmen oder Hebel auf seinem Zapfen unten in der
gekruͤmmten Stange, s, s, schaukelt.
An dem oberen Ende dieses Rahmens oder Hebels, r,
befindet sich eine Stange, t, welche den Rahmen, r, mit der Lade, k,
verbindet. Folglich muß, so wie der Rahmen, r, sich
schwingt, die Lade sich gleichfalls schwingen, und zwar mit verschiedenen
Geschwindigkeiten in den verschiedenen Zeitraͤumen ihrer Schwingung, nach dem
Grade der Excentricitaͤt des herzfoͤrmigen Rahmens hinsichtlich auf
die Drehe-Achse, p.
Das Spiel dieses Kunst-Stuhles ist großen Theiles jenem der uͤbrigen
Kunst-Stuͤhle aͤhnlich, und braucht daher nicht in seinem ganzen
Detail erklaͤrt zu werden.
Die Umdrehung der Haupt-Achse, p, mit ihren Armen, q, welche den Rahmen oder Hebel, r, hin und her bewegt, macht, daß die Lade, k,
sich gleichfalls schwingt, so daß, wann sie zuruͤktritt, der Schuͤzen
durchgeworfen werden kann, durch die geoͤffnete Kette, und, wann sie wieder
vorruͤkt, der durchgeworfene Faden oder Eintrag eingeschlagen werden kann, um
das Gewebe zu vollenden.
Der Schuͤzen wird durch die Schwingung des Hebels, v, wie bei anderen Kunst-Stuͤhlen, durchgeworfen.
Die Staͤrke, mit welcher das Rietblatt das Gewebe schlaͤgt, indem es
den Eintrag einschlaͤgt, macht, daß die Kettenfaden dicht angezogen werden,
und da diese lezteren unter der Spannruthe, c,
weglaufen, wird das Ende des langen Hebels, d, bei c, auf diese Weise etwas gehoben, wo dann die Ruche, c, welche gegen den gekruͤmmten Hebel, n, druͤkt, diesen Hebel hebt, und den Sperrkegel
an dem entgegengesezten Ende fuͤr einen Augenblik aus dem Sperrrade am
Garnbaume, a, aushebt, wodurch dieses Rad um einen Zahn
auslaͤßt, und das Vorruͤken des Garnbaumes, a, etwas von der Kette nachlaͤßt: denn augenbliklich tritt der
Sperrkegel durch die Kraft einer Feder, die unter dem gekruͤmmten Hebel
wirkt, wieder in das Rad ein. Auf diese Weise wird, so oft die Lade vorwaͤrts tritt, um den Eintrag
einzuschlagen, eine hinlaͤngliche Menge von der Kette nachgelassen.
Durch dieses Einschlagen des Eintrages mittelst der Lade wird das entgegengesezte
Ende des Hebels, d, bei m,
niedergedruͤkt, und das vollendete Gewebe auf diese Weise vorwaͤrts
uͤber den Brustbaum, l, gezogen, wo dann ein Arm,
w, der von dem unteren Ende des Schenkels der Lade
auslaͤuft, und mit einer Schnur mit einem Gewichte versehen ist, die um eine
Rolle am Ende des Tuchbaumes, o, laͤuft, diesen
lezteren so zieht, daß er das Gewebe aufrollt: der Garnbaum kann, wegen der
daruͤber befindlichen Sperr-Klinke, x, die in das
Zahnrad eingreift, welches an demselben angebracht ist, nicht mehr
zuruͤk.
Um den Kettenfaden die noch uͤbrigens noͤthige Spannung zu geben,
nachdem der Eintrag bereits eingeschlagen wurde, wird ein Zapfenrad an der
Hauptachse, p, angebracht, (was man in der Figur nicht
sehen kann), wodurch in demselben Augenblike ein Hebel, y, mit seiner senkrechten Stange, z,
niedergedruͤkt wird. An dem oberen Ende dieser Stange, z, ist eine horizontal uͤber den Stuhl hinlaufende Ruthe, g, befestigt, durch welche die Faden der Kette aus ihrer
geraden Richtung gebracht werden, und dadurch folglich eine groͤßere Spannung
erhalten. So wie aber die Lade in ihre vorige Lage zuruͤktritt, und das
Gelese der Kette sich oͤffnen muß, um den Eintrag mit dem Schuͤzen
durchzulassen, laͤßt das Zapfenrad den Hebel, y,
und die Stangen, z und g, in
die Hoͤhe steigen, und folglich die Kette nachlassen, so daß die Gelese ohne
allen Nachtheil geoͤffnet werden koͤnnen.
Das Oeffnen der Kette geschieht, wie gewoͤhnlich, durch das abwechselnde Spiel
der Geschirre, h, welche an einer Schnur haͤngen,
die oben uͤber eine Rolle laͤuft, und auf die gewoͤhnliche
Weise mittelst der unten angebrachten Schaͤmel in Bewegung gesezt werden.
Diese Schaͤmel werden durch Zapfenraͤder getrieben, welche sich auf
der Hauptachse, p, befinden, die aber in der Figur
weggelassen werden mußten, um dieselbe nicht undeutlich zu machen.
Was die zweite Verbesserung betrifft, eine Reihe von Stuͤhlen durch eine
einzige sich drehende Achse in Gang zu bringen, und jeden Stuhl einzeln still stehen
zu lassen, ohne daß die uͤbrigen Stuͤhle dadurch in ihrer Arbeit
aufgehalten werden, so schlaͤgt der Patent-Traͤger vor, eine Reihe von Stuͤhlen
neben einander in demselben Gebaͤude anzubringen, und eine Hauptachse, p, durch die ganze Reihe durchzufuͤhren. Die
Zapfen oder Daͤumlinge zum Treiben der einzelnen Stuͤhle
muͤssen aber hier nicht auf der Hauptachse selbst, sondern auf Schliefern
oder Roͤhren angebracht werden, die sich auf dieser Hauptachse leicht
schieben lassen.
Diese Schliefer oder Roͤhren mit ihren Zapfen muͤssen auf der
Hauptachse mittelst einer Fangbuͤchse, die sich schieben laͤßt, oder
mittelst irgend einer anderen, den Mechanikern wohlbekannten, Vorrichtung befestigt
werden koͤnnen.
Wenn alle Stuͤhle einer Reihe auf diese Weise in Gang gebracht wurden, und es
noͤthig wird, einen Stuhl außer Thaͤtigkeit zu sezen, so wird seine
Fangbuͤchse auf der Hauptachse zuruͤkgeschoben, und dis auf diese
Weise außer Umtrieb gesezte Roͤhre bleibt still, und laͤßt den Stuhl
gleichfalls still stehen, den sie getrieben hat, waͤhrend alle
uͤbrigen Stuͤhle fortarbeiten.
Fig. 22.
zeigt die von dem Patent-Traͤger vorgeschlagene Weise, die Kette zuzurichten
und zu schlichten. Die Figur ist mehr eine ideale Ansicht, als eine getreue
Darstellung eines wirklichen Apparates. Das Garn wird auf die Walzen, a, a, a, a, aufgerollt, und wieder von denselben
abgewunden, wo es dann durch einen Trichter laͤuft, um alle Faden
zusammenzubringen.
Ein Walzenpaar, c, nimmt das Garn auf, und leitet es in
den Trog, d, wo es in Faͤrbebruͤhe
eingetaucht, in bedeutender Menge liegen bleibt. Nachdem das Garn in diesem Troge
gefaͤrbt wurde, wird es aus demselben herausgezogen, und durch die Walzen,
e, ausgedruͤckt, wo dann die
Faͤrbe-Fluͤßigkeit wieder in den Trog zuruͤkfließt. Aus den
Walzen, e, laͤuft das Garn zu anderen
aͤhnlichen Walzen, f, die dasselbe in den Trog,
g, leiten, wo es durch eine gallertartige
Fluͤßigkeit laͤuft, und so geschlichtet wird.
Wenn die Farbe, in welcher das Garn gefaͤrbt wird, von der Art ist, daß eine
Beize zu derselben nothwendig wird, so wird ein Trog mit dieser Beize vor dem Troge,
d, angebracht, und das Garn zuerst durch diesen Trog
mit der Beize gezogen, und dann erst in den Faͤrbetrog gebracht, worauf man
es durch einen Trog mit klarem Wasser fuͤhrt, um alle Beize und
Faͤrbebruͤhe wegzuwaschen. Das Garn wird dann in den Trog, g, eingesenkt, um darin geschlichtet zu werden, und nach
dem Schlichten wird es
durch die Walzen, h, ausgepreßt, und in das Rietblatt,
i, gefuͤhrt, wo die Faden durch die Stifte
desselben getrennt werden, damit sie nicht zusammenhaͤngen koͤnnen.
Hierauf kommen die Faden uͤber die Walze, k,
durch ein zweites Rietblatt, l, uͤber eine andere
Walze, m, in ein drittes Rietblatt, n, wo sie endlich hinlaͤnglich getrennt worden
sind, und dann auf den Garnbaum, o, aufgewunden, und in
den Stuhl gebracht werden koͤnnen.
Das Neue an dieser Erfindung ist:
1) die kleine Spannruthe, b, vorne am Stuhle unter dem
Kettenbaume; der lange Hebel, d, der quer uͤber
den Stuhl laͤuft, und die beiden Querruthen, c
und m, an den Enden desselben, wodurch die Kettenfaden
und das Gewebe angezogen werden, und der gekruͤmmte Hebel und die Klinke, n, die durch die Schwingung des langen Hebels, d, bewegt wird, um, noͤthigen Falles, die Kette
nachzulassen.
2) Der Schliefer oder die Roͤhre mit den verschiedenen Zapfen, welche
Roͤhre sich auf der Hauptachse, p, schiebt, und
mittelst einer Fangbuͤchse befestigt wird, wodurch dann jeder Stuhl einzeln
aus dem Gange gebracht werden kann, ohne die Arbeit der uͤbrigen zu
unterbrechen.
3) Die Anordnung der Walzen, Troͤge und Rietblaͤtter, zum
Faͤrben, Schlichten und Aufziehen der Kette.
Tafeln