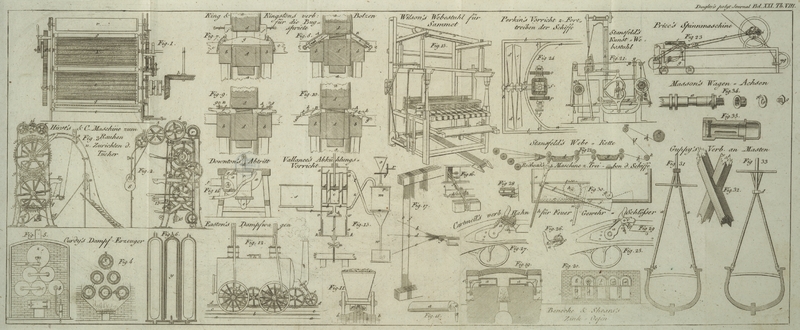| Titel: | Verbesserungen bei Dampf-Erzeugung, worauf Joh. M'Curdy, Esq., Cecil-Street, Strand, am 27. Dec. 1825 sich ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. CI., S. 409 |
| Download: | XML |
CI.
Verbesserungen bei Dampf-Erzeugung, worauf
Joh. M'Curdy, Esq.,
Cecil-Street, Strand, am 27. Dec. 1825 sich ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Juni. S.
287.
Mit Abbildungen auf Tab.
VIII.
M'Curdy's, Verbesserungen bei Dampf-Erzeugung.
Der Kessel besteht hier aus einer Reihe von Roͤhren mit
einigen besonderen Vorrichtungen, die der Patent-Traͤger fuͤr neu
erklaͤrt. „Meine Erfindung,“ sagt er, „beruht
in einer neuen Verbindung von Materialien, oder in. der Anwendung alter
wohlbekannter Substanzen zu einem besonderen Zweke, der sowohl neu als
nuͤzlich ist, und den ich nach seiner Form Franklin's. doppelten Dampf-Erzeuger (Franklin's Duplex Steam Generator) nenne.“
Der Kessel besteht aus irgend einer Anzahl cylindrischer Gefaͤße von irgend
einer schiklichen Laͤnge und Weite, welche beide nach der Groͤße der
Maschine, die sie zu treiben haben, oder, mit anderen Worten, nach der Menge
Dampfes, dessen man bedarf, bestimmt werden muͤssen. Diese Gefaͤße
sind aus Guß- oder Hammer-Eisen, oder aus irgend einem anderen schiklichen
Materiale, das hinlaͤnglich stark ist. In jeder dieser Roͤhren
befindet sich eine andere aͤhnliche Roͤhre, die genau an die innere Oberflaͤche
derselben paßt, jedoch einen sehr kleinen Zwischenraum zwischen beiden laͤßt,
so daß Wasser und Dampf zwischen denselben durch kann. Die innere Roͤhre wird
in der aͤußeren mittelst kleiner Bloͤke, Rippen, oder dazwischen
angebrachter, gerader oder gewundener, Metall-Streifen in ihrer Lage erhalten, oder
beide Flaͤchen dieser Roͤhren koͤnnen durch eingelassene und
vernietete Bolzen in gehoͤriger Entfernung von einander erhalten werden.
Eine beliebige Anzahl dieser Roͤhren kann in einem gewoͤhnlichen Ofen
auf aͤhnliche Weise, wie die Retorten bei der Gas-Entwikelung, und so wie
Fig. 4.
Tab. VIII. zeigt (wo ein Theil des Ofens im Querdurchschnitte dargestellt ist, und
die Gefaͤße auf die zur Heizung vorteilhafteste Weise gestellt sind),
angebracht werden.
Fig. 5. zeigt
den Ofen von vorne, und stellt die Enden dieser Gefaͤße dar, woran die
Verbindungs-Roͤhren, durch welche das Wasser und der Dampf aus einem
Gefaͤße in das andere laͤuft, aufgesezt und angebolzt sind.
Das Wasser wird mittelst einer Drukpumpe, a, in das erste
Gefaͤß, b, getrieben, und laͤuft durch den
engen Zwischenraum zwischen den beiden Gefaͤßen, wie die Pfeile in dem
horizontalen Durchschnitte in Fig. 6. zeigen, in das
naͤchststehende Gefaͤß, c, mittelst der
Verbindungs-Roͤhre, d, und so fort, bis alles
Wasser durch alle Roͤhren durchgelaufen ist, und auf seinem Laufe ganz oder
theilweise in Dampf verwandelt wurde.
Am Ende der Reihen dieser Gefaͤße liegt ein weiteres Gefaͤß, z, welches der Patent-Traͤger Dampf-Messer
„(im Original laͤcherlich genug Steamometer, nach dem Englischen Steam (Dampf) und dem Griechischen Meter)“ nennt, zu oberst in dem Ofen.
In dem Inneren desselben liegt ein offenes Gefaͤß, y, (Fig.
6.), welches zur Aufnahme des Dampfes bestimmt ist, und ein
Dampfbehaͤlter wird.
Da dieser Dampfbehaͤlter zu hoͤchst oben liegt, so kann die
staͤrkste Hize des Ofens auf die anderen unten liegenden Roͤhren
wirken, wo der Dampf zuerst erzeugt wird.
Aus dem Behaͤlter, y, geht der Dampf durch eine
Roͤhre, w, Fig. 5., zu der
Einleitungs-Klappe der Maschine; man schlaͤgt hier vor, den Behaͤlter
zehn Mahl so groß zu machen, als den arbeitenden Cylinder.
Der Patent-Traͤger bemerkt, daß er die Dampfroͤhre, w, „in den unteren Theil des Dampf-Messers
einfuͤgt, waͤhrend in den Dampfkesseln der Dampf oben ausgeleitet
wird.“ Er sagt ferner, „daß eine beliebige Anzahl Doppel-Erzeuger (Duplex
Generators) mit dem gewoͤhnlichen Kessel zur Dampferzeugung
verbunden werden kann, wenn man das Wasser mittelst einer Drukpumpe durch
dieselben treibt, und in die Dampfkammer des Kessels entladet, statt in den
Dampfmesser.“
Der Patent-Traͤger nimmt als seine Erfindung in Anspruch:
1) an den Erzeugern (Generators) die Verbindung des
Materiales, oder der Roͤhren oder Gefaͤße zur Erzeugung der verlangten
Wirkung, indem ein Gefaͤß oder eine Roͤhre so in ein anderes
Gefaͤß oder in eine andere Roͤhre gestekt wird, daß eine geringe Menge
Wassers uͤber eine große erhizte Oberflaͤche getrieben wird, indem nur
ein kleiner Zwischenraum oder Durchgang zwischen dem aͤußeren und inneren
Gefaͤße der ganzen Laͤnge nach, so wie an den
Enden des Gefaͤßes, bleibt.
2) das Offenlassen Eines Endes unter einer solchen Anzahl innerer Roͤhren oder
Gefaͤße, als zur erwuͤnschten Wirkung noͤthig ist, an den
Dampf-Messern oder Dampf-Behaͤltern.
3) die Dampf-Messer, oder einzelnen Gefaͤße zum Aufsammeln des Dampfes, mit der Ausfuͤhrungs-Klappe an dem niedrigsten
Puncte, um alle Moͤglichkeit irgend einer Wasser-Ansammlung zu
beseitigen.
4) die Ringe oder Spiralbaͤnder um die inneren Roͤhren oder
Gefaͤße, oder die Stifte, die die innere Roͤhre von der
aͤußeren entfernt halten, und den Zwischenraum zwischen beiden bilden.
Der Vortheil bei diesem Verfahren ist, daß, da das Wasser durch dasselbe in einer
sehr duͤnnen Schichte uͤber eine große erhizte Oberflaͤche
getrieben, und beinahe der unmittelbaren Einwirkung des Feuers ausgesezt wird, der
Dampf in diesen Doppel-Erzeugern mit ungeheuerer Schnelligkeit sich entwikelt; daß
diese Doppel-Erzeuger wenig Raum einnehmen, und nur wenig Brennmaterial, in
Vergleich mit anderen Kesseln, erfordern; daß endlich der Dampf in der
hoͤchsten Kraft erzeugt, und bis zur moͤglich groͤßten
Staͤrke ohne alle Gefahr getrieben werden
kann.
Der Patent-Traͤger bemerkt ferner, daß „in Folge des engen Raumes
zwischen der aͤußeren und inneren Roͤhre, der immer erhalten wird,
keine Anhaͤufung von Wasser Statt haben kann, da immer Stroͤmung
zwischen demselben vorhanden ist, und daß der Durch-Messer der Doppel-Erzeuger
hierauf keinen Einfluß haben kann, indem der enge Raum immer derselbe
bleibt.
Die Erzeugung des Dampfes geschieht schnell und beinahe augenbliklich; es kann keine
groͤßere Menge Wassers in einem gewissen Systeme von Doppel-Erzeugern,
moͤgen deren noch so viele angewendet werden, enthalten seyn, als in dem
Raume zwischen den aͤußeren und inneren Roͤhren bis zur Hoͤhe
der Einfuͤgung hinauf enthalten ist; waͤhrend, wenn der Dampf in
offenen oder einzelnen Gefaͤßen erzeugt wird, die Stroͤmung des
Dampfes und Wassers durch dieselben zerstoͤrt wird, da das Wasser durch seine
eigene Schwere (der Druk des Dampfes ist auf allen Seiten gleich) zu Boden
faͤllt, und folglich nicht auf die obere und ausgedehnteste
Oberflaͤche derselben wirkt. Auf diese Weise werden diese Gefaͤße bald
mit Wasser gefuͤllt seyn, und hoͤchstens Kessel werden. Ein großer
Theil des Wassers wird in die Maschine uͤbergehen, ohne in Dampf verwandelt
worden zu seyn, und so die Arbeit erschweren und die Kraft laͤhmen.
„Die Menge Wassers, die in die Doppel-Erzeuger eingesprizt wird,
laͤßt sich durch einen Sperrhahn reguliren, der an der von dem Brunnen
oder dem Wasserbehaͤlter herleitenden Roͤhre angebracht ist; auch
kann man an der unteren Seite des Dampfmessers einen Hahn einfuͤgen, um
zu sehen, ob die Pumpe zuviel Wasser in die Dampferzeuger treibt.“
Der Patent-Traͤger bemerkt ferner: „daß irgend eine Anzahl von
Doppel-Gefaͤßen, die so flach sind, daß ihre beiden Seiten nahe an
einander kommen koͤnnen, und dadurch einen Zwischenraum zum Durchgange
des Wassers bilden, ohne alles inneres Gefaͤß,
wenn sie nur an ihren Enden auf eine aͤhnliche Weise verbunden sind, und
zu einem gemeinschaftlichen Dampf-Messer fuͤhren, nach demselben
Grundsaze auf aͤhnliche Weise Dampf erzeugen werden; daß sie aber nicht
so stark seyn werden, als cylindrische Gefaͤße; daß ihre Verbindung an
den Enden nicht minder schwierig ist, und daß sie der Gefahr ausgesezt sind,
sich in der Mitte auszudehnen, und so die Wirkung eines gemeinschaftlichen Stromes durch
dieselben zu zerstoͤren.“
Er schließt endlich damit: „daß die aͤußeren Roͤhren oder
Gefaͤße mit Thon uͤberzogen werden koͤnnen, oder mit irgend
einem anderen Stoffe, der sie dauerhafter macht, und gegen das Verrosten
schuͤzt, und daß das innere Gefaͤß in dem Dampft-Messer nicht
durchaus unentbehrlich ist.“
Wir besorgen sehr, daß, wenn Hr. M'Curdy nicht
destillirtes Wasser zur Dampferzeugung nimmt, die engen
Zwischenraͤume zwischen den Roͤhren oder Gefaͤßen bald
mit dem Niederschlage aus den erdigen und salzigen Bestandtheilen, welche in
jedem nicht destillirten Wasser vorhanden sind, vollgefuͤllt, und
dadurch endlich gaͤnzlich verlegt werden muͤssen. A. d.
Ueb.
Tafeln