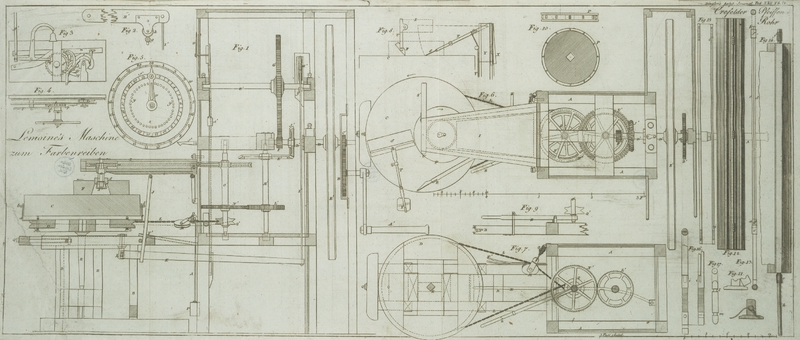| Titel: | Ueber eine Maschine zum Farbenreiben, die Hr. Lemoine, Paris rue de Poitou, N. 7. aux marais, erfind. Von Hrn. Molard d. jüng., im Namen de Ausschusses für Mechanik. |
| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. XXXI., S. 177 |
| Download: | XML |
XXXI.
Ueber eine Maschine zum Farbenreiben, die Hr. Lemoine, Paris rue de Poitou, N.
7. aux marais, erfind. Von Hrn. Molard d. juͤng., im Namen de
Ausschusses fuͤr Mechanik.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement. N. 265. S. 212.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
(Im
Auszuge.)
Lemoine, uͤber eine Maschine zum Farbenreiben.
Die Société
d'Encouragement hat vor einiger Zeit einen Preis auf eine Maschine zum
Farbenreiben ausgeschrieben, den sie spaͤter wieder zuruͤknahm, weil
Niemand sich meldete. Wenn man den Termin verlaͤngert haͤtte,
wuͤrde man wahrscheinlich in diesem Jahre diesen Preis zuerkennen
koͤnnen: denn Hr. Lemoine, dessen Maschine wir
hier beschreiben, ist nicht der einzige, der sich mit diesem Gegenstande
beschaͤftigte; auch Herr Roard zu Clichy besizt
eine treffliche Maschine zum Mahlen des Bleiweißes. Man hat ferner im Dictionnaire technologique, und im Hebdomadaire zwei Maschinell zum Farbenreiben bekannt
gemacht, die, wie man sagt, in England gewoͤhnlich gebraucht werden. Erstere
hat Aehnlichkeit mir jener Maschine, deren man sich zum Zerreiben der Kieselerde zur
Glasur in Toͤpfereien bedient, wo die Laͤufer nicht aus Stein, sondern
aus Gußstahl sind. Die andere besteht aus einem senkrechten Laͤufer aus einem
harten Steine, der sich mittelst einer Kurbel um seine Achse dreht, und aus einem
festen Stuͤke, welches einen Theil eines hohlen Cylinders bildet, concav, und
gleichfalls aus hartem Steine ist, und ungefaͤhr 1/3 des Umfanges des
Laͤufers umfaßt, und auf denselben druͤkt. Die auf den Laͤufer
aufgelegte Farbe wird unter die Hoͤhlung des Cylinder-Stuͤkes
hineingezogen; und zwischen den beiden Steinen desto feiner gemahlen, je schneller
und je laͤnger man den Laͤufer dreht. Wir haben diese Maschine vor 20
Jahren, im IVten Jahrgange des Bulletin (Brumaire an 14
me
p. 112) beschrieben und abgebildet.
Hr. Lemoine ist bei seiner Maschine, auf welche er ein Brevet d'invention nahm, bei dem alten Systeme des
Laͤufers geblieben. Er hat zwei horizontale, auf einander laufende, harte
Steine, deren Durchmesser sich wie 2 : 1 verhalt: der groͤßere ist der
untere. Beide drehen sich in entgegengesezter Richtung, und jeder um seine Achse.
Der obere Stein ist so gestellt, daß er mit seinem Rande ungefaͤhr einen Zoll
uͤber den Mittelpunct des unteren hinuͤberragt, und mit seiner ganzen
Schwere, die zwischen 30 und 40 Pfund betraͤgt, druͤken kann. Er hebt
sich zuweilen, um Farbe unter sich zu nehmen, die er dann reibt, so daß auf diese
Weise die ganze Masse durchgerieben wird.
Um diese gleichzeitige umdrehende und senkrechte Bewegung an dem oberen Steine
hervorzubringen, hat Hr. Lemoine seine Kette mit
doppelter Gliederung (Bulletin de la
Société, 1825, p. 277. Polytechn. Journ. Bd.
XX. S. 154.) angebracht. Ein Zaͤhler zaͤhlt die Zahl der
Umdrehungen der Steine, und bestimmt folglich den Grad der Feinheit, auf welchen
eine gewisse Farbe nach einer gewissen Zahl von Umdrehungen gekommen ist, und, wenn
man einmahl aus Erfahrung weiß, daß die Farbe durch eine gewisse Zahl von
Umdrehungen fein geworden ist, so richtet man den Zahler so ein, daß er
schlaͤgt, und dadurch andeutet, daß die Arbeit vollendet ist. Auf diese Weise
erhaͤlt man vollkommen gleichfoͤrmig geriebene Farben. Sobald der
Zaͤhler durch sein Schlagen dieses Zeichen gegeben hat, faͤllt ein
gehoͤrig vorgerichtetes großes Messer auf den unteren Stein nieder, und
sammelt, mit einer Umdrehung, alle auf demselben ausgebreitet liegende Farbe. Der
obere Stein blecht waͤhrend dieser Zeit mittelst eines Hebels in die
Hoͤhe gehalten.
Die Maschine, die wir sahen, besteht aus 3 Systemen von Laͤufern. Ein einziger
Mensch, der eine Kurbel dreht, treibt alle diese drei Laͤufer, wovon zwei
Wasserfarben, der dritte Oehlfarbe reibt, und wozu man sonst drei Menschen brauchen
wuͤrde. Bleiweiß mit Oehl kann hingegen Ein Mensch nur soviel auf dieser
Maschine reiben, als sonst zwei reiben wuͤrden. Das Raͤderwerk und der
ganze Mechanismus der Maschine ist so eingerichtet, daß weder das Oehl noch der
Staub derselben zu der Farbe gelangen, und diese verunreinigen kann.
Es ist eine Wohlthat, die man der Menschheit erwiesen hat, indem man das der
Gesundheit so gefaͤhrliche Farbenreiben, welches so oft Bleikolik erzeugte,
durch Maschinen unschaͤdlich machte.
In vorliegender Maschine dreht sich der untere Stein, C,
um seine Achse, E, in einem Gestelle, B, auf welchem das ganze System ruht. Dieser Stein ist
mit einem eisernen Panzer, a, Fig. 1. umgeben, welcher
an seinem Rande mittelst der Schrauben, b, b, befestigt
ist, und auf einer Rolle aufgezogen, D, um welche eine
Kette, L, laͤuft, die denselben bewegt. Drei
Schrauben, c, c, die gleich weit von einander stehen,
laufen durch die Rolle, wodurch der Stein gestellt werden kann.
Der Laͤufer, F, dessen Durchmesser beinahe um die
Haͤlfte kleiner ist, als der des unteren Steines, ist auf einer Achse, g, aufgezogen, die in einem Halse, d, stekt, und mit der Rolle, H, einen Koͤrper bildet, welche sich innerhalb einer Buͤhne,
I, am Ende derselben dreht, die unten mit einer
gegossenen Platte, i, verstaͤrkt ist, damit sie
an Gewicht und Festigkeit gewinnt. Dieser Laͤufer kann nach zwei Seiten
gedreht werden: die Achse, g, dient bloß zur Festhaltung
desselben. Die Buͤhne, die sich auf Zapfen dreht, e, stuͤzt sich auf einem kruͤkenfoͤrmigen Fuße, J, welcher mit einem großen Hebel, K, verbunden ist, dessen Mittelpunct der Bewegung in,
h, ist.
Der Stein, C, macht 10 Umlaͤufe, waͤhrend
der obere Stein, oder Laͤufer, 50 Mahl umlauft: waͤhrend dieser Zeit
wird lezterer 6 Mahl gehoben, um die Farbe unter denselben zu bringen.
Nach Vollendung der Arbeit, d.h., nach 2000 Umlaufen des Laͤufers, kommt ein
großes Messer in Form eines Rechens, 8, welches sich am Ende der Stange, T befindet, herab, und sammelt die geriebene Farbe.
Ein anderes Messer, R, welches bestaͤndig auf
seiner Stelle bleibt, bringt die Farbe, die sich am Rande des Laͤufers
anhaͤngt, vom Umfange nach dem Mittelpuncte, und ein drittes Messer, U, welches an der Buͤhne, I, angebracht ist, reinigt den Rand des Laͤufers.
Der Mechanismus, welcher die Steine in Umlauf sezt, ist in dem Gestelle, A, A, welches von allen Seiten geschlossen ist, damit
kein Staub hinein kommt.
Ein Arbeiter an der Kurbel, A', treibt ein Zahnrad, B', welches in einen Triebstok, C', eingreift, der auf der Hauptachse,
D', aufgezogen ist. Diese Achse fuͤhrt ein
Flugrad, E', und ein Winkelrad, J', welches ein anderes Winkelrad, K', treibt,
das einen groͤßeren Durchmesser hat, und auf der senkrechten Achse, M', aufgezogen ist.
Der untere Theil dieser Achse fuͤhrt ein Zahnrad, L', das in ein anderes Zahnrad, N', eingreift,
welches auf einer senkrechten Achse, O', befestigt ist,
und diese Achse fuͤhrt an ihrem oberem Theile eine große Rolle, P', um welche sich eine Kette windet, die die Rolle, H, und dadurch den Laͤufer, F, treibt. Ihr unteres Ende ist mit einer kleinen Rolle,
Q', versehen, welche die Kette, L, aufnimmt, die die Rolle, D, umfaßt, und diese Rolle, und den Stein, C,
dreht. Die Kette, L, aus Gliedern bestehend, die sich
nach allen Seiten drehen, laͤuft, sich kreuzend, um die Rolle, Q', (Fig. 7.), und wird von
einer Rolle, M, gespannt, die in ihrer horizontalen Lage
durch ein Gegengewicht, P, erhalten wird, welches an
einer Schnur, N, haͤngt, die uͤber eine
kleine Rolle, O, laͤuft. Man kann
uͤberdieß noch die Kette spannen, oder nachlassen, je nachdem man die
Schraube, Q, anzieht oder nachlaßt. Wenn man die
Bewegung unterbrechen will, laͤßt man den Brems-Hebel, Z, wirken, der die Rolle, Q', umfaßt, und in
Fig. 9.
besonders abgebildet ist.
Die Buͤhne, I, und der Laͤufer werden in
geregelten Zwischenraͤumen gehoben, damit die ganze Farbe gehoͤrig
gerieben werden kann; dieß geschieht auf folgende Weise.
Auf der Achse, D', ist ein Triebstok, F', aufgezogen, der in ein großes Rad, G', eingreift, welches auf der Achse, R', befestigt ist. Diese Achse fuͤhrt einen
Daͤumling oder Zahn, g, welcher, bei jeder vollen
Umdrehung desselben, eine kleine Walze, k, die unter dem
Wagebalken, oder unter der Schaukel, H, (Fig. 2. Tab. IV.)
angebracht ist, hebt. Das Ende dieses Wagebalkens fuͤhrt eine Stange, I, die den großen Hebel, K,
hebt, und folglich auch die Buͤhne, I, durch
Beihuͤlfe der Kruͤke, J'. Diese Operation
geschieht 6 Mahl waͤhrend 50 Umdrehungen.
Der oben an dem Gestelle angebrachte Zaͤhler, A,
A, zeigt die Zahl der Umlaͤufe des Laͤufers, und erinnert den
Arbeiter, daß die Arbeit fertig ist, die Farbe weggenommen, und neue aufgelegt
werden muß, was gewoͤhnlich nach 2000 Umlaͤufen des Laͤufers
der Fall ist. In diesem Augenblike laͤßt eine durch den Mechanismus des
Zaͤhlers gezogene Schnur das große Messer, R,
fallen, das immer 6 Zoll uͤber dem Laͤufer sieht, und dieses sammelt
in einem Umlaufe, die Farbe.
Wir haben diesen Zaͤhler, der Deutlichkeit wegen, in einem groͤßeren
Maßstabe zeichnen lassen. Man sieht ihn im Grundrisse und Aufrisse in Fig. 3, 4, 5. Er besteht
aus zwei Sperrraͤdern, deren eines, I, 40
Zaͤhne fuͤhrt, und mittelst eines Hebels, o', durch den Sperrkegel, r, gefuͤhrt
wird, der es nach 25 Umdrehungen des Laͤufers, um Einen Zahn weiter
stoͤßt. Das andere Sperrrad hat 8 Zaͤhne, und wird von einem
Sperrkegel, c', getrieben, der sich an dem Wagebalken,
n, befindet. Dieser leztere wird von einer Stange
getrieben, die durch das ganze Gestell, A,
laͤuft, und mit dem Schwingbalken, H', in
Verbindung sieht, durch dessen Huͤlfe der Laͤufer gehoben wird.
Ein Arm des Hebels, t, der durch einen Vorsprung, b', in der Scheibe, d',
gehoben wird, ist an seinem Ende mit einer Gloke versehen, die dem Arbeiter das
Zeichen gibt. Zu gleicher Zeit wird aber auch die Stange, h, gezogen, welche mit der Schnur, V, in
Verbindung steht, und dadurch faͤllt das große Messer, R. Das Ausheben geschieht mittelst eines Gewichtes, a', das an einer Schnur haͤngt, und den Sperrkegel, p, aushebt, der durch einen Zahn, e', der Scheibe, d', vorgetrieben wird. Alle
diese Sperrkegeln werden durch Federn, ss,
angedruͤkt.
Der Zaͤhler fuͤhrt zwei Zifferkreise, wovon der eine, w, fest steht, der andere, z, beweglich ist. Sie sind in 42 gleiche Theile getheilt, und haben Ziffern
von 1 bis 20.
Ein Zeiger, v, der auf der Spindel, u, des Sperrrades, l,
aufgezogen ist, zeigt die Zahl der Umlaͤufe, die der Laͤufer macht, er
ist an seiner vorderen Flaͤche mit einem Halter, x, versehen, dessen gekruͤmmtes Ende in die Loͤcher, y, y, des beweglichen Zifferkreises, z, eingreift, der auf dem Stiefel der Scheibe, d', aufgezogen ist, und den Zeiger auf diesem Kreise
haͤlt. Um ihn los zu machen, druͤkt man auf den Haͤlter, und
dreht, mittelst des Knopfes, f, den Zifferkreis, z, wodurch die Ziffern unter den Zeiger kommen, der
waͤhrend 50 Umdrehungen des Laͤufers, um eine halbe Abtheilung
vorruͤkt.
Erklaͤrung der Figuren.
Fig. 1.
Senkrechter Durchschnitt der Maschine und der Steine.
Fig. 2.
Stuͤk des Schwingbalkens, durch welchen der Laͤufer abwechselnd
regelmaͤßig gehoben wird.
Fig. 3.
Mechanismus des Zaͤhlers im Aufrisse.
Fig. 4.
Derselbe von der Seite.
Fig. 5. Das
Zifferblatt des Zahlers von vorne.
Fig. 6. Die
Steine und ein Theil des Mechanismus von oben.
Fig. 7.
Grundriß des Gestelles der Reibsteine.
Fig. 8. Die
Messer, die die Farbe sammeln, im Detail.
Fig. 9. Der
Brems-Hebel, einzeln dargestellt.
Fig. 10.
Grund- und Seiten-Aufriß der Rolle, um welche die Kette laͤuft, die den
Laͤufer dreht. Sie ist mit hervorstehenden Zapfen versehen, die in die
Gelenke der Kette eingreifen, und hindern, daß sie in der Kehle der Kurbel nicht
hinschleift.
Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in allen Figuren.
A, A, Gestell, welches den Mechanismus einschließt, der
die Steine treibt.
B, B, Gestell, welches den Reibstein, C, traͤgt, auf welchem gerieben wird;
D, große, unter diesem Reibsteine befestigte, Rolle:
E, senkrechte Achse, oder Zapfen der großen Rolle;
F, Laͤufer;
G, Achse des Laͤufers;
H, Rolle, welche auf diese Achse aufgezogen ist, und den
Laͤufer in Bewegung sezt;
I, Buͤhne, welche den Laͤufer dekt, und,
durch ihr Gewicht, auf dem unteren Reibsteine haͤlt;
J, Kruͤke, welche die Buͤhne, I, stuͤzt, und in regelmaͤßigen
Zwischenraͤumen hebt;
K, Wagebalken oder Hebel an der Kruͤke, J;
L, Kette, welche den Laͤufer in Umlauf sezt;
M, Rolle, durch welche die Kette von einander gehalten
wird;
N, Schnur, die uͤber eine andere Rolle,
O, laͤuft, und ein Gewicht, P, fuͤhrt, welches die Kette spannt;
Q, Schraube, wodurch man die Kette spannen, oder
nachlassen kann;
R, Messer am Ende eines langen Hebels, um die Farbe vom
Umfange nach der Mitte des Reibsteines zu bringen;
S, ein anderes Messer in Form eines Rechens, welches die
Farbe nach der Arbeit zusammenscharrt:
T, Heft dieses Messers;
U, Messer an der Buͤhne, I, zur Reinigung des Randes des Laͤufers;
V, Schnur, welche das Messer, 8, fallen
laͤßt;
X, Feder, welche das Messer oben haͤlt;
Y, Pfeiler, an welchem diese Feder angebracht ist;
Z, Brems-Hebel.
A', Kurbel, durch welche die ganze Maschine in Bewegung
gesezt wird;
B', Zahnrad auf der Achse der Kurbel;
C', Triebstok, in welchen das Rad, B', eingreift;
D', Hauptachse;
E', Flugrad;
F', Triebstok, auf der Achse, D';
G', großes, von dem Triebstoke, F', getriebenes, Rad;
H', Schwungbalken, welcher den Hebel, K, in regelmaͤßigen Zwischenraͤumen
hebt;
I', Stange am Ende von, K;
J', Winkelrad auf der Achse, D';
K', ein anderes Winkelrad, welches von dem vorigen
getrieben wird;
L', Zahnrad auf der Achse, M', welches in ein anderes Rad,
N', eingreift, dessen Achse, O', eine große Rolle, P', fuͤhrt, die
in Fig. 10.
besonders gezeichnet ist, und die Kette aufnimmt, die die Rolle, H, des Laͤufers treibt;
Q', kleine Rolle, um welche die Kette, L, sich windet, die den Reibstein, C, bewegt;
R', Achse des Rades, G';
S', Buͤchse, in welcher das Oehl sich sammelt,
mit welchem die Achse, G, geschmiert wird;
T', Hebel, welcher den Laͤufer in der
Hoͤhe halten hilft, waͤhrend man neue Farbe auflegt; er steht mit einem
Haken in Verbindung, welcher unter dem Hebel, K,
hinlaͤuft.
a, eiserner Panzer um den Reibstein, C;
b, b, Schrauben, welche diesen Panzer befestigen;
c, c, andere Schrauben zur Befestigung des Reibsteines,
C;
d, Hals zur Aufnahme der Achse, G;
e, Zapfen, auf welchen sich die Buͤhne, I, bewegt;
f, Haken, welcher die Buͤhne haͤlt,
nachdem sie gehoben ist;
g, Daͤumling oder Zahn auf der Achse, R';
h, Mittelpunct der Bewegung des Hebels, K;
i, Eisenplatte unter der Buͤhne, I:
k, Walze des Schwingbalkens, H', worauf der Daͤumling, 3, wirkt:
l, großes Sperrrad des Zaͤhlers;
m, kleines Sperrrad desselben;
n, Hebel, wodurch das kleine Sperrad in Bewegung gesezt
wird; er wird durch den Schwingbalken, H, in
Thaͤtigkeit gesezt;
o, Hebel, welcher das große Sperrrad durch den
Sperrkegel, r, treibt;
p, Haͤlter oder Druker, der als Sperrkegel
dient;
q, zweiter Druker, um den erstem zu halten, damit das
große Sperrrad frei wird:
r, Sperrkegel mit einem Schweife, der ausgehoben wird,
wenn der Druker gesperrt ist;
s, s, s, Federn der Sperrkegel;
t, Schaukel- oder Schwingbalken zum Ausheben des Hakens
des Schwingbalkens der Reibsteine mit einer Gloke; er wird durch einen Vorsprung,
b', der Scheibe, d' in
Bewegung gesezt; u, Achse, auf welcher der feststehende
Zifferkreis aufgezogen ist;
v, Zeiger;
w, feststehender Zifferkreis;
x, Druker, welcher, indem er in die Loͤcher, y, y, des beweglichen Zifferkreises, z, eintritt, den Zeiger auf dem Zifferblatte
haͤlt.
a', Gewicht, wodurch ausgehoben, und der Druker, p, abgespannt wird;
b', Vorsprung der Scheibe, d';
c', Sperrkegel, welcher das Rad, m, schiebt;
d', Scheibe, welche an der einen Seite den Vorsprung
b', an der anderen den Zahn, e', fuͤhrt, der auf Druker, p,
drukt.
f', Knopf zum Drehen des beweglichen Zifferkreises,
z;
g', Stange in Verbindung mit der Schnur, v, die das große Messer, S,
fallen laͤßt.
Tafeln