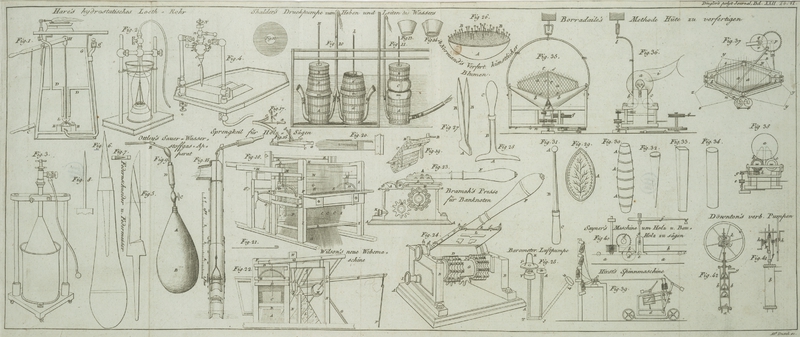| Titel: | Bramah's Maschine oder Presse zum Druke der Banknoten. |
| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. LIV., S. 274 |
| Download: | XML |
LIV.
Bramah's Maschine oder
Presse zum Druke der Banknoten.
Aus dem Glasgow Mechanics' Magazine. N. 132. S.
276.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Bramah's Maschine oder Presse zum Druke der Banknoten.
Hrn. Bramah's viele
schaͤzbare und geistreiche Erfindungen sind bei uns bereits zu sehr bekannt,
und wirken zu wohlthaͤtig auf das Publicum, als daß sie hier einer Lobrede
beduͤrften. Wir wuͤrden einen ganzen Band brauchen, um nur eine
allgemeine Uebersicht desjenigen zu liefern, was er geleistet hat. Seine
Verbesserungen an Schloͤssern; seine Drehe-Maschine, um Wasser in die
Hoͤhe zu treiben; seine hydrostatische Presse auf Krahne und Schleusen an
Canaͤlen angewendet; seine Verbesserungen an der Dampfmaschine; seine
Hobelmaschine zur Erzeugung paralleler Flaͤchen auf dem Holze; seine Methode,
Schrauben zu schneiden und Kugeln zu drehen; sein Ausgleichet oder sein Apparat, um
Cylinder auf ein Mahl zu drehen; seine Methode, Dampf in die oberen Kessel der
Brauereien zu leiten; seine Vorrichtung zum Einsperren der Kutschen, seine
verbesserten Federn, wodurch nichts vom Kiele verloren geht; seine neuen Pfropfen
und schiebbaren Hahne etc. verdienen alle Aufmerksamkeit, und wuͤrden, wenn
es der Umfang unserer Blaͤtter gestattete, von uns beschrieben werden:
gegenwaͤrtig muͤssen wir uns mit einer Beschreibung seiner
Banknoten-Presse begnuͤgen.
Ehevor war es an der Bank in England Sitte, die Zahl und das Datum in ihren Banknoten
um der Feder auf dieselben schreiben zu lassen. Erst im Jahre 1809 wurde Hrn. Bramah's Maschine hierzu angewendet, und dadurch wurden
nicht bloß die Banknoten mehr gleichfoͤrmig und zierlicher, sondern die
Arbeit selbst ward um 3/6 vermindert.
Die Kupferplatten, von welchen die Worte auf den Banknoten abgedrukt wurden, sind
doppelt: d.h., sie geben auf einem langen Streifen Papier zwei Noten auf Ein Mahl.
Dieses Stuͤk Papier, auf welchem zwei Noten abgedrukt sind, kommt dann in die Maschine, wo
die Zahl und das Datum so aufgedrukt werden, daß die Lettern fuͤr das
folgende Stuͤk sich von selbst wechseln, ohne daß der Arbeiter hierauf
besonder Acht zu geben haͤtte. Wenn z.B. eine Note N. 1, und die andere auf demselben Papiere N.
201 ist, so geht die Maschine von selbst bei dem folgenden Stuͤke, nachdem
N. 1 und N. 201 geduckt
sind, auf N. 2 und 202, u. f. f. auf 3 und 203 etc.
uͤber. Das Datum und das Wort: „London“ sind in
Stereotyp gegossen. Jede Maschine hat fuͤr jeden Tag im Jahre ihr Datum, und
dieses wird taͤglich gewechselt.
Die Bank von England hat mehr als 40 solche Maschinen, wovon die meisten
ununterbrochen im Gange sind. Da jede Banknote ihre Nummer und das Datum doppelt
fuͤhrt, so hielt man es ehevor fuͤr genug, wenn ein Schreiber des
Tages 400 solche Noten einschrieb; mit der gegenwaͤrtigen Maschine werden
aber taͤglich 1300 Doppelnoten, oder 2600 einfache Banknoten gedrukt. Die
Doppelnoten wuͤrden beim Schreiben oder Ausfuͤllen der leer gelassenen
Stellen doppelt so viele Zeit und Arbeit kosten, als die einfachen, was bei der
Maschine nun nicht der Fall ist.
Der Mechanismus dieser Maschine ist außerordentlich sinnreich, und beschraͤnkt
sich nicht bloß auf das Nummeriren der Banknoten, sondern laͤßt sich
uͤberall anwenden, wo eine Reihe von Zahlen, die bestaͤndig gewechselt
werden sollen, abgedrukt werden muß. Wir haben in unserer Figur eine solche Maschine
dargestellt, die jedoch nicht diejenige ist, deren man sich wirklich bedient; denn
sie ist nur eine einfache Maschine, und kann nur eine Note auf ein Mahl druken. Man
darf sich dieselbe jedoch nur zwei Mahl so lang, und mit einer doppelten Reihe von
Lettern versehen denken, um zwei Banknoten auf ein Mahl druken zu
koͤnnen.
Fig. 24.
zeigt diese Maschine in Perspective, und Fig. 23. stellt die
Theile derselben im Durchschnitte dar: dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben
Gegenstaͤnde. Ein festes Stuͤk Mahogony, A,
A, bildet die Basis der Maschine, und auf dieser sind zwei eiserne Platten
aufgeschraubt, B, B, die die Seitenwaͤnde eines
Gehaͤuses bilden, dessen Vordertheil in Fig. 24. abgenommen ist,
um das Innere zu zeigen: die Hinterseite ist durch den Mechanismus selbst bedekt.
Quer uͤber dieses Gehaͤuse lauft eine Achse, D, deren Zapfen in Stiefeln laufen, die an den Seiten des Gehaͤuses
befestigt sind, wie die Figur zeigt. Diese Achse fuͤhrt den Dekel, E, welcher den Druk gibt, und die darauf aufgeschraubte
Banknote abdrukt. An der Achse befindet sich ferner ein Hebel, F, wodurch der Arbeiter den Dekel
niederdruͤkt.
Die beweglichen Lettern, worin die Neuheit dieser Vorrichtung besteht, sind in einer
Reihe von Messingkreisen befindlich, die auf der Achse, G, aufgezogen sind, die quer uͤber den Mittelpunct des
Gehaͤuses laͤuft.
Diese Kreise sind in der perspectivischen Darstellung durch die darauf befindlichen
Ziffern deutlich genug dargestellt: ihrer sind zehn, die in zwei Reihen, jede zu
fuͤnf, gestellt sind. Jeder Kreis (den man in I,
Fig. 23.
deutlicher sieht), ist in 11 Theile getheilt, und in jedem Theile ist ein
senkrechter Einschnitt zur Aufnahme der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, und
eines Spatiums. Fuͤnf solche, auf diese Weise vorgerichtete, Kreise zu jeder
Seite auf der feststehenden Achse, G, um welche sie sich
frei drehen, reichen hin, um jede Zahl unter 100,000 zu druken, indem, da diese
Kreise auf ihrer Achse unabhaͤngig von einander gedreht werden
koͤnnen, jede Verbindung dieser Zahlen dargestellt werden kann, wenn man
dieselben auf den hoͤchsten Punct des Kreises bringt, in welcher Lage sie
sich naͤmlich befinden muͤssen, wenn sie abgedrukt werden sollen.
Man wird dieß noch leichter begreifen, wenn man denkt, daß die Messingplatte, welche
die Kreise bedekt, an ihrer Stelle steht, wie a, Fig. 23.
zeigt. Diese Messingplatte hat zwei Oeffnungen durchgeschnitten zur Aufnahme der
beiden Reihen von Lettern, welche etwas daruͤber empor ragen, wenn sie am
hoͤchsten stehen. In Fig. 24. ist diese Platte
abgehoben, um den inneren Mechanismus zu zeigen. Die Kreise drehen sich mittelst der
Raͤder, 51, die sich auf der sogenannten Hinterachse drehen, welche mit der
Achse der Kreise parallel ist. Man sieht das Ende hiervon bei I, Fig.
24., wo sie aus dem Gehaͤuse hervorragt, und drei der
Raͤder, H, fuͤhrt, wovon zwei eben so weit
von einander entfernt stehen, als die beiden Reihen der Zahlenkreise, zu welchen sie
gehoͤren.
Das dritte Rad steht in einer mittleren Entfernung zwischen den beiden anderen, und
wird von einem Sperrkegel, b, Fig. 23. gestellt, der
mittelst eines Gefuͤges so an der Achse des Dekels befestigt ist, daß er
gegen den hoͤchsten Zahn des Rades, H, anschlaͤgt,
und dasselbe um einen Zahn dreht, sobald der Griff etwas uͤber die senkrechte
Richtung gehoben wird, wo ein Aufhaͤlter, d, Fig. 24. der
mit einem Vorsprunge, d, Fig. 23., auf dem Dekel
der Buͤchse zusammentrifft, denselben nicht weiter laͤßt; wenn aber
der Griff in die Lage von Figur 23. kommt, gibt der
Sperrkegel, obschon er wieder mit dem Zahne des Rades zusammenkommt, auf seinem
Gefuͤge nach, und laͤuft voruͤber, ohne das Rad zu bewegen. Man
sieht, daß auf diese Weise, so oft der Griff herabgedruͤkt wird, um einen
Abdruk zu nehmen, wenn man denselben wieder hebt, um frisches Papier auf den Dekel
zu legen, der Sperrkegel die Raͤder, H, um einen
Zahn bewegt, und da die Zahne dieser Raͤder in die Zaͤhne der
Zahlenkreise eingreifen, werden auch diese auf eine aͤhnliche Weise bewegt,
und bringen eine neue Zahl zum Abdruke unter den Dekel.
Man muß bemerken, daß die Raͤder, H, von solcher
Dike sind, daß sie nur einen der fuͤnf Letternkreise auf ein Mahl ergreifen,
und daß sie in solcher Entfernung von einander stehen, daß sie denselben Kreis in
der einen Reihe, wie in der anderen ergreifen. Wenn man nun die Hinterachse um etwas
nach der Seite bewegt, so ist es offenbar, daß das Rad, H, so gestellt werden kann, daß es auf irgend einen der fuͤnf
Kreise wirkt, oder auch auf keinen derselben. Dieß ist der Grund, warum der Kopf,
I, Fig. 24. aus dem
Gehaͤuse der Maschine hervortritt; denn dadurch kann die Achse an einem Ende
gezogen, und durch gehoͤrige Zeichen auf derselben in jeden der fuͤnf
Kreise eingelassen werden. In dieser Lage wird sie dann durch eine
halbkreisfoͤrmige Klammer gehalten, die in Furchen paßt, welche um die Achse
eingedreht sind, so daß, wenn die Klammer nicht ausgehoben wird, jede
Laͤngen-Bewegung unmoͤglich wird. Dieß kann durch ein Niet geschehen,
welches durch die Hinterseite des Gehaͤuses bei, K, Fig.
23. eintritt. Es ist naͤmlich innenwendig ein kurzer Hebel daran
angebracht, welcher, wem? das Niet gedreht wird, die Klammer aufhebt, und die Achse
frei laͤßt, waͤhrend dieselbe an den gehoͤrigen Kreis gebracht
wird, wo man dann die Klammer wieder in die gehoͤrige Furche fallen
laͤßt, und so jede andere Seiten-Bewegung unmoͤglich macht.
Damit alle Kreise genau auf dem Puncte stehen bleiben, wo die Zahl am
hoͤchsten, und folglich die Oberflaͤche derselben horizontal steht, ist in den
Zwischenraͤumen zwischen jeder Zahl innenwendig in den Zahlenkreisen ein
winkeliger Einschnitt gemacht, und an dem untersten Puncte des Kreises, e, Fig. 23. befindet sich
ein beweglicher Stift in der feststehenden Achse mit einer Feder, die
bestaͤndig nach abwaͤrts druͤkt. Der Stift ist an seinem Ende
kugelfoͤrmig und gut polirt, so daß, wenn der Kreis umgedreht wird, er in
sein Loch in der Achse gedruͤkt wird; wenn sich aber ein anderer Einschnitt
in dem Kreise darbiethet, so druͤkt sich der Stift in denselben hinein, und
haͤlt den Kreis mit einer maͤßigen Kraft so lange in seiner
gehoͤrigen Lage zuruͤk, bis der Dekel, wenn er auf obige Weise gehoben
wird, den Widerstand des Stiftes uͤberwaͤltigt, und den Kreis dreht.
Durch diese Vorrichtung stellen die Lettern oder Zahlen sich immer in gerader
Richtung, nachdem sie gedreht wurden, indem der Druk sonst sehr unregelmaͤßig
und haͤßlich aussehen wuͤrde.
Der Dekel, E, Fig. 23. besteht aus zwei
Theilen; einer dichten Messingplatte, auf welcher einige Lagen Tuches gelegt, und
von einem messingenen Rahmen (dem zweiten Theile) festgehalten werden. Dieser Rahmen
ist mit Pergament uͤberzogen, und mittelst vier Schrauben aufgeschraubt,
wovon man zwei in f, f, Fig. 24. sieht.
Die Messingplatte des Dekels ist an dem Blatte, L, Figur 23.,
welches von der Achse hervorspringt, mittelst sechs Schrauben befestigt. Zwei
derselben, von welchen man bloß, h, sehen kann, streben
den Dekel von dem Blatte zu entfernen, waͤhrend die vier anderen, wovon zu
beiden Seiten neben den vorigen eine steht, Blatt und Dekel aneinander ziehen.
Mittelst dieser Schrauben, die so gegen einander wirken, kann der Dekel so gestellt
werden, daß er immer genau auf die Lettern faͤllt, und auf alle Theile des
Papieres gleichmaͤßig druͤkt, welches mittelst eines Raͤhmchens
aus Pergament, das in einem Rahmen aufgezogen ist, der den Dekel umgibt, und auf den
Gewinden, k, k, Fig. 24. sich bewegt,
darauf festgehalten wird. Dieses Raͤhmchen ist, wie die schattirten Theile in
Fig. 24.
zeigen, durchgeschlagen, so daß nur jener Theil des Papieres durchsieht, der mit
Nummer, und Datum bedrukt werden soll. Die Stereotypen fuͤr das Datum sind
auf dem messingenen Dekel, a, befestigt, und Monat und
Tag koͤnnen jedes Mahl gewechselt werden.
Um die gehoͤrige Lage fuͤr das Papier auf den Dekel zu finden, stehen
zwei sehr feine Stifte auf demselben hervor, welche in Loͤchern in dem
messingenen Dekel ihre Aufnahme finden. Ueberdieß sind zwei Puncte von der
Kupferplatte aus auf die Banknote gedrukt, die Stifte werden durch diese Puncte
durchgefuͤhrt, und dadurch Zahlen etc. auf die gehoͤrige Stelle
gebracht.
Die Art, wie diese Maschine angewendet wird, ist folgende: Man seze, die Hinterachse
sey an einem Ende so weit vorgezogen, daß alle Zahlenkreise frei von derselben,
bleiben, und diese seyen so mit der Hand gestellt, daß die Spatien oder leeren Typen
oben stehen: die Stereotypen fuͤr das gehoͤrige Datum seyen eingesezt.
Nun wird die Hinterachse so gestellt, daß ihre Raͤder, H, den ersten dieser fuͤnf Kreise rechter Hand ergreifen
koͤnnen. Wenn jezt der Griff so herabgezogen wird, daß er beinahe die
Lettern, oder die Zahlen beruͤhrt, und wieder in die Hoͤhe gehoben
wird, so treibt der Sperrkegel die Raͤder, H, und
dreht die zwei Kreise zur rechten Hand so, daß die Zahl, 1, zum Vorscheine kommt.
Der Arbeiter traͤgt nun die Schwarze mit einem Druker-Ballen auf,
oͤffnet das Raͤhmchen-Blatt, L, Fig. 24. auf
seinen Angeln, legt die bereits mit der Kupferplatte bedrukte Banknote auf den Dekel
an die durch die zwei Stifte und die zwei gedrukten Puncte bestimmte Stelle, und
schließt hierauf wieder das Raͤhmchen-Blatt, um die Banknote einzusperren,
und rein zu erhalten, und nur an den offenen (durchgeschlagenen) Stellen zu
bedruken. Null druͤkte er den Griff, F, herab,
und der Druk ist vollendet. waͤhrend er den Griff hebt, dreht er zugleich die
Kreise mit, und es kommt N. 2. herauf. Die Banknote wird
herausgenommen, eine frische eingelegt, und so wechseln die Zahlen fort bei jedem
neuen Druke. Waͤhrend dieser Arbeit wirken die beiden Kreise zu rechter Hand
als Einheiten, und ruͤken jedes Mahl nur um eine Zahl vor. Nachdem 9,
abgedrukt ist, kommt 0 herauf. Nun muß der Griff zwei Mahl nach einander bewegt
werden, ohne zu druken, wodurch ein Spatium, und endlich 1, herauf kommt; jezt wird
die Hintere Achse so bewegt, daß sie auf den zweiten Kreis zur Rechten einwirkt, der
jezt die Einheiten darbietet, waͤhrend die ersten Kreise die Zehner liefern.
Wenn nun der Griff, a, bewegt wird ohne zu druken, kommt
in dem zweiten Kreise, 1, herauf, und bildet 11, dann 12, und so fort bis 19. Der
erste Kreis wird nun mit der Hand vorwaͤrts geschoben, so daß, 2, und 0, auf dem zweiten, 20,
zum Vorscheine kommt. Der Griff wird bewegt ohne zu druken, und es kommt 21, 22
u.s.f. bis 30, u.s.f. bis 99. Nun kommt die Hinterachse auch an den dritten Kreis,
der die Einheiten gibt, waͤhrend der zweite die Zehner, der dritte die
Hunderte lieferte. 0 und Spatium wird vorgeschoben, um 1, in die Hoͤhe zu
bringen; in der zweiten wird, 0, gebracht, und die dritte, 0, bringt die Maschine
von selbst, worauf 101 kommt, und so geht es fort bis 999. Die Hinterachse wird nun
bis zum vierten Kreise gebracht, und die drei ersteren Kreise werden
noͤthigen Falles mit der Hand gestellt. Bei 9999 kommt die Hinterachse an den
fuͤnften Kreis, und so geht es fort bis 99999, uͤber welche Zahl
hinaus es nicht noͤthig ist zu druken.
Tafeln