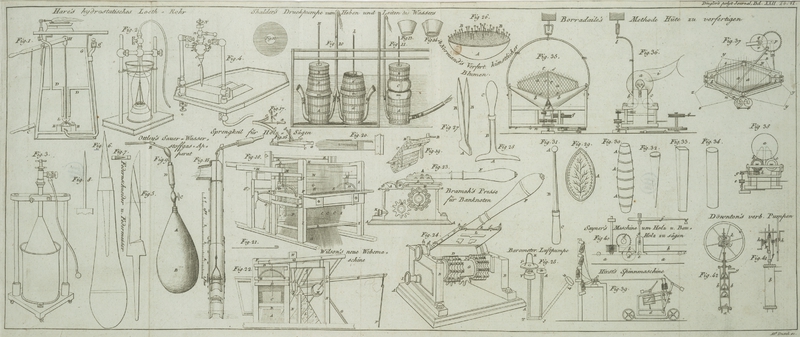| Titel: | Ueber das hydrostatische Löthrohr, wie es gegenwärtig im Laboratorium der Universität von Pennsylvania gebraucht wird, und über sich selbst füllende und stellende Behälter für Wasserstoffgas, die eben daselbst gebraucht werden. Von R. Hare, D. M. Professor der Chemie. |
| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. LIX., S. 289 |
| Download: | XML |
LIX.
Ueber das hydrostatische Loͤthrohr, wie es
gegenwaͤrtig im Laboratorium der Universitaͤt von Pennsylvania gebraucht
wird, und uͤber sich selbst fuͤllende und stellende Behaͤlter
fuͤr Wasserstoffgas, die eben daselbst gebraucht werden. Von R. Hare, D. M. Professor der
Chemie.
Aus dem Franklin Journal, March, 1826
(herausgegeben von Dr. Thom. P. Jones, Prost d. Mechanik am Franklin-Institute zu
Philadelphia) in Gill's
technical Repository. N. 55. S. 1. N. 56. S. 65.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Hare, uͤber das hydrostatische Loͤthrohr.
Folgendes ist eine Stelle aus einer Abhandlung uͤber
das Loͤthrohr, welche ich im J. 1802 herausgab.Wir lassen hier eine kleine Einleitung uͤber den Nuzen des
Loͤthrohres weg, da sie bloß Bekanntes enthaͤlt. A. d. U.
„Das Loͤthrohr muß, man mag es wozu immer verwenden wollen,
gehoͤrig mit Luft versehen, und auf eine gehoͤrige Flamme
angewendet werden: die Mittel, diese Zweke zu erreichen, scheinen indessen
bisher noch mehr oder minder mangelhaft.“
„Gewoͤhnlich blast man mit dem Munde. Abgesehen von der
Schwierigkeit, mit dem Athem lang anzuhalten, von den Nachtheilen fuͤr
die Lunge, wegen welcher mehrere Arbeiter dasselbe aufgeben mußten, ist die aus
den Lungen ausgeblasene Luft feucht, zum Theile gekohlstofft, und
verhaͤltnißmaͤßig zum Brennen unbrauchbar: an Sauerstoffgas
fuͤr die Flamme ist hier gar nicht zu denken.“
„Man gerieth auf die Idee, das Loͤthrohr mittelst doppelten
Blasebalges mit Luft zu versehen, was allerdings besser ist, als mit dem Munde
zu blasen: allein, weder das Material der Blasebalge, noch ihre Klappen, sind
luftdicht, und ein großer Theil der Luft entweicht an anderen Stellen, als wo
sie sollte: es gehen, wie ich aus Erfahrung weiß, dadurch oͤfters mehr
als 6/7 Luft verloren an uͤbrigens guten Balgen. Diese Balge
muͤssen getreten werden; man darf daher nicht von der Stelle. Ueberdieß
ist die Bewegung des Koͤrpers, selbst bei feinen Arbeiten hoͤchst
ungelegen, und veranlaͤßt Mißlingen und Fehler.
An Anwendung von Sauerstoffgas ist bei diesen Balgen nicht zu denken; in jedem
Falle wuͤrde es verunreinigt, da immer gemeine atmosphaͤrische
Luft in denselben zuruͤk bleibt.“
„Dieß veranlaßte mich zur Verfertigung folgender Maschine,“ die
jezt, so wie sie gegenwaͤrtig hier dargestellt ist, seit jener Zeit noch
vereinfacht und vervollkommnet wurde.
Erklaͤrung der Figur.
Mein hydrostatisches Loͤthrohr besteht aus einem Faͤßchen, welches
durch eine horizontale Scheidewand in zwei Faͤcher, D,
D, getheilt ist. Aus dem oberen Fache steigt eine Roͤhre von
ungefaͤhr 3 Zoll im Durchmesser in der Richtung der Achse des
Faͤßchens bis auf 6 Zoll von dem Boden hinab. Hieran ist ein hohler
hoͤlzerner Cylinder, B, B, von 12 Zoll
aͤußerem Durchmesser und 8 Zoll im Lichten, angeschraubt. Um den Ranft dieses
Cylinders wird ein Stuͤk Leder aufgenagelt, um alles luftdicht zu machen. Auf
einer Seite befindet sich eine kleine Furche in der oberen Oberflaͤche des
Blokes, so daß ein Seiten-Durchgang unter dem Leder bleibt, wenn dieses zu beiden
Seiten der Furche aufgenagelt wird. Dieser Seiten-Durchgang steht mit einem Loche in
Verbindung, das mit einem Bohrer senkrecht in das Holz eingebohrt ist, und eilt
kleiner Leder-Streif, der so gelegt ist, daß er dieses Loch bedekt, bildet mit
einigen Metall-Scheiben eine Klappe, die sich nach aufwaͤrts oͤffnet.
Im Boden des Faͤßchens befindet sich eine andere Klappe, die sich nach
aufwaͤrts oͤffnet. Eine Staͤmpelstaͤnge, die senkrecht
durch die Roͤhre laͤuft von dem Griffe, H,
aus ist in der Naͤhe ihres unteren Endes an eine hemisphaͤrische Masse
Blei, L, befestigt. Das daruͤber hinaus gelegene
Stuͤk der Stange laͤuft durch den Mittelpunct des Leders, welches die
von dem hohlen Cylinder gebildete Hoͤhlung dekt, und noch durch eine andere,
der vorigen aͤhnliche, Bleimasse, welche, durch eine Schraube und ein Niet
heraufgedruͤkt, das Leder zwischen derselben und zwischen der oberen
bleiernen Hemisphaͤre einem solchen Druke unterzieht, daß alle Verbindungen
hinlaͤnglich luftdicht werden. Von der Scheidewand laͤuft eine
Ausfuͤhrungsroͤhre unter den Tisch, wo sie mittelst einer Schraube an
einem Hahne befestigt wird, der eine Blaseroͤhre fuͤhrt, welche
mittelst eines kleinen beweglichen Gewindes so befestigt ist, daß sie nach allen
Richtungen gekehrt werden kann. Eine Saugroͤhre laͤuft von der mit der
unteren Klappe bedekten Oeffnung unter dem Boden des Faͤßchens hin, und steigt aussen, dicht daran,
senkrecht auf, wo sie sich in einen Buͤgel endet mit einer Schraube, g, damit irgend eine biegsame Roͤhre
noͤthigen Falles daran angebracht werden kann.
Wenn dieser Apparat so vorgerichtet, und das Faßchen mit Wasser gefuͤllt ist,
bis die Scheidewand ungefaͤhr 2 Zoll hoch damit bedekt wird, so wird, wenn
der Staͤmpel in die Hoͤhe gezogen wird, das Leder aufgetrieben, und
wird, zum Theile, den Druk der Atmosphaͤre von der darunter befindlichen
Hoͤhlung beseitigen; folglich muß die Luft durch die untere Klappe
eindringen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Wenn der Staͤmpel
niedergedruͤkt, und das Leder in der entgegengesezten Richtung ausgetrieben
wird, wird die untere Hoͤhlung vermindert, und die dadurch
zusammengedruͤkte Luft seitwaͤrts durch die Seitenklappe in dem
unteren Fache des Faͤßchens ausgedruͤkt. Da dieses Fach aber
vorlaͤufig mit Wasser gefuͤllt ist, wird ein Theil desselben durch die
Roͤhre in das obere Fach hinauf gedruͤkt. Dasselbe geschieht, so oft
der Stoß des Staͤmpels wiederhohlt wird, so daß das untere Fach sich bald mit
Luft fuͤllt, die durch den Hahn zuruͤkgehalten wird, bis sie durch die
Blaserohre ausstroͤmen soll.
Wenn der Hahn geoͤffnet wird, wird die in dem unteren Fache eingeschlossene
Luft durch den Druk des Wassers in dem oberen Fache ausgetrieben, welches, sobald
die Luft, die es aus diesem Fache vertrieben hat, entwichen ist, seine vorige Lage
wieder einnimmt. Der Staͤmpel wird entweder mit der Hand, oder mittelst des
Tretschaͤmels, C, getrieben.
Um das Faͤßchen mit Sauerstoffgas zu fuͤllen, darf man blos an die
Saugroͤhre mittelst des Buͤgels und der Schraube bei, g, eine andere gehoͤrig biegsame Roͤhre
anbringen, und unter eine Gloke fuͤhren, die uͤber dem pneumatischen
Apparate mit diesem Gase gefuͤllt ist. Man kann auch die Roͤhre mit
einem Sake in Verbindung bringen, der mit Sauerstoffgas gefuͤllt ist. Ich
habe einen, der 50 Gallons haͤlt. Die Saͤume sind nach Pennock- und
Seller's Methode fuͤr Landkutschen-Saͤke und
Feuerloͤsch-Schlaͤuche vernietet.
Da ich mich 25 Jahre lang dieses hydrostatischen Loͤthrohres bediene, so darf
ich wohl mit Vertrauen fuͤr die Brauchbarkeit und Bequemlichkeit desselben
sprechen. Ich bin uͤberzeugt, daß es allen Handwerkern, welche Metall
loͤthen oder Glas
blasen muͤssen (z.B. Barometer und Thermometer), und uͤberhaupt dort,
wo der Glasschmelzer seine Lampe braucht, sehr gut dienen wird.
Verbunden mit dem gleich unten zu beschreibenden sich selbst stellenden
Behaͤlter fuͤr Wasserstoffgas ist es, mit einem Strahle
atmosphaͤrischer Luft fuͤr das zusammengesezte Loͤthrohr, im
Stande Platinna zu schmelzen, und die Leichtigkeit, mit welcher hier die
Sauer-Wasserstoff-Flamme in gehoͤriger Richtung angewendet werden kann, macht
dieses Loͤthrohr fuͤr Silberund Kupfer- und Zinnarbeiter
hoͤchst brauchbar. Beim Weichschweißen ersezt es das Schweißeisen. Dieses
Loͤthrohr arbeitet ferner weit reiner, als das gemeine, und sein Umfang
laͤßt sich eben so leicht vergroͤßern, als vermindern.
Ich glaube ferner nicht, daß die dadurch erzeugte Hize theuerer kommt, als diejenige,
die man durch eine Lampe erhaͤlt.
Fig. 2. zeigt
einen Behaͤlter fuͤr reines oder geschwefeltes Wasserstoffgas, der
sich von selbst stellt, auch fuͤr Stikstoff-Oxyd oder kohlensaures Gas.Die Figur ist bereits auf Tab. III. in diesem Journale abgebildet, und auf S.
103 beschrieben, allein der Vollstaͤndigkeit des Ganzen wegen ließen
wir sie hier nochmals beisezen. A. d. R.
Die Figur ist fuͤr sich deutlich genug. Man seze das aͤussere Glas
enthalte verduͤnnte Schwefelsaͤure, die darin befindliche
umgestuͤrzte Gloke enthalte etwas Zink auf einem kupfernen Troge, der an
aͤhnlichen Drahten im Halse der Gloke aufgehaͤngt ist. Wenn nun der
Hahn geoͤffnet wird, wann die Gloke so tief hinabgelassen ist, als man sie
hier dargestellt sieht, so wird die atmosphaͤrische Luft entweichen, und die
Saͤure, die in die Gloke eintritt, wird, durch ihre Einwirkung auf den Zink,
schnell Wasserstoffgas entwikeln. Sobald aber der Hahn geschlossen ist, treibt der
Wasserstoff die Saͤure aus der Hoͤhlung der Gloke, und folglich wird
die fernere Einwirkung der Saͤure auf den Zink gehindert, bis man neuerdings
wieder etwas von dem Gase abzieht. Sobald dieß geschieht, tritt die Saͤure
wieder in die Hoͤhlung der Gloke, die Entwiklung des Wasserstoffes wird
erneuert und fortgesezt, bis sie aus obigem Grunde wieder unterbrochen wird.
Dieser Apparat dient eben so gut als ein sich selbst stellender Behaͤlter des
Schwefelwasserstoffgases, wenn man Schwefeleisen statt des Zinkes, nimmt, und als
Behaͤlter des kohlensauren Gases, wenn man Marmor und Kochsalzsaͤure
nimmt. Um salpetrichtsaures Gas auf diese Weise zu erhalten und aufzubewahren, darf
man nur statt des Kupfer-Troges und Kupfer-Drahtes einen Wikel Kupfer an
Platinna-Draht oder an einer Glasroͤhre, die unten wie ein Nagel verdikt ist,
aufhangen.
Dieser Apparat ist jenem des Hrn. Gay-Lussac aͤhnlich; ich bediente mich aber
desselben schon, als ich noch zu Williamsburgh war, um die Entwiklung des
kohlensauren Gases zu maͤßigen, ehe ich von Gay-Lussac's Apparat gelesen
hatte, und ziehe obige Vorrichtung vor, 1) weil man leichter von innen dazukommen,
und sie leichter reinigen kann; 2) weil sie besser zur Aufnahme des Schwefeleisens
und Marmors bei Erzeugung von geschwefeltem Wasserstoffe oder kohlensaurem Gase
taugt, und weil 3) bloß durch Aufhebung des Glases aller Druk beseitigt werden
kann.
An Gay-Lussac's Vorrichtung ist der Druk auf das Gas so groß, daß, wenn nicht
Roͤhre, Hahn, und ihre Verbindungen vollkommen luftdicht sind, ein
bedeutender Verlust an Material entstehen muß, indem die Entweichung des Gases
nothwendig die Verzehrung derselben veranlaßt, da die Saͤure den Zink etc.
erreicht.
Fig. 3. ist
ein anderer sich selbst stellender Behaͤlter fuͤr Wasserstoffgas, der,
wie der vorige vorgerichtet, nur fuͤnfzig Mahl groͤßer und aus Blei
statt aus Glas ist.
Dieser Behaͤlter wird mit dem oben erwaͤhnten zusammengesezten
Loͤthrohre verbunden, und liefert das Wasserstoffgas; laͤßt sich also
uͤberall anwenden, wo man haͤufig nachstroͤmendes
Wasserstoffgas braucht. Wenn er mit dem gleich unten zu beschreibenden
Sauer-Wasserstoffgas-Loͤthrohre verbunden werden soll, wird die Kugel am Ende
der Roͤhre, welche eine Oeffnung an einer Seite derselben hat, in das
Gestell, g, gebracht, und luftdicht mit der
Roͤhre dieses Instrumentes, mittelst einer Schraube, verbunden.
Beschreibung eines anderen zusammengesezten
Loͤthrohres.
Fig. 4. stellt
ein anderes zusammengeseztes Loͤthrohr dar, welches ich vor ungefaͤhr
11 Jahren ausdachte, und selbst verfertigte; da ich aber fuͤrchtete, man
moͤchte es fuͤr zu sehr zusammengesezt halten, so habe ich es bisher
nicht bekannt gemacht. Die Erfahrung lehrte mich indessen, daß es ungeachtet dieses
Mangels sich eben so gut brauchen laͤßt, als das einfachste Instrument dieser
Art, und daß seine einzelnen Theile sich sehr gut stellen lassen.
B, ist eine messingene Kugel, oben mit einer
maͤnnlichen, unten mit einer weiblichen Schraube versehen. Diese Kugel ist
von einer Schraube zur anderen senkrecht durchbohrt, und unter rechten Winkeln auf
diesen Canal ist sie noch ein Mahl durchbohrt, und steht dadurch in Verbindung mit
der Roͤhre, welche unter einem rechten Winkel in sie eintritt. Eine
aͤhnliche, aber kleinere, messingene Kugel ist oben auf derselben sichtbar,
die auf eine aͤhnliche Weise durchbohrt ist, und in welche eine Roͤhre
auf dieselbe Weise von der Seite eintritt. Diese Kugel endet sich oben und unten in
eine maͤnnliche Schraube, und der Faden der unteren maͤnnlichen
Schraube laͤuft links, waͤhrend jener der Schraube der
groͤßeren Kugel, die in dasselbe Niet, n,
einlauft, wie gewoͤhnlich rechts gewunden ist. Daher kann dieselbe Bewegung
die maͤnnlichen Schrauben einander naͤher bringen oder von einander
entfernen, und den Grad von Druk bestimmen, der einem dazwischen gelegenen
Stuͤke Kork mitgetheilt wird. Oben auf der Kugel wird man eine kleine
Schraube mit einem kleinen geraͤndelten Rande bemerken. In Verbindung damit
sieht eine kleine Roͤhre, die durch einen Kork in dem Niete laͤuft,
und beinahe bis an die aͤußere Oeffnung reicht, aus welcher die Flamme als
ausstroͤmend dargestellt wird. Diese Roͤhre ist großen Theils aus
Messing, an ihrem unteren Ende aber aus Platinna. In die weibliche Schraube der
groͤßeren Kugel wird ein hohler messingener Cylinder, c, mit einer correspondirenden maͤnnlichen Schraube eingepaßt. Die
Hoͤhlung in diesem Cylinder bildet eine Fortsezung derjenigen in der Kugel,
verschmaͤlert sich aber nach unten, und endet sich in einen kleinen hohlen
Cylinder aus Platinna, welcher die aͤußere Muͤndung der Blaserohre,
o, bildet.
Die Schrauben s, s, s, s, dienen die Roͤhre,
welche von der Hoͤhlung der kleineren Kugel auslaͤuft, in der Achse
der groͤßeren zu erhalten. Das Zwischenniet, welches den Kork, der die
Roͤhre umgibt, um die Roͤhre zusammendrukt, sperrt alle Verbindung
zwischen den Hoͤhlungen der beiden Kugeln. Durch die Schraube, N, im Scheitel kann die Muͤndung der
Central-Roͤhre in
gehoͤrige Entfernung von der aͤußeren Muͤndung gebracht werden.
Drei verschiedene Cylinder und eben so viele Central-Roͤhren mit
Muͤndungen von Platinna und von verschiedener Weite sind vorraͤthig,
so daß die Flamme nach Bedarf vergroͤßert werden kann.
Ich fand es immer am besten, das Sauerstoffgas durch die in der Achse befindliche
Roͤhre durchstroͤmen zu lassen, indem, da zwei Volumen Wasserstoff auf
Ein Volumen Sauerstoff nothwendig sind, die weitere Roͤhre fuͤr den
ersteren gebraucht werden muß. Der Strahl von Wasserstoff kommt zwischen den Strahl
von Sauerstoff innerhalb und der atmosphaͤrischen Luft außen.
Unter dem Tische befindet sich ein Gestell, G, mit einer
Schraube, woran man eine Roͤhre anbringt, die Wasserstoffgas aus dem
Behaͤlter herbeifuͤhrt.
Tafeln