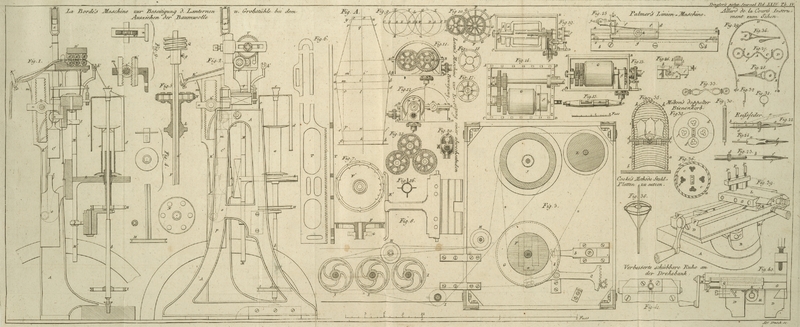| Titel: | Beschreibung eines verbesserten Schiebers zur Linier-Maschine der Kupferstecher. Von Hrn. W. Palmer, Clifton-Street, Finsbury, N. 18. |
| Fundstelle: | Band 24, Jahrgang 1827, Nr. XXVI., S. 125 |
| Download: | XML |
XXVI.
Beschreibung eines verbesserten Schiebers zur
Linier-Maschine der Kupferstecher. Von Hrn. W. Palmer, Clifton-Street, Finsbury, N.
18.
Aus den XLIV. B. der Transactions of the Society of Arts
etc. im Repertory of Patent Inventions. Maͤrz
1827. S. 152.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Palmer's, Beschreibung eines verbesserten Schiebers
etc.
Die Linier-Maschine ist fuͤr die Kupferstecher,
was die Dampfmaschine fuͤr die Fabrikanten ist. Ich habe an dem Theile dieser
Maschine, den man den Schieber und den Wagen nennt, eine Verbesserung angebracht,
wodurch diese Maschine dauerhafter, leichter zu fuͤhren, und einfacher und
wohlfeiler wird, als alle andere aͤhnliche Maschinen.
Die Genauigkeit und Sicherheit der jezt gebraͤuchlichen Maschinen dieser Art
haͤngt von Federn ab, und die Leichtigkeit in der Anwendung derselben von
Reibungswalzen: Vorrichtungen, die dort, wo es sich um eine staͤtige,
regelmaͤßige und gleichfoͤrmige, Bewegung als unerlaͤßliche
Bedingung handelt, sehr mangelhaft sind. Die Federn leiden mehr oder minder durch
die Temperatur, und lassen haͤufig nach, wenn ein anhaltender Druk lang auf
sie wirkt, und Reibungswalzen werden, wenn sie lang gebraucht werden, haͤufig
die Quelle von Fehlern. Ich wollte diese Maͤngel beseitigen, und die Maschine
so einfach machen, als moͤglich: ich wollte die Lagerung derselben
natuͤrlich machen, und so einrichten, daß sie durch ihre eigene Wirkung in
Ordnung gehalten wird. Die HHrn. Turrell, Bacon, Lowey
haben meinem Schieber ihren Beifall geschenkt; er diente ihnen so gut, wie mir.
Der Grundsaz, nach welchem mein Schieber vorgerichtet ist, ist den eines Hebelwerkes.
Der Wagen schiebt sich auf einer Flaͤche von Gußeisen, v, welche den verlaͤngerten Mittelpunct der Bewegung desselben
bildet. Zur Linken befindet sich ein kleines hervorstehendes Stuͤk Messing,
welches an dem Wagen befestigt ist, und gegen eine uͤberhaͤngende
gerade Kante mittelst des Gewichtes an der gegenuͤberstehenden Seite aufrecht
erhalten wird, welches Gewicht als ein Hebel wirkt, und jede Ungenauigkeit
verbessert und ausgleicht, die durch Reibung und haͤufigen Gebrauch entstehen
koͤnnte. Mittelst dieses Schiebers koͤnnen Linien von verschiedener Laͤnge
linirt werden, und obschon anhaltender Gebrauch die gerade Kante etwas verdirbt,
wird die dadurch entstehende Unvollkommenheit kaum merklich: denn so, wie man eine
Platte anfaͤngt, muß man sie enden, da das Hebelwerk immer dasselbe, und das
Lager immer gleichfoͤrmig ist.
Der Preis eines solchen Schiebers von 36 Zoll Laͤnge nach alter Art ist 20
Pfd. Sterl.; ich verfertige einen eben so langen nach meiner verbesserten Methode
gern fuͤr 7 bis 8 Pfd.
Fig. 25.
zeigt diesen Schieber von oben; Fig. 26. vom Ende her
gesehen.
a, a, die Linier-Stange, die ekig ist, wie die
Vorderstange an vielen eisernen Drehebaͤnken. Eine starke eiserne Schiene,
b, b, mit einer geraden Unterflaͤche
laͤngs c, c, ist auf dem eisernen Lager, d, aufgeschraubt, welches ein Stuͤk mit der
Stange, a, ist, und so gestellt, daß sie vollkommen
parallel mit der ekigen Oberflaͤche, a, a,
ist.
d, d, ist der Wagen oder Schlitten. Er ist an der
unteren Seite, uͤber der Stange, a, a, hohl
gegossen, wie das punctirte Parallelogramm zwischen e
und e, Fig. 25. zeigt, so daß
nur die beiden Enden, e und e, die Stange beruͤhren, die so ausgeschnitten sind, daß sie genau
an dieselbe passen, und sich frei an derselben schieben.
In der End-Ansicht zeigen die punctirten Linien unter e, die Hoͤhlung.
Eine andere Hoͤhlung, f, f, kann, wenn man will,
auch gegossen, und mit Blei ausgefuͤllt werden, wodurch das
uͤberhaͤngende Gewicht vermehrt wird. Ein Stuͤk, g, springt aus der Mitte des Schlittens vor, und ist
oben flach, so daß es unter der Flaͤche, c, c,
der Stange, b, hingleiten kann. Auf diese Weise
erhaͤlt der Schlitten drei Lager: das eine, g,
oben, die beiden anderen, e, e, unten; die beschwerte
Seite, f, f, haͤlt das Lager, g, immer in Beruͤhrung mit der unteren
Flaͤche von, c, c, auf welcher er sich
hinschiebt.
h, Fig. 25. ist der
Schwingarm.
i, i, sind seine beiden Mittelpuncte, und, j, ist die Spize des Griffels.
k, ist ein Rollknopf, wodurch der Schlitten
laͤngs der Stange hingeschoben werden kann. Wenn er gedreht wird, hebt die
Schnur, b, die Spize des Griffels so, daß dieselbe zu
der naͤchsten
Linie an das Lineal zuruͤkgefuͤhrt werden kann. Ein Stift, m, hindert den Schlitten an einem Ende abzuweichen, und
eine Schraube, n, die angezogen wird, nachdem der Magen
oder Schlitten an seinen Plaz geschoben wurde, hindert denselben vor Abweichungen an
dem anderen Ende.
o, o, sind zwei Loͤcher, mittelst welcher er zum
Gebrauche an seiner Stelle aufgeschraubt wird. Dieser Schlitten kann weder durch
Zufall verschoben, noch so schief gehoben werden, daß die Platte dadurch
beschaͤdigt wuͤrde, indem er bei dem Gebrauche so tief niedersteigt,
als es moͤglich ist, und ohne Ausziehung der Schraube, n, nicht von der Stelle gebracht werden kann.
Da die Oberflaͤchen der Kupferplatten noch immer nicht vollkommene
Flaͤchen sind, und also mit der Linier-Stange vielleicht nicht
vollkommen parallel seyn koͤnnen, so muͤssen die Mittelpuncte der
Schwingung, i, i, genau rechte Winkel mit der
Linier-Stange, a, a, bilden, und horizontal oder
parallel mit der Kupferplatte seyn: dann werden die geringen Abweichungen in der
Oberflaͤche des Kupfers keinen bedeutenden Unterschied in der Entfernung der
Linien bilden. Wenn aber die Mittelpuncte, i, i, nicht
unter rechten Winkeln stehen, wird jede Ungleichheit in der Platte einen
verhaͤltnißmaͤßigen Unterschied in der Entfernung oder Geradheit der
Linien bilden.
Tafeln