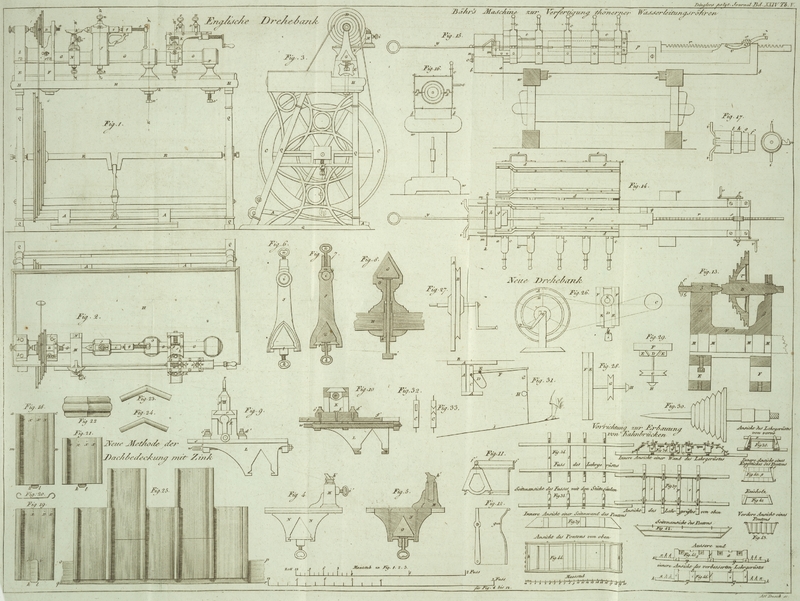| Titel: | Beschreibung einer englischen Drehebank. Von dem geheimen Ober-Finanzrath Beuth. |
| Fundstelle: | Band 24, Jahrgang 1827, Nr. XLIII., S. 214 |
| Download: | XML |
XLIII.
Beschreibung einer englischen Drehebank. Von dem
geheimen Ober-Finanzrath Beuth.
Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des
Gewerbfleißes in Preußen. Fuͤnfter Jahrgang S.
271.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Beuth's, Beschreibung einer englischen Drehebank.
Bei einiger Bekanntschaft mit England findet man, daß jeder
Mechaniker seinen Arbeiten eine Eigenthuͤmlichkeit zu geben sucht, von
welcher sich nicht gerade immer behaupten laͤßt, daß sie zugleich eine
Verbesserung sei. So sieht man z. V. einer Drehebank gleich an, ob sie von den
bekanntesten Mechanikern in Manchester, Glasgow, Leeds, Derby, oder in London gebaut
worden ist. Maudslay, in London, bedient sich eines
Prismas statt der gewoͤhnlichen zwei Wangen, selbst bei den groͤßten
und schwersten Arbeiten, und hat eine Menge sehr sinnreicher Vorrichtungen daran
angebracht, um, ohne eine lange Schraubenspindel zur Bewegung der mechanischen
Vorlage, an jedem beliebigen Punkte der Drehebank Schrauben, schneiden zu
koͤnnen, oder um Raͤder auf der Drehebank zu theilen und zu
schneiden.
Die kleine Drehebank, deren Beschreibung wir hier liefern, ist in London nach Maudslay'scher Art von Rich
gebaut, und seit fuͤnf Jahren in der Werkstaͤtte der Koͤniglich
technischen Deputation fuͤr Gewerbe in Berlin in taͤglichem Gange. Sie
ist fuͤr den gewoͤhnlichen Gebrauch mit einer mechanischen Vorlage
versehen, und hat die oben erwaͤhnten besonderen Vorrichtungen nicht, welche
sich an einem aͤhnlichen kleinen Drehestuhle der Werkstaͤtte
angebracht finden.
Fig. 1. zeigt
die vordere Ansicht;
Fig. 2. den
Grundriß;
Fig. 3. die
Seitenansicht;
Fig. 4. die
Seitenansicht der Vorlage;
Fig. 5. den
Durchschnitt der Vorlage nach der Linie A' B';
Fig. 6. die
Seitenansicht der Spindeldoke, 1;
Fig. 7. den
Durchschnitt derselben nach der Linie, C'D';
Fig. 8. den
Durchschnitt des Staͤnders, O, nach der Linie,
E'F';
Fig. 9. die
Seitenansicht der mechanischen Vorlage;
Fig. 10. den
Durchschnitt derselben nach der Linie, G'H';
Fig. 11.
einen Zeiger zur Vorlage gehoͤrig;
Fig. 12. eine
Stahlfeder und Stift zum Gebrauche bei Kreiseintheilungen. Endlich liefert
Fig. 13. zur
Engaͤnzung einen Langendurchschnitt der Spindel und ihrer Doken.
Dieselben Theile sind auf der Kupfertafel uͤberall mit denselben Buchstaben
bezeichnet. Die ganze Drehebank besteht aus Gußeisen, Schmiedeeisen, Stahl, Rothguß
und Messing, mit Ausnahme des Tritts und der Tischplatte, worauf sie steht; wo das
Metall in der Beschreibung nicht genannt ist, besteht es aus Gußeisen.
Durch den hoͤlzernen Tritt, A, wird die Welle, R, von Schmiede-Eisen, das darauf befestigte
Schwungrad, C, und vermoͤge einer Schnur die
messingene Spindelscheibe, D, so wie die Stahlspindel,
B, mit dem Spindelkopfe, a, in Bewegung gesezt. Der Spindelkopf hat verschiedene, nicht
abgebildete, Futter, und will man zwischen zwei Spizen drehen, so wird ein Futter
von Rothguß, mit einer konisch eingeschobenen Stahlspize, aufgeschraubt. Durch das
Futter geht ein Haken, welcher willkuͤhrlich durch eine Schraube festgestellt
werden kann, und dazu dient, das auf dem abzudrehenden Stuͤke festgespannte
Herz herumzuwerfen und so das Stuͤk zu drehen. Das Schwungrad, C, ist sehr duͤnn gegossen, und so eingerichtet,
daß die Gaͤnge (Nuthen) desselben zu denen der Spindelscheibe in umgekehrtem
Verhaͤltnisse stehen, so daß dieselbe Schnur auf alle Gaͤnge paßt,
mithin die groͤßte und die geringste Geschwindigkeit hervorgebracht werden
kann, ohne sie zu verlaͤngern, oder zu verkuͤrzen, je nachdem die
Schnur auf den kleinsten Durchmesser der Spindelscheibe, und den groͤßten des
Schwungrades gebracht wird, oder umgekehrt. Dieses ist indeß nur von dem in Fig. 3. mit,
C, bezeichneten Kranze zu verstehen, indem der
innere kleine, mit keinem Buchstaben bezeichnete, Schwungring fuͤr den
langsamsten Gang einer eigenen kuͤrzeren Schnur bedarf.
Die Spindelscheibe ist zwar hohl ausgedreht (r, Fig. 13), hat
aber nach dem Spindelkopfe zu eine eingesprengte Messingscheibe mit koncentrischen
Kreisen und verschiedenen Eintheilungen derselben, nach den Grundsaͤzen,
welche bei Theilscheiben Anwendung finden; die Theilung ist, wie bei diesen, mit
Punkten versehen. Bei
dem Gebrauche der Theilung, sei es nun zum Raͤderschneiden, Kanelliren etc.
wird in dem Einschnitte, f, eines kleinen
hervorstehenden eisernen Kopfes die Feder, Fig. 12., vertikal
eingestekt, und mit einem Bolzen befestigt; der Stift, g, Fig.
12. paßt in die Punkte der Theilung der Scheibe, und bringt so die Spindel
mit dem daran befestigten Stuͤke zum Feststehen.
Die glasharte Stahlspindel, B, laͤuft in einem
gleichfalls glasharten in die Spindeldoke, β,
eingesprengten staͤhlernen Ringe, der an beiden Seiten der Doke etwas
hervortritt. Die Spindel hat einen geringen Anlauf gegen den Ring, der ihren Gang
erleichtert, da bloß konische Spindeln sich in den Ring einklemmen und schwer gehen
wuͤrden. Der Durchschnitt, Fig. 13., zeigt das in
der Ansicht, Fig.
2., mit, h, bezeichnete gebohrte Loch, wodurch
Oehl eingegossen, und welches mit einem Metallstoͤpsel verschlossen wird.
Das Spindelgestell besteht aus drei Hauptstuͤken, naͤmlich aus zwei
Unterlagen, E, F, Fig. 1. und 13., welche
die Spindeldoken tragen, und drittens aus einem Obertheile aus Einem Stuͤke,
den beiden Spindeldoken, α, β, und ihrer
Verbindung, γ. Zwei große Schrauben ziehen die
beiden Unterlagen, E, F, an die starke Bohle von
Mahagony, H, welche die Drehebrank traͤgt. Das
Prisma, G, welches die Wangen einer gewoͤhnlichen
Drehebank vertritt, laͤuft durch die beiden Spindeldoken und ihre Verbindung;
es ist genau eingeschliffen, und, um das Einschleifen zu erleichtern,
beruͤhrt das Spindelgestell das Dreiek nicht in einer
zusammenhaͤngenden Flaͤche, sondern nur an den in Fig. 13. mit, M, M, bezeichneten Stellen, welche an den beiden inneren
aufrechtstehenden Waͤnden hervortreten. Die kleinen Schrauben, b, c,
Fig. 1.,
dienen dazu, das Spindelgestell auf den Unterlagen zu befestigen. Die große
Schraube, m', Fig. 3., welche der
Durchschnitt gleichfalls darstellt, dient dazu, das Prisma gegen die Waͤnde
des Spindelgestells zu schrauben. Sie druͤkt nicht unmittelbar gegen das
Prisma, sondern gegen eine kleine Eisenscheibe, welche lose in einer Versenkung des
Untergestells, E, eingelassen ist. – Die Spize,
worin die Spindel, B, hinten laͤuft, befindet
sich am Ende eines, in der Spindeldoke eingeschliffenen, Cylinders, δ, der an beiden Enden, wo er vor der Doke
vorsteht, Gewinde hat, und mit der Mutter und Gegenmutter, ε, und, ζ, gestellt wird.
Das Prisma, G, wird, außer den bereits erwaͤhnten
Unterlagen, E, und, F, noch
von den Staͤndern, O, und, P, getragen, und auf der Bohle, H, so
befestigt, wie es der Durchschnitt Fig. 8. angibt. Das Loch
in der Bohle ist nicht rund, sondern laͤnglich, um noͤthigenfalls die
Staͤnder etwas verruͤken zu koͤnnen. Unmittelbar unter der
Bohle liegt eine große starke Scheibe von Gußeisen, welche den Durchmesser der
Staͤnder hat und abgedreht ist, so daß sie mit einer vollkommenen
Flaͤche gegen die Bohle anliegt. Die Schraube, k', welche ihre Mutter in dem Staͤnder hat, zieht diesen gegen die
Bohle, H, an. Die Schraube, n', geht durch die Schraube, k', und
druͤkt eine Zwischenscheibe gegen das Prisma und lezteres gegen die
Waͤnde des Standers, womit das Dreiek genau eingeschliffen ist. Dieselbe
Einrichtung ist Fig.
1. an dem Staͤnder, P', mit l', und, o' bezeichnet. Die
Doke, I, fuͤr die Gegenspize ist auf folgende
Weise eingerichtet, um mit Leichtigkeit von dem Prisma abgehoben und versezt, auch
befestigt zu werden. Der Schieber, e, Fig. 6. und 7., welcher so
lang, als die Doke breit ist, wird unter der Grundlinie des Prismas in zwei
spizwinkliche Nuthen der Doken geschoben, worin er eingeschliffen ist, und dann
durch die Schraube, k, angezogen, welche gegen eine
kleine, in den Schieber eingesenkte, Scheibe druͤkt. Man darf daher nur die
Schraube luͤften und den Schieber herausziehen, um die Doke leicht abheben zu
koͤnnen; aber so laͤßt sie sich leicht auf dem Prisma hin und her
schieben, nachdem die Schraube geluͤftet worden. Die Gegenspize befindet sich
am Ende des staͤhlernen Cylinders, i, i, welcher
durch die Doke geht und luftdicht darin eingeschliffen ist. Die Schraube, n, welche das Verschieben des Cylinders verhindert,
beruͤhrt denselben nicht unmittelbar, sondern das Stuͤk Eisen, m, welches, wie Fig. 1. zeigt, von vorne
eingeschoben wird, und worauf der Cylinder mit eingeschliffen worden, so daß es
genau darauf paßt. (Fig. 7.) Das Vorschieben der Spize und deren Stellung geschieht durch die
Schraube, o, (mit flachem Gewinde), deren Mutter, q, von der Unterlage p,
getragen wird, und mit ihr aus einem Stuͤke Rothguß besteht, welches an die
Doke, I, angepaßt und mit Schrauben befestigt ist.
Die gewoͤhnliche Vorlage zum Drehen aus freier Hand, N,
M, hat eine sinnreiche Vorrichtung, die es moͤglich macht, sie durch
dieselbe Umdrehung einer unten befindlichen Schraube nicht bloß auf dem Prisma in
derselben Art zu befestigen, welche vorher bei der Doke erlaͤutert worden,
sondern auch die Vorlage in jeder Entfernung von dem Prisma festzustellen, worin sie
vor- oder zuruͤkgeschoben worden. Die beiden Bahnen von Rothguß, worin
der Schieber (Schlitten) der Vorlage von beiden Seiten laͤuft, sind
naͤmlich nicht auf gewoͤhnliche Weise, mit Schrauben und
laͤnglich runden Loͤchern zum Nachstellen, auf der Unterlage, N, Fig. 5. befestigt, sondern
es gehen vielmehr zwei Bolzen senkrecht durch jede Bahn, und durch die Unterlage,
welche oben einen versenkten konischen Schraubenkopf haben, unten aber im
Stuͤke eingeschraubt werden, welches an beiden Seiten neben, N, laͤuft. Diese beiden Bolzen an jeder Seite
werden so angezogen, daß der Schieber oder Schlitten, der Vorlage sich darin willig
und gleichfoͤrmig zwischen den spizwinklichen Bahnen bewegt. Aus der Fig. 5. ist
ferner zu ersehen, daß die Bahnen, worin der kleine Einsazschieber mit der Schraube
laͤuft, welcher die Vorlage auf dem Prisma befestigt, nicht in dem
Hauptstuͤke, N, (von Rothguß) liegen, sondern in
den vorhergedachten Stuͤken, worin die Bolzen-Enden eingeschraubt
sind. Wird daher die untere Schraube angezogen und druͤkt gegen das Prisma,
so entsteht gleichzeitig ein Druk der unteren Flaͤche des Schiebers, welcher
die Mutter dieser Schraube enthaͤlt, gegen die beiden Bahnen, in denen er
laͤuft; die beiden Bolzen an jeder Seite werden heruntergezogen, ebenso die
beiden oberen Bahnen der Vorlage, vermoͤge des versenkten Kopfes der Bolzen,
so daß der Schlitten der Vorlage, der sich zwischen ihnen bewegt, in jeder Lage
festgehalten wird, welche man ihm gegeben hat. M, ist
ein Cylinder von Rothguß, der eine gewoͤhnliche englische Vorlage, h', enthaͤlt, eingeschliffen ist, und durch die
Schraube, i', in der gewoͤhnlichen Lage erhalten
wird.
Die mechanische Vorlage ist ein nothwendiges Erforderniß einer guten Dreherei, und
leider bei uns zu wenig gekannt und verbreitet. Das Drehwerkzeug wird hier nicht mit
der freien Hand, sondern durch eine Schraube (Leitspindel) parallel, oder in dem
erforderlichen Winkel gefuͤhrt, sowohl laͤngs dem abzudrehenden
Stuͤke, als gegen dasselbe. Gleichen Nuzen gewaͤhrt eine solche
Vorrichtung bei dem Ausdrehen, Bohren, Ineinanderpassen von Gegenstaͤnden
etc. Es ist einleuchtend, daß, wenn man z.B. einen Kegel mit einer solchen Vorlage
abdreht, derselbe genau
in einen zweiten passen muß, der unter demselben Winkel und bei gleicher Entfernung
des Werkzeuges von der Achse des abzudrehenden Stuͤkes ausgedreht worden.
Eben so kann bei Kanellirungen, beim Bohren von einer solchen Vorlage
zwekmaͤßiger Gebrauch gemacht werden, wenn man damit die oben beschriebene
Theilungs-Vorrichtung verbindet, indem man, nachdem das Stuͤk durch
die Theilung der Spindelscheibe eingetheilt und durch die Feder Fig. 12. festgehalten
worden, entweder mit einem feststehenden Werkzeuge laͤngs demselben
hinfaͤhrt, oder aber einen Bohrer statt des Dreheisens anbringt, der sich um
seine Achse bewegt. Hieruͤber, so wie uͤber das Raderschneiden auf der
Drehebank, bei einer anderen Gelegenheit mehr.
L, ist die Unterlage der Vorlage von Rothguß, welche
sich auf dem Prisma verschieben und ebenso befestigen laͤßt, wie bei der Doke
beschrieben ist. Die Leitspindel, W, welche vorne
kreuzweise eingeschnitten ist, um eine Kurbel darauf zu steken, welche in der
Zeichnung weggelassen worden, sezt den Schlitten von Gußeisen, ς, vermoͤge der Mutter in Bewegung, welche
damit verbunden ist, und der zwischen zwei Bahnen von Rothguß laͤuft, welche
mit Schrauben auf der Unterlage befestigt sind, die durch laͤnglichrunde
Oeffnungen gehen, um das Nachstellen der Bahnen moͤglich zu machen. (Fig. 2.) Ein
Hin- oder Herdrehen der Leitspindel entfernt den Schlitten von dem Prisma,
oder dem abzudrehenden Stuͤke. Auf dem Schlitten ist ein Aufsaz, K, befestigt, der aus zwei Haupttheilen besteht, deren
oberer eine Vorlage, wie die untere ist,Die oberen Bahnen haben jede nicht nur drei senkrechte Schrauben, wie die
unteren, mit versenkten flachen Koͤpfen in laͤnglichrunden
Loͤchern, sondern ausserdem an jeder Seite drei Schrauben mit
versenkten Koͤpfen, welche zum Theil in die Unterlage, zum Theil in
die Bahnen eingelassen sind. auf deren Schlitten das Werkzeug befestigt, und hin und her bewegt werden
kann, der andere untere Haupttheil aber dazu dient, der Vorlage die noͤthige
Hoͤhe zu geben, und sie in einem Winkel gegen das abzudrehende Stuͤk
zu stellen. Dieser untere Haupttheil, oder Sattel, bewegt sich um die Schraube, b', Fig. 10., als um seine
Achse, und ruht, wie Fig. 2. ergibt, mit zwei Kreisstuͤken, auf dem Schlitten, ς, und seinen Bahnen. Die Schrauben, c', d', Fig. 9. und 10. (in Fig. 2. von
oben) dienen dazu, den Sattel auf den Schlitten fest anzuziehen, nachdem ihm die
erforderliche Richtung gegeben worden. Um leztere genau zu bestimmen, befindet sich
auf dem Schlitten ein Gradbogen von 20 Graden, g'. (Fig. 2. und
10.) Ein
Zeiger von Eisenblech, Fig. 11., wird auf den
Schlitten gelegt, mit den beiden Spizen, e', e', in zwei
korrespondirende Loͤcher des Oberstuͤks, K, eingeschoben; die Spize des Zeigers, in welcher sich ein gerissener Radius
befindet, trifft mit diesem auf den Gradbogen, und bestimmt den Winkel, unter
welchem gedreht werden soll. Oben auf dem gußeisernen Schlitten, r, sind die zwei kreuzweise durchschnittenen
Stuͤke, x, und y, von
Rothguß befindlich, durch welche die Drehestaͤhle in die Laͤnge oder
in die Quere durchgestekt werden koͤnnen, je nachdem man Cylinder oder
Flaͤchen abdrehen will, und sich durch die Schrauben, t, u, befestigen lassen.
Die Platte, H, wird von dem gußeisernen Gestelle, Q, getragen. Die Pfannenlager der Welle, R, koͤnnen durch die Schraube, p', und eine andere an der entgegengesezten Wand des
Gestelles gehoben und gesenkt werden.
Tafeln