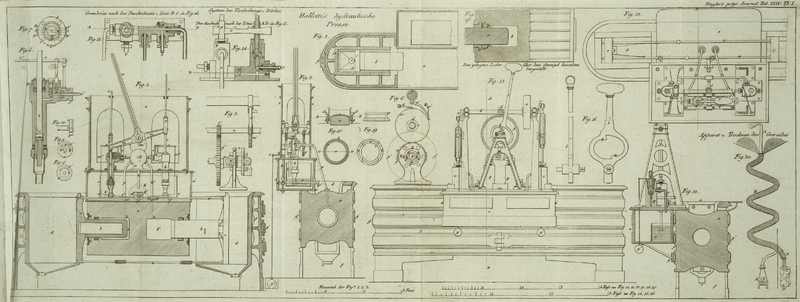| Titel: | Hydraulische Presse nach neuer Art mit doppelter Wirkung und ununterbrochener Bewegung. Erbaut von Hrn. Hallette, Mechaniker zu Arras, (Dptt. Pasde-Calais), und eingeführt auf vielen Oehl-Mühlen. |
| Fundstelle: | Band 24, Jahrgang 1827, Nr. CVI., S. 473 |
| Download: | XML |
CVI.
Hydraulische Presse nach neuer Art mit doppelter
Wirkung und ununterbrochener Bewegung. Erbaut von Hrn. Hallette, Mechaniker zu Arras, (Dptt. Pasde-Calais), und eingefuͤhrt auf
vielen Oehl-Muͤhlen.Hr. Hallette erhielt
den Preis der Sociétè d'Encouragement
fuͤr Anwendung der hydraulischen Presse zum Oehl- und
Wein-Pressen. Diese Beschreibung ist nach dem Berichte des Hrn. Garnier zu
Arras. A. d. O. (Man vergl. hiermit auch polyt.
Journal Bd. I. S. 1. Bd. XXIV. S. 282. A. d. R.)
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement. N. 272. S. 33.
Mit Abbildungen auf Tab.
X.
Hallette's, hydraulische Presse nach neuer Art mit doppelter
Wirkung und ununterbrochener Bewegung.
Die Presse des Hrn. Hallette besteht aus zwei Haupttheilen: einem oberen, in welchem
sich die Pumpen und Haͤhne zur Bewegung des Wassers befinden, welches die
Maschine in Gang bringt; und einem unteren, welcher die walzenfoͤrmigen
Staͤmpel enthaͤlt, die die Samen pressen, welche sich in Saͤken
befinden, die senkrecht in die Kisten gestellt werden. Der erstere dieser Theile ist
ziemlich zusammengesezt, und fordert eine ausfuͤhrliche Beschreibung, wenn
man seine Einrichtung gehoͤrig begreifen will.
Ein Stuͤk Eisen, n, m, m, in Form eines
Wagebalkens, Fig.
2, 3., welches man an seinem Ende, n, an was immer
fuͤr einer Triebkraft anbringt, steht mit einem kleinen. Parallelogramme, g, in Verbindung, welches die Stangen der beiden Pumpen,
o, o, in senkrechter Richtung hebt.
Diese Pumpen bestehen aus einem Cylinder, h, in welchem
der Staͤmpel, l, spielt, aus der Klappe, n', Fig. 4., die sich von
unten nach oben oͤffnet, und aus einem Stuͤke, f, q, welches zwei Klappen, i, p,
fuͤhrt, und mit einer Roͤhre, i', versehen
ist, die sich in einem Hahne, o', Fig. 3. endet, den wir
weiter unten beschreiben werden.
Das untere Ende dieser Pumpen, das sich in einem Sprizknopf endet, senkt sich in
einen Sumpf, s, s, der zum Theile mit Wasser
gefuͤllt, und in einen Kasten, a', a', eingesezt
ist.
Der Wagebalken, n, m, m, dreht sich, mittelst eines in
b', Fig. 2. angebrachten
Schluͤssels, auf einer horizontalen Achse, die sich auf zwei Lagern bewegt,
welche auf den Waͤnden, t, des Gestelles aus
Gußeisen befestigt sind. Diese Achse ist mit einem Fange oder sogenannten
Wolfszahne, r', Fig. 3 und 6. befestigt, der bei
jedem Schlage des Wagebalkens ein Sperrrad, m', auf der
Achse, v, treibt, welche einen Triebstok, t', fuͤhrt, der in ein Zahnrad, g', eingreift. Dieses Rad theilt die Bewegung dem
kupfernen Hahne, o', Fig. 5. mit, welcher
abwechselnd das Wasser hinter den Staͤmpeln der Presse in die beiden
Koͤrper der Pumpe laufen laͤßt, b''',
d''', Fig.
2. Dieser Hahn besteht aus 3 Stuͤken, a,
b, Fig.
6. e, f, Fig. 7., und, e', f', Fig. 8 und 9.
Das erste Stuͤk, a, b, welches auf der
Buͤhne, y, y, Figur 2. wohl befestigt
ist, fuͤhrt drei cylindrische Theile, g, n, g, n,
Fig. 6.,
und, o, p, Fig. 5. Lezteres ist mit
einem Loche, q, versehen, welches an die Platte, s, b, stoͤßt, auf welcher ein Stuͤk, o, h, Fig. 6. befestigt ist. In
diesem Stuͤke sind zwei halbkreisfoͤrmige Furchen, k, k, die durch die vollen Theile, l, l, getrennt werden, und in deren Grunde sich zwei
Loͤcher, x, x, befinden, die mit den Oeffnungen,
k', k', correspondiren: die Gemeinschaft wird
mittelst eines gekruͤmmten Ganges, der durch das Innere der Stuͤke,
g, n, g, n, durchgebohrt ist, hergestellt.
Der staͤhlerne Staͤmpel, den man in Fig. 9 und 10. von vorne und von der
Seite sieht, besteht aus einer runden Stange, z, und aus
einer kreisfoͤrmigen Platte, z'. Auf der
Flaͤche, z, i, sieht man zwei Loͤcher, d, d'; ersteres correspondirt mit der Oeffnung, u', mittelst des Ganges, d,
u', der durch die Dike der Platte, z',
durchgegraben ist. Das andere, d', stoͤßt an die
Furche, l', nachdem es einen Theil der Dike des
Staͤmpels durchlaufen hat. Auch die Oeffnung, u',
laͤuft nur durch einen Theil des Staͤmpels.
Das zweite Stuͤk des Hahnes, e, f, Fig. 7. besteht
gleichfalls aus drei cylindrischen Stuͤken, p', q',
p', q', und, r'. Die beiden ersteren werden von
einem Canale, t, t, durchbohrt, welcher mit einem Loche,
t'', Fig. 6, in Verbindung
steht; dem dritten, r', ist ein senkrechter Durchgang,
x', der sich in, v', im
Grunde der Furche, v', u, u'', endet.
Wir wollen nun sezen, daß, wenn man die Stange, z, des
Staͤmpels in das Loch, q, einfuͤhrt, Fig. 6.
dieselbe sich in einer solchen Lage befindet, daß die Loͤcher, d, d', mit den Loͤchern, x, x, correspondiren; wenn dann das Stuͤk, e, f, Fig.
7. an diesem Staͤmpel angepaßt wird, wird das Loch, u', Fig. 9. mit dem Loche, t'', Fig. 6. in Verbindung
seyn, und die Furche, l', wird mit der Furche, v', u, u'', correspondiren.
Das Zahnrad, g'', auf der Stange des Staͤmpels,
z, theilt dieser eine umdrehende Bewegung mit.
Der Hahn, den wir hier beschrieben haben, und der an der Presse der HHrn.
Gebruͤder Gruet, zu Muille Villette, bei Ham,
angebracht ist, ist etwas von demjenigen verschieden, der in Fig. 5 und 10. Tab. X. dargestellt
ist. Er befindet sich aber in derselben Lage, so wie die drei kupfernen
Roͤhren, aus welchen er besteht. Diese Roͤhren sind an dem
Stuͤke, e, f, des Hahnes, Fig. 7. angebracht; zwei
derselben entspringen von den walzenfoͤrmigen Stuͤken, p', q', p', q, und laufen bis zu dem Puncte, f', Fig. 4. an jeder Pumpe.
Die dritte Roͤhre, k, Fig. 2 und 3. ist auf dem
Stuͤke, r', Fig. 7. aufgezogen, und
steigt in den Sumpf aus Eisenblech, s, s.
Zwei andere Roͤhren, g, h''', Fig. 2., die an den
Stuͤken, g, n, g, n, Fig. 6. angepaßt, und
mittelst Schrauben angezogen sind, laufen durch das Gußstuͤk, a, und muͤnden bei b',
b', in die Koͤrper der Pumpe hinter den Staͤmpeln, b, b. An dem Ende dieser Staͤmpel befinden sich
die Platten aus Gußeisen, c, c, Waͤchter (Wards) genannt, die mittelst vier Stangen, v, v, zwei oben, und zwei unten, unter einander
verbunden sind. Diese Waͤchter wirken in gegossenen Kisten, d, und druͤken daselbst die Saͤke mit den
Oehlsamen, die man vorlaͤufig in dieselben eingesezt hat, zusammen.
Die gegossenen Kisten und das Stuͤk, a, werden
durch die Waͤnde, f, f, die durch drei starke
eiserne Guͤrtel, g', g', g', gebunden und
zusammengeschnuͤrt werden, festgehalten.
Wir haben gesagt, daß die Pumpen bei r, mit
Sicherheits-Klappen, p, Fig. 4. versehen sind, die
von Hebeln gedruͤkt werden, deren Enden mit Gewichten beladen sind. Diese
Hebel fuͤhren aber nur eine geringe Anzahl von Eintheilungen, die der
Entfernung zwischen dem Mittelpuncte der Bewegung und dem Stuͤzpuncte gleich
ist, und man haͤtte daher bedeutende Gewichte anwenden muͤssen, um zu
hindern, daß diese Klappen sich nicht ehe heben, als die Staͤmpel das Maximum von Druk
erzeugten. Hr. Hallette hat
durch eine Verbindung mehrerer Hebel-Arme die Schwere dieser Gewichte
vermindert, und bedient sich nur mehr eines einzigen fuͤr die beiden
Klappen.
Die Hebel sind auf folgende Weise vorgerichtet. Unter jedem Arme, m, der Wage, n, ist eine
kleine senkrechte Stange, m'', Fig. 3. die hinter dem
Sumpfe, s, hinabsteigt, und mit deren unteren Ende ein
Hebel, n'', i'', Fig. 2. correspondirt, der
sich um den Punkt, h', dreht. Der Theil, i'', dieses Hebels ist in einer Art Buͤgels, k', eingeschlossen, der sich senkrecht mittelst der
Stange, h'', Fig. 3. bewegt, die durch
zwei Schlußbuͤchsen an dem oberen und unteren Ende des Kastens, a', a', laͤuft. Diese Stange sezt einen
horizontalen Hebel, s'', d'', der sich um, d'', dreht, in Bewegung, und an diesem ist eine Stange
befestigt, die ein Gewicht, y, von 10 Pfund 12 Loth
traͤgt.
Durch den Buͤgel, k', laͤuft eine
horizontale Achse, q'', p'', Fig. 3., auf welcher ein
Schwingbalken, a'', b'', Fig. 2. befestigt ist, der
sich abwechselnd auf die Puncte, v'', stuͤzt, und
den Buͤgel noͤthigt, sich zu senken. Diese Bewegung wird dem Hebel,
n'', i'', mitgetheilt, hebt das Ende, n'', und laͤßt die Fluͤßigkeit durch die
Sicherheits-Klappe ausfließen.
Die horizontale Achse, p'', q'', Fig. 3. ist mit einem
kleinen Zahne, oder einem Daͤumlinge, p'',
versehen, welcher, wenn er von einer der Scheiben oder Tasten, f'', an den oberen Stangen, v, beruͤhrt wird, den Buͤgel sinken macht. Diese Vorrichtung
dient, um das Brechen einiger Theile an dieser Presse zu verhuͤten.
Spiel der hydraulischen Presse.
Wenn durch die der Wage, n, mitgetheilte Bewegung einer
der Staͤmpel, l, der Pumpen, h, gehoben wird, so oͤffnet sich die an dem
unteren Theile angebrachte Klappe, n', Fig. 4, und laͤßt
das in dem Sumpfe, s, enthaltene Wasser in den
Koͤrper der Pumpe eindringen. Wenn dieser Staͤmpel sich senkt, so hebt
das Wasser die Sperrklappe, i, und tritt in die
Roͤhre, i', aus welcher es in diejenige
Roͤhre gelangt, die mit der Oeffnung, t, an dem
Theile, e, f, des Hahnes, Fig. 7. correspondirt.
Wenn das Wasser bis auf diesen Punct gelangt ist, so kann es nicht in die
gegenuͤberstehende Pumpe, weil die Sperr-Klappe, i, dann geschlossen ist; es laͤuft durch die
Oeffnung,
u', des Staͤmpels, z', Fig.
9., verbreitet sich in der Furche, k, Fig. 6. und
tritt von da durch das Loch, x, in die kleine
Roͤhre, k' aus welcher es endlich in die
Roͤhre, g, Fig. 3. in den
Koͤrper der Pumpe, b', faͤllt, um den
großen horizontalen Staͤmpel, b, zu treiben. Zu
gleicher Zeit ist aber das Loch, d' des Zapfens des
Hahnes, Fig.
9. in Verbindung mit dem Loche, t'', Fig. 6.,
welcher mit der Roͤhre, h''',
Fig. 2.
correspondirt; das Wasser steigt dann aus dem Koͤrper der Pumpe, b''' , hinauf, und tritt bei d', Fig.
9. aus, um sich in der Furche, l', zu
verbreiten, die mit v', u, u'', correspondirt, und durch
das Loch, v' entweicht, um in den Sumpf, s, auszufließen, indem es durch die in r', befestigte Roͤhre, k, laͤuft, Fig. 7. Waͤhrend
die Staͤmpel, l, l, sich abwechselnd heben und
senken, macht der Hahn, e, f, seine Umdrehung, und das
Loch, d, entfernt sich immer mehr und mehr von dem
Loche, k, Fig. 6. und treibt dadurch
immer die Fluͤßigkeit in dem Koͤrper der Pumpe, d'''. Waͤhrend der Hahn fortfahrt sich zu drehen, entfernt sich das
Loch, d', Fig. 9. von dem Loche, t'', Fig. 6.; da aber immer die
Verbindung mit der Furche, t'', k, unterhalten bleibt,
so fließt folglich das Wasser des Koͤrpers der Pumpe, b''', immer fort in den Sumpf, s. Wir bemerken
hier, daß, je mehr das Loch, d, Fig. 9. sich von, l, k, Fig. 6. entfernt (die Sake
sind naͤmlich dann schon in den Kisten), desto mehr der Druk sich vermehrt;
ja er wird endlich so stark, daß die Sicherheits-Klappe das Gewicht, y, hebt. Dann fließt aber auch das Wasser, statt dem
bisher angezeigten Wege zu folgen, durch diese Klappe aus. Da aber das Maximum des
Drukes ehe Statt hat, als das Loch, d, des
Staͤmpels des Hahnes nach b'' gelangt, Fig. 6., so
folgt, daß dieses Maximum waͤhrend der ganzen Zeit sich aͤußert,
waͤhrend welcher das Loch, d, den Raum
durchlaͤuft, der es von dem Puncte, b'', trennt.
Wenn es auf diesen Punct gekommen ist, und von b'', nach
t'', geht, befindet die Oeffnung, d', Fig. 9. sich zwischen l und o, Fig. 6.; dann ist, aber
nur waͤhrend einer sehr kurzen Zeit, alles geschlossen; der Druk nimmt weder
zu, noch ab, und das Wasser faͤhrt fort durch die Sicherheits-Klappen
auszufließen. Nachdem die Raͤume, l, o, und, t'', l, durchlaufen sind, findet das Loch, d, sich uͤber t, b'',
und, d', uͤber l,
z''. In diesem Falle leert sich der Koͤrper der Pumpe, d''', und, b''',
fuͤllt sich.
Man sieht, daß das Spiel der Presse auf diese Weise ununterbrochen fort geht, und da
waͤhrend der fuͤnf Minuten, die der Staͤmpel oder Zapfen des
Hahnes zu einer ganzen Umdrehung braucht, die beiden Staͤmpel der zwei
Cylinder einer nach dem anderen den Druk auf die Samen vollendet haben, so hat der
Arbeiter, waͤhrend zwei und einer halben Minute Zeit, die ausgepreßten
Naͤpfe (etindrelles) aus der Kiste zu nehmen,
neue Saͤke einzusezen, und die vier Kuchen zuzuschneiden und zu puzen, die er
aus derselben nimmt.
Aus dem Gesagten erhellt, daß, wenn die Saͤke zuviel Samen enthielten, die
Waͤchter weniger Raum durchliefen; der Druk waͤre dessen ungeachtet
aber doch nicht minder bestaͤndig, indem die Klappe nur bei dem Maximum des
Drukes sich oͤffnen darf. Die Samen muͤßten dann nur etwas
laͤnger in der Kiste bleiben. Bei den HHrn. Gebruͤdern Gruet sind vier Kuchen in fuͤnf Viertel Minuten
gepreßt, und haben waͤhrend dieser Zeit das Maximum des Drukes erlitten.
Unter dem Stuͤke, a, aus Gußeisen, Fig. 1. ist eine Tafel aus
Gußeisen, auf welche der Arbeiter die Saͤke legt, um sie in die Naͤpfe
zu bringen.
Wenn der Arbeiter aus Nachlaͤßigkeit, sich von der Arbeit entfernt, und die
Kisten nicht gefuͤllt haͤtte, und der Staͤmpel, b, fort spielte ohne zu pressen, so koͤnnte man
vielleicht besorgen, daß die Stangen v, v, brechen
moͤchten; Hr. Hallette
hat aber, fuͤr diesen Fall, die Presse von dem Arbeiter unabhaͤngig
gemacht. In dem Augenblike, wo der Waͤchter, c,
naͤmlich das Stuͤk, a, beruͤhrt,
und folglich nicht mehr zuruͤk kann, trifft die Scheibe oder Taste, f'', den kleinen Daͤumling, p'', und da dadurch der Theil, n'', des Hebels, n'', i'', gehoben wird, so
fließt das Wasser leicht durch die Sicherheits-Klappen aus. Man sieht
hieraus, daß der Raum zwischen den Scheiben, f'', f'',
dem Laufe eines der Staͤmpel gleich seyn muß. Was die Stangen, v, v, betrifft, so koͤnnen sie durch angebrachte
Schrauben und Niete mehr oder minder verlaͤngert werden, und so den Lauf der
Staͤmpel nach Belieben reguliren.
Berechnung der Wirkungen dieser Presse.
Es ist bei jeder hydraulischen Presse sehr leicht den Druk zu berechnen, den der
Staͤmpel erleidet, wenn man den Durchmesser desselben und der
Sicherheits-Klappe, das Verhaͤltniß zwischen der ganzen Laͤnge
des Hebels, an welchem das Gewicht angebracht ist, welches die Hebung dieser Klappe hindert,
und zwischen dem Abstande des Drehepunctes dieses Hebels von dem
Aufhaͤngepuncte dieser Klappe, und endlich das Gewicht, welches leztere
hindert sich zu heben, genau kennt.
Es sey, P der Druk auf den Staͤmpel.
D, der Durchmesser dieses Staͤmpels.
d, der Durchmesser der Sicherheits-Klappe.
g, die Zahl der Eintheilungen des Hebels, gleich der
Laͤnge zwischen dem Aufhaͤngepuncte und dem Puncte, wo diese Klappe
diesen Hebel zu heben strebt.
c, die Kraft, die die Klappe anwenden muß, um die
Schwere des Hebels zu uͤberwinden.
q, das Gewicht, welches die Kraft des Wassers gegen
diese Klappe aufwiegt. Hieraus wird dann der Druk
p = D²/d² (qg + c)
oder, da der Werth von c,
unbedeutend ist.
p = D²/d² (qg)
An der Presse des Hrn. Hallette
ist D = 6 Zoll; d = 3
Linien; g = 5; q = 52 Pfd.
(nach y' in Fig. 3., welches 10 Pfd.
12 Loth wiegt, auf den Punct, r'', des Hebels, r'', r, unter der Sicherheits-Klappe gebracht).
Es wird also, nach obiger Formel, P, oder der
groͤßte Druk auf die Waͤchter beinahe gleich seyn 150,000 Pfund.
Diese Presse braucht nur 4 Menschen, und die HHrn. Gruet haben mit derselben in vier und zwanzig
Stunden zwei tausend Kuchen, und vierzehn Tonnen Oehl, jede zu 100 Liter
gepreßt.
Wenn man diese Presse mit jener vergleicht, die die HHrn. Galloway, Bowman und
Comp. Hrn. Mille-Cattart zu Lille sandten, auf deren Staͤmpel
600,000 Pfund druͤken, so faͤllt die Vergleichung ganz zum Vortheile
der ersteren aus.
Die Presse des Hrn. Galloway
fuͤhrt einen Staͤmpel, der sich senkrecht hebt, und zwei Platten,
zwischen welchen sich horizontal acht Kuchen von 644 □Zoll Flaͤche
bringen lassen, worauf ein Druk von 600,000 Pfund, oder von 391 Pfund, auf den
□Zoll wirkt. Nun haben aber die Naͤpfe der Presse des Hrn. Hallette oben 7, unten 5 Zoll und 16
Zoll Hoͤhe, und biethen nur eine Flaͤche von 96 □Zoll dar. Der
Druk auf dieselben
betraͤgt aber 150,000 Pfund. Folglich kommt ein Druk von 1562 Pfund hier auf
jeden □Zoll.
Die Presse des Hrn. Hallette
arbeitet sich folglich auch leichter, und die gewoͤhnliche einmal beliebte
Form der Kuchen bleibt bei ihr dieselbe.
Diese Presse kostet 6000 Franken. Die Ausbesserungs-Kosten sind unbedeutend,
nur muß das Leder an den Stempeln von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Die kleinen
Parallelogramme an den Enden der Wage koͤnnten vielleicht auch einige
Ausbesserungen fordern: alle Ausbesserungs-Kosten zusammen werden aber
jaͤhrlich kaum mehr als 150 Franken betragen.
Hr. Hallette, der aus Erfahrung
weiß, wie wenig die Arbeiter geneigt sind, einer Maschine ihre Aufmerksamkeit zu
schenken, die sie von ihrem alten Schlendrian abbringt, hat diese Maschine so viel
moͤglich so eingerichtet, daß die Handgriffe derselben bei dem Alten bleiben
konnten. Und diese Vorsicht ist ihm hier auch vollkommen gelungen.
Diese Presse erfuͤllt folgende Bedingungen.
1) Wenn sie einmahl im Gange ist, braucht es nichts weiter, um die Staͤmpel in
ununterbrochener Bewegung zu erhalten; d.h., man darf sie nicht nach jedem Pressen
stille halten, und Zeit mit dem Nachlassen derselben verlieren.
2) Geschieht der Druk mit der vollkommensten Regelmaͤßigkeit, und wenn die
Sake auch nicht gleich viel Samen enthalten, so wirkt sie doch gleichfoͤrmig,
ohne die mindeste Berstung zu veranlassen.
3) Der Druk bleibt immer vollkommen derselbe, bei jeder Menge Samen, die in den
Saͤken seyn mag.
4) Der Gang der Presse haͤngt durchaus nicht von dem Arbeiter ab; sie geht
fort, auch wenn der Arbeiter sich davon entfernt, ohne daß man einen Unfall zu
besorgen haͤtte.
Verbesserungen an der Presse des Hrn. Hallette.
Die so eben beschriebene Presse wird bereits auf sehr vielen Oehlmuͤhlen im
noͤrdlichen Frankreich angewendet, und sie ist zeither nirgendwo in Unordnung
gerathen. Sie ist also gut gedacht, und sie sind auch gut gebaut und genau
gearbeitet, was sie auch seyn muͤssen. Denn, wenn der Hahn nicht mit der
hoͤchsten Sorgfalt ausgearbeitet ist, so wird die bedeutende Kraft, die die
Scheiben, welche den Vertheilungs-Hahn bilden, von einander zu entfernen
strebt, sobald der Druk auf die Basis der Staͤmpel das Maximum erreicht hat,
sehr bald diesen wichtigen Theil der Maschine verderben. Hr. Hallette hat auch in einer neuen hydraulischen
Presse, die er nach Valenciennes verfertigte, den Vertheilungs-Hahn durch ein
Klappen-System ersezt, welches, verbunden mit einem doppelten Keile und einem
Schaukel-Hebel, der durch eine Schraube ohne Ende in Bewegung gesezt wird,
alle Bedingungen dieses Hahnes vollkommen erfuͤllt, ohne daß die Klappen
durch den Druk, welchen die Fluͤßigkeit auf sie aͤußert, jemahls in
Unordnung gerathen koͤnnten.
Diese Verbesserung ist in Fig. 11., 12., 13 dargestellt, wo die
neue Presse im Aufrisse, Durchschnitte und Grundrisse gezeichnet ist. Fig. 14. und
15.
zeigen das System der Vertheilungs-Buͤchse. a, in Fig. 11. ist die Rolle, welche die Bewegung von der Haupttriebkraft
aufnimmt. b, ist die horizontale Achse, auf welcher
dieselbe aufgezogen ist. Diese Achse fuͤhrt in der Mitte ihrer Laͤnge
eine Schraube ohne Ende, d, und an jedem Ende derselben
eine Kurbel, t, t, die ihre Bewegung den Drukpumpen, c, c, mittheilt. g, ist ein
Zahnrad, in welches die Schraube ohne Ende, d,
eingreift. Dieses Rad, dessen Achse mit ihren beiden Enden auf den Lagern, h, ruht, dient mittelst des Zahnes oder
Daͤumlinges, i, und der Klopfer, k, k, die man in Fig. 16. im Profile
sieht, den Hebel, l, zu heben, dessen Mittelpunct der
Umdrehung sich im Puncte, m, befindet. Das Hintertheil
dieses Hebels, n, treibt abwechselnd von der Linken zur
Rechten, und von der Rechten zur Linken die Stange oder den Doppel-Keil, o, der, wie man in Fig. 14. sieht, in p, p, durch die Stange der beiden Klappen laͤuft,
die in dem Koͤrper der Pumpe, q, q, angebracht
sind. Diese Klappen oͤffnen und schließen abwechselnd der
zusammengedruͤkten Fluͤßigkeit den Durchgang, so daß sie stets nur
hinter einem der großen Staͤmpel auf ein Mahl Eingang findet. Nachdem die
Fluͤßigkeit ihren Druk auf die Basis einer dieser Staͤmpel
ausgeuͤbt hat, laͤuft sie durch die Roͤhre, v, in den Sumpf, s, Fig. 12., um
neuerdings hinter den correspondirenden Staͤmpel zu gelangen.
Die Injections-Pumpen, c, c, sind Saug- und
Druk-Pumpen, und sind nur in Hinsicht auf die Stellung ihrer Saug- und
Sperr-Klappen abgeaͤndert. Diese Klappen sind, nach der neuen Einrichtung, so
gestellt, daß man zu ihnen gelangen kann, ohne irgend ein Stuͤk der Maschine
zu zerlegen.
Hr. Hallette sorgte, wie wir
oben bemerkten, dafuͤr, daß die Mittheilung der Bewegung von der
Haupttriebkraft aus sehr leicht geschieht, und selbst waͤhrend der Zeit Statt
hat, wo die Sake, die die Samen enthalten, dem Maximum des Drukes ausgesezt sind;
daß uͤberhaupt das Spiel dieser Presse von den Arbeitern, die so wenig mit
Maschinen umzugehen wissen, so unabhaͤngig als moͤglich bleibt. Die
Theile derselben mußten also so eingerichtet seyn, daß, man mag die leeren
Raͤume mit der gehoͤrigen Menge der auszupressenden Koͤrper
ausfuͤllen, oder mehr oder weniger oder gar nichts von denselben nehmen, oder
unpreßbare Koͤrper in die Presse bringen, der Gang der Presse nicht die
geringste Veraͤnderung erleidet, so daß der Arbeiter, der die Maschine
bedient, nichts anders zu thun hat, als die Sake zur gehoͤrigen Zeit
einzusezen und herauszunehmen. Diese Bedingungen werden auch durch diese verbesserte
Presse eben so genau erfuͤllt, und da die Klappen an derselben sich durch
gewoͤhnliche Arbeiter auch leichter ausbessern lassen, kann man diese
Verbesserungen wirklich als wahre Verbesserungen betrachten.
Man weiß, wie schwer es ist, die Staͤmpel hydraulischer Pressen so
einzurichten, daß sie in den Cylindern kein Wasser durchlassen. Da die
Fuͤtterung mit Werg nicht hinreicht, um dem Druke der Fluͤßigkeit zu
widerstehen, hat Hr. Bramah in England eine Fassung von. eingebogenem Leder
vorgeschlagen. Hr. Hallette
bedient sich gleichfalls derselben. Sie laͤßt sich an horizontalen Cylindern
aber noch schwerer anwenden, als an den senkrechten, und Hr. Hallette hat ein sehr einfaches Mittel gefunden,
dieser Schwierigkeit abzuhelfen. Er hat den oberen Theil der Kammer des Leders
beweglich gelassen, so daß man sie ohne alle Schwierigkeit an ihre Stelle bringen
kann, und nur die vier kupfernen Segmente aufsezen darf, die den inneren Ring bilden
und dem Leder als Stuͤze dienen, und zugleich auch den oberen Theil der
Kammer ausmachen.
Fig. 17.,
18. und
19.
stellt diese Vorrichtung dar. Fig. 17. zeigt den
Preß-Blok, abgerissen, damit man seine innere Form sieht, die an beiden Enden
desselben dieselbe ist. a, ist der Staͤmpel. b, der hohle Cylinder, in welchem das Wasser oder das
Oehl, je nachdem man das eine oder das andere anwendet zusammengedruͤkt ist. c, ist das gebogene Leder (cuir
embouti), welches einen ringfoͤrmigen Canal bildet, der, der
zusammengedruͤkten Fluͤßigkeit nachgebend, einen seiner Raͤnder
gegen den Grund der Kehle, d, anlegt, und den anderen
gegen den Staͤmpel, und zwar immer im Verhaͤltnisse zu dem Druke, so
daß, wenn die Maschine gut gemacht ist, der Fluͤßigkeit aller Durchgang
dadurch versperrt wird. e, in Fig. 19. ist ein Ring aus
Bronze, der aus mehreren Segmenten so gebildet wird, daß, wenn er einmahl an seiner
Stelle ist, er nur ein einziges Stuͤk bildet, welches dem Ruͤken des
Leders, c, einen festen Stuͤzpunct gewahrt. Es
muͤßte auch wirklich, wenn er dem Druke des Leders nachgeben sollte, sein
Rand, der in die gegossene Furche, f, eintritt, brechen,
oder diese Furche muͤßte selbst los gehen, was nicht geschehen kann.
Fig. 19.
zeigt den Ring, e, im Grundrisse und im Aufrisse. Man
unterscheidet hier die drei Segmente, 1, 2, 3 und den Schluͤssel in der
Ordnung, in welcher sie aufgesezt werden. Nachdem man das Leder, c, in die Kehle eingesezt hat, lassen sie sich ohne
Hammerschlag anlegen.
Fig. 18.
zeigt einen Pak Ringe, womit man das Leder biegt oder kruͤmmt. a, Patrone aus einem diken Ringe oder einem
sorgfaͤltig abgedrehten Stuͤke Gußeisen. b, aͤußerer Ring. d, Bildungs- oder
Verlaͤngerungs-Ring. d, Leder, welches,
nach vorausgegangenem langen Einweichen, durch diese Ringe unter einem sehr langsam
verstaͤrkten aber bedeutenden Druke gebogen wird. Man muß in Zurichtung
dieses Leders sehr sorgfaͤltig und geuͤbt seyn, um es nicht zu
zerreissen. Man muß es solang als moͤglich unter dem Druke halten, und nicht
ehe aus der Patrone nehmen, als bis es zum Theile troken geworden ist. Nachdem es
endlich troken geworden ist, nimmt man, entweder auf der Drehebank, oder mit einem
Stok-Zirkel, dessen einer Schenkel schneidend ist, in paralleler Richtung mit
den Flaͤchen des Cylinders, a, den oberen Theil,
z, weg, und schneidet alles Ueberfluͤßige an
dem aͤußeren Rande ab, den man dann verduͤnnt, und nach Innen schief
zulaufen laͤßt.
Tafeln