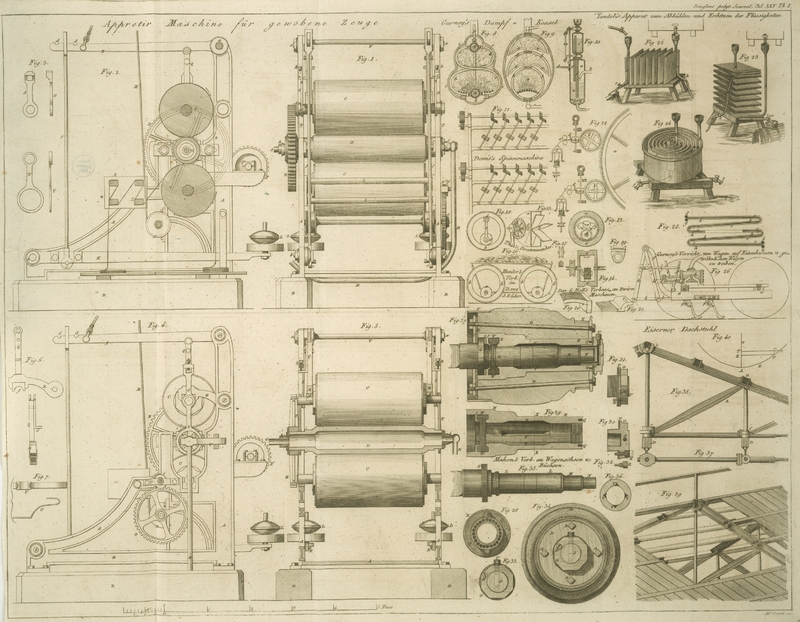| Titel: | Beschreibung einer Walzen-Maschine, um den Zeugen Glanz zu geben, welche bei Hrn. Leroy, Färber und Zurichter (teinturier-apprêteur, rue des Fôssés-Saint-Germain-des-Prés, N. 12. à Paris) im Gange ist. |
| Fundstelle: | Band 25, Jahrgang 1827, Nr. VIII., S. 33 |
| Download: | XML |
VIII.
Beschreibung einer Walzen-Maschine, um den Zeugen
Glanz zu geben, welche bei Hrn. Leroy, Faͤrber und Zurichter (teinturier-apprêteur, rue des
Fôssés-Saint-Germain-des-Prés, N. 12. à
Paris) im Gange ist.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement. N. 71. S. 1.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
(Im
Auszuge.)
Leroy's, Beschreibung einer Walzen-Maschine um den Zeugen Glanz zu
geben.
Die gewobenen Stoffe muͤssen bekanntlich, wenn sie aus
dem Stuhle kommen, um Kaufmansgut zu werden, oder die ihnen noch fehlende
Bearbeitung zu erhalten, zugerichtet, (appretirt) werden.
Diese Zurichtungen (Appreturen) dienen theils 1) zum Waschen, Faͤrben, Druken;
2) zum Glaͤtten oder Glaͤnzen (lustrage),
Waͤssern (Moirage), Plaͤtten (Taminage), Kraͤuseln (Gauffrage); 3) zum Sengen (Grillage), und zum
Scheren.
Ueber das Waschen und Scheren der Stoffe wurde in dem Bulletin bereits gesprochen. Hier ist von dem Geben des Glanzes (lustrage) die Rede, und das Bulletin verspricht
naͤchstens von dem Absengen zu handeln.
Die beiden Hauptbedingungen, um den Zeugen Glanz zu geben, der durch das Abplatten
der Faden entsteht, sind, den Zeug unter einem vollkommen rechten Winkel dem Druke
darzubiethen, und der druͤkenden Oberflaͤche, die unmittelbar auf das
Gewebe wirken muß, die moͤglich groͤßte Glaͤtte zu ertheilen.
Etwas Feuchtigkeit oder Hize ist nothwendig, um diese Arbeit gehoͤrig zu,
vollenden, und wenn die Haͤrchen auf der Oberflaͤche des Gewebes, der
sogenannte Flaum des Gewebes (le duvet) sehr elastisch
ist, was der Fall ist, wenn die Faden aus thierischem Stoffe sind, so muß der Druk
eine gewisse Zeit uͤber mit der urspruͤnglichen Staͤrke
unterhalten werden. Man erhaͤlt diese Wirkung mittelst der gewoͤhnlichen oder hydraulischen
Pressen, wenn man zwischen jede Lage des Gewebes geglaͤttete
Preßspaͤne (cartons lustres), oder erhizte
Metallplatten legt.
Pflanzenstoffe nehmen im Allgemeinen augenbliklich, und durch einen, sehr kurze Zeit
uͤber anhaltenden, Druk Glanz an. Die zu diesem Zweke eingerichteten
Maschinen bestehen aus einer groͤßeren oder geringeren Anzahl Walzen, durch
welche man den Stoff laufen laͤßt. Um diesem den gehoͤrigen Glanz und
die gehoͤrige Festigkeit zu geben, muß man zugleich Druk, Reibung und starke
Hize anwenden. Alle diese drei Wirkungen werden durch eine hoͤchst einfache
Maschine erzeugt, die aus drei uͤber einander angebrachten Walzen besteht,
wovon die eine aus Kupfer, oder aus geschlagenem Eisen besteht, und die beiden
anderen aus Holz sind. Wenn, wie bei den Plaͤtt- oder Strek-Werken, alle
Walzen aus Metall waͤren, so wuͤrde die Unbiegsamkeit derselben den
Zeug abschneiden; man mußte daher eine sehr harte Walze mit anderen Walzen
verbinden, die etwas biegsam sind. Die hoͤlzernen Walzen, deren man sich in
dieser Absicht bedient, haben den Fehler, daß sie bald aus der Form gerathen, und
dem Druke nicht widerstehen, den sie zu erleiden haben; es geschieht auch nicht
selten, daß eine solche hoͤlzerne Walze sich beim ersten Umlaufe spaltet, und
daß die große Auslage, welche eine solche Walze verursachte, rein verloren ist. Um
diesem Nachtheile auszuweichen, verfertigte man dieselben statt aus Holz, aus
Scheiben von Pappendekel, mit welchen man nicht bloß Jahre taͤglich arbeiten
kann, sondern durch welche der Zeug auch einen hoͤheren Glanz erhaͤlt.
Im ersten Jahrgange des Bulletins ist, S. 90, die, heute
zu Tage allgemein in den Fabriken eingefuͤhrte, Weise, diese Walzen aus
Papier zu verfertigen, genau beschrieben.
Die metallne Walze, die in der Mitte hohl ist, damit man sie erhizen kann, ist in der
Mitte zwischen den beiden anderen angebracht. Der Zeug geht zwischen der unteren und
der mittleren Walze durch, und laͤuft zwischen dieser und der oberen Walze
zuruͤk, so daß er also an dem seinem Eintritte entgegengesezten Orte heraus
kommt. Eine Dampfmaschine oder ein Wasserrad, oder irgend eine andere starke
Triebkraft sezt die Walzen in Bewegung, die laͤnger seyn muͤssen, als
die breitesten Zeuge breit sind.
Um die Metall-Walze zu erhizen, bediente man sich seit langer Zeit roth
gluͤhender Eisenstangen, die man in den Raum zwischen der Achse und den
Querbalken, die die Walzen tragen, einfuͤhrte. Man wird begreifen, daß diese
Hize nicht gleichfoͤrmig seyn konnte; daß sie immer abnehmen mußte, und daß
man die Eisenstangen immer erneuern mußte.
Man hat diese Art Heizung, deren Nachtheile man bald einsehen lernte, aufgegeben, und
dafuͤr die Dampfheizung eingefuͤhrt, durch welche die Hize
gleichfoͤrmiger vertheilt, und das ermuͤdende Aus- und Einschieben der
gluͤhenden Eisenstangen erspart wird. Man durfte nur eine kleine
Veraͤnderung an der metallnen Walze anbringen, um sie zur Dampfheizung
einzurichten. Die metallne Walze ist in der Mitte ganz hohl, und hat
ungefaͤhr Einen Zoll in der Dike. Ihre beiden Zapfen sind auch hohl, jedoch
so, daß sie leicht auf ihren Lagern laufen koͤnnen. Sie muͤssen
hermetisch geschlossen seyn, damit der Dampf nirgendwo einen Ausweg findet. Dieser
Dampf tritt durch einen der beiden Zapfen ein, und erfuͤllt den inneren Raum
der Walze. Nachdem er daselbst seine Wirkung erzeugt hat, tritt er durch eine
Roͤhre an dem entgegengesezten Ende aus. Da er aber noch immer viele Hize mit
sich fuͤhrt, so wuͤrde man dieselbe umsonst verlieren, wenn man sie
frei entweichen ließe; man bedient sich desselben also zu anderen Zweken, oder
fuͤhrt ihn verdichtet als Wasser in den Kessel zuruͤk.
Die Maschine des Hrn. Leroy ist nach diesen verbesserten
Grundsaͤzen eingerichtet. Sie wurde in dessen Werkstaͤtte selbst
gezeichnet. Man sieht sie auf Tab. I. von
verschiedenen Seiten. Sie besteht aus drei uͤber einander befindlichen
Walzen, wovon die oberste C', und die untere, C, aus Papier ist; die mittlere, D, ist aus gegossenem Kupfer, gehoͤrig abgedreht und polirt. Diese
Walzen sind in einem festen Gestelle aus Gußeisen, A,
aufgezogen, welches auf zwei starken Balken aus Eichenholz, B, ruht. Die Walze, D, erhaͤlt ihren
Dampf mittelst eines Dampfkessels einer kleinen Dampfmaschine, die nur die Kraft
eines Pferdes besizt, und zugleich die Maschine treibt. Sie wurde von Hrn. Daret mit vielem Fleiße verfertigt. Nachdem der Dampf die
Walze erhizt hat, tritt er in die Roͤhre, H, von
welcher er in die Faͤrbekessel geleitet wird, die er zum Sieden bringt. Um
ihn in der Walze zuruͤkzuhalten, tritt die Einfuͤhrungsroͤhre, G, in ein kegelfoͤrmiges
Verbindungs-Stuͤk, h, welches dieselbe hermetisch
schließt. Die Roͤhre, H, verbindet sich auf
dieselbe Weise, und wird durch eine Feder, U, die alles
Schaukeln hindert, gegen den kegelfoͤrmigen Einsaz, i, gedruͤkt. Es ist keine Klappe an diesen Roͤhren
angebracht, indem man sich uͤberzeugte, daß der bloße Durchgang des Dampfes
durch den Cylinder hinreicht, der Walze den gehoͤrigen Grad von Hize zu
ertheilen.
Die papierne Walze, C, laͤuft auf fest stehenden
Lagern, waͤhrend die beiden anderen Walzen auf Lagern laufen, die man stellen
kann. Dadurch kann man die Walzen auf einander druͤken, und sie stellen, wie
es der Dienst fordert. Der Druk der obersten Walze auf die metallne Walze geschieht
mittelst zweier großen, beweglichen Hebel, I, I, die um
ihre Mittelpuncte, a, a, laufen, und deren Enden, in
Kerben geschnitten, wie eine Schnellwage, d, d, die
beiden senkrechten Stangen, J, J, stuͤzen. Diese
Stangen verbinden sich mit zwei anderen Hebeln, K,
welche sich um die Puncte, b, b, bewegen, und mit dem
Gewichte, L, belastet sind. Man begreift, daß, je
schwerer diese Gewichte sind, desto tiefer der Hebel, K,
niedersteigen, und die Stangen, J, J, mit sich ziehen
wird, welche, von ihrer Seite, wieder den Hebel, I,
herabbringen werden. Dieser stuͤzt sich auf die Zapfen der obersten Walze,
C, mittelst des Stuͤkes, Q, welches eine Art Schluͤssel fuͤhrt, R, der sich um den Punct, f,
bewegt, und das Lager, g, umfaßt. Je nachdem man die
Stangen, J, J, dem Mittelpuncte der Hebel, I, I, nahe bringt, oder davon entfernt, wird der Druk
vermehrt oder vermindert, und kann so nach der Natur des Stoffes, dem man Glanz
geben will, bemessen werden.
Um die Walzen zu stellen und zu heben, bedient man sich der Winde, N, deren Achse ein gezaͤhntes Rad, O, fuͤhrt, in welches ein Triebstok, P, eingreift, den man mittelst einer Kurbel dreht. Eine
Schnur, M, die auf diesem Haspel aufgewunden ist,
laͤuft uͤber eine oben an der Deke eingehaͤngte Rolle zu dem
Hebel, I, an welchem sie befestigt ist. Wenn man diese
Schnur anzieht, hebt sich der Hebel und der Stuͤzpunct desselben, Q, wodurch aber die Walzen noch nicht frei werden. Dieß
Leztere geschieht mittelst zweier brillenfoͤrmiger Stuͤke, S, S, die mit ihren unteren Enden in die Achsen der
Walze, C', eingreifen, und mit dem anderen Ende in ein
hervorspringendes vorspringendes Stuͤk des Haͤlters, Q, wo
sie durch die Schrauben, k, festgehalten werden. Auf
diese Weise wird die Walze, C', gehoben. Wenn man auch
die metallne Walze heben will, macht man zuerst die Roͤhren, G, und, H, los;
haͤngt in die Zapfen derselben die Brillen, T,
ein, die den vorigen aͤhnlich, und an der Achse der oberen Walze angebracht
sind, und hebt so, indem man den Haspel dreht, beide Walzen zugleich aus.
Die Triebkraft der Maschine wird an der metallnen Walze angebracht, deren Achse ein
Zahnrad fuͤhrt, E, in welches der Triebstok, F, eingreift, der auf der Achse der Dampfmaschine
aufgezogen ist. Die beiden anderen Walzen drehen sich in Folge der Wirkung des
Drukes, den sie von der metallnen Walze erleiden, aber in entgegengesezter Richtung,
wie die Pfeile an dem Durchschnitte Fig. 2. zeigen.
Der Zeug wird auf den Tisch, Y, gelegt, und zwischen die
Latten, X, die vor dem Arbeiter zu liegen kommen,
gebracht. Die Kanten dieser Latten sind abgerundet, damit sie keine Risse an dem
Zeuge veranlassen. Von hier aus bringt man ihn, unter gehoͤriger Spannung,
damit sich keine Falten bilden, zwischen die untere Walze, und die metallne Walze,
die er auf der Haͤlfte ihrer Oberflaͤche umfaßt; dann auf die obere
Walze, wo ihn ein auf der anderen Seite der Maschine vor derselben stehender
Arbeiter aufnimmt, und gehoͤrig zusammenlegt. Den Lauf des Zeuges zeigt der
Buchstabe, Z, im Durchschnitte, Fig. 2. Er tritt
vollkommen geglaͤttet aus der Maschine. Man kann auf diese Weise in Einem
Tage 1,500 Ellen Zeuges den gehoͤrigen Glanz geben.
Da die Kraft der Dampfmaschine mehr als hinreichend war, die Walze zu drehen, und man
doch den Kessel nicht kleiner machen konnte, benuͤzte Hr. Leroy den uͤberfluͤßigen Dampf in seiner
Werkstaͤtte zur Heizung der Kessel zu ebener Erde, und im ersten Stoke zu
einer Trokenstube.
Erklaͤrung der Figuren auf Tab. I
.
Fig. 1. Aufriß
der Walzen-Maschine von vorne.
Fig. 2.
Durchschnitt durch die Mitte derselben.
Fig. 3. Die
Brillen-Stuͤke des obersten und des metallnen Cylinders einzeln
dargestellt.
Fig. 4. Die
Maschine von der rechten Seite.
Fig. 5.
Senkrechter Durchschnitt durch die Achse der metallnen Cylinder.
Fig. 6.
Schluͤssel, der sich auf das Lager der oberen Walze stuͤzt, von vorne
und von der Seite.
Fig. 7. Feder,
die die Roͤhre, H, gegen den
kegelfoͤrmigen Einsaz der Zapfen der Walze, D,
druͤkt.
A, Gestell aus Gußeisen.
B, Sohlen aus zwei starken Balken aus Eichenholz.
C, untere papierne Walze.
C', obere papierne Walze.
D, hohler Cylinder aus Kupfer.
E, Zahnrad auf der Achse dieser Walze.
F, Triebstok, der in dieses Rad eingreift.
G, Roͤhre, durch welche der Dampf zugeleitet
wird.
H, Roͤhre, durch welche er ausgeleitet wird.
I, I, große Hebel, in Form einer Schnellwage.
J, J, senkrechte Stangen, welche in diese Hebel
eingehaͤngt sind.
K, K, andere untere Hebel.
L, Gewicht, mit welchem diese Hebel beladen sind.
M, Schnur an dem Hebel, I,
die uͤber die an der Deke angebrachte Rolle laͤuft, die auf der Tafel
nicht gezeichnet werden konnte.
N, Winde oder Haspel.
O, Zahnrad auf der Achse des Haspels.
P, Triebstok, der in dieses Rad eingreift.
Q, Stuͤze, die den Druk auf die obere Walze
erzeugt.
R, Schluͤssel, der das Lager dieser Walze umfaßt,
und den unmittelbaren Druk des oberen Stuͤkes aufnimmt.
S, S, Brillen der oberen Walze.
T, T, Brillen, die die Zapfen der metallnen Walze
umfangen.
U, Feder, die die Roͤhre, H, gegen ihren Einsaz druͤkt.
V, oberer Querbalken des Gestelles.
X, X, Latten, uͤber welche der Zug
laͤuft.
Y, Tisch, auf welchen der Zeug gelegt wird.
Z, Lauf, den der Zeug durch seine Walzen nimmt.
a, Mittelpunct der Bewegung des Hebels, I.
b, Mittelpunct der Bewegung des Hebels, K.
c, Zapfen der Stangen, J,
J.
d, d, Kerben, die in das Ende des Hebels, I, eingeschnitten sind.
e, Sperrrad, welches die Bewegung des Triebstokes, P, stellt.
f, Mittelpunct der Bewegung des Schluͤssels, R.
g, Pfanne oder Lager der oberen Walze.
h, kegelfoͤrmiger Einsaz der Walze, D.
i, kegelfoͤrmiger Theil der Roͤhre, H.
k, k, Schrauben, welche die Brille, S, auf dem Haͤlter, Q, fest halten.
Tafeln