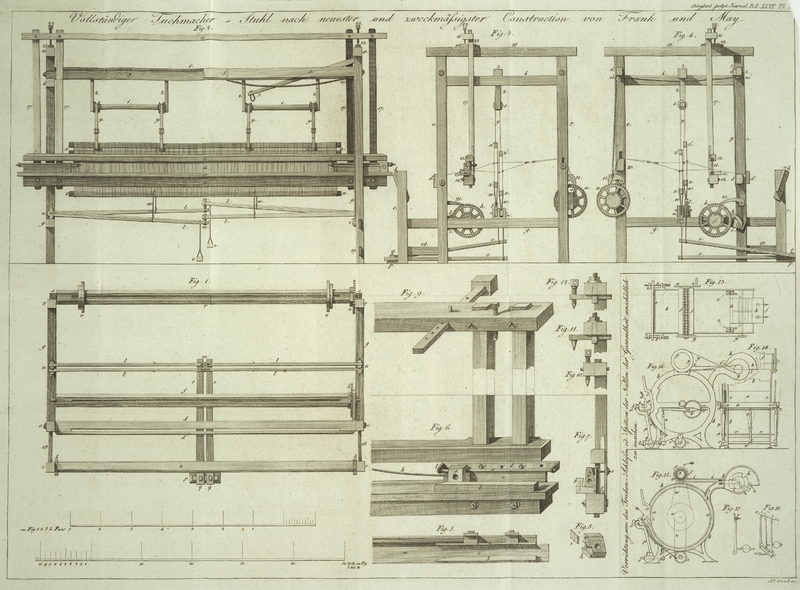| Titel: | Beschreibung eines vollständigen Tuchmacherstuhls, nach neuester und zwekmäßigster Konstruction. Von den Fabriken-Commissions-Räthen Frank und May. |
| Fundstelle: | Band 27, Jahrgang 1828, Nr. I., S. 2 |
| Download: | XML |
I.
Beschreibung eines vollstaͤndigen
Tuchmacherstuhls, nach neuester und zwekmaͤßigster Konstruction. Von den
Fabriken-Commissions-Raͤthen Frank und May.
Aus den Abhandlungen der koͤnigl. preußischen
technischen Deputation fuͤr GewerbeDer Inhalt des ersten Theils dieses technischen Prachtwerkes, wovon wir der
Guͤte Sr. Exzellenz des Herrn Ministers
Freiherrn v. Schuckmann ein Exemplar
verdanken, enthaͤlt: I. Beitraͤge zur
Kenntniß des Dampfmaschinenwesens, von dem
Fabriken-Commissionsrathe Severin, und zwar I. Geschichte der Dampfmaschine, die in folgende
Unterabtheilungen zerfaͤllt: 1. Erste Versuche und Savarische
Maschinen. 2. Nawcomensche Maschinen. 3. Watt'sche Maschinen und
Veraͤnderungen derselben in England, in Frankreich und in
Deutschland. 4. Hochdrukmaschinen mit auf- und niedergehenden Kolben.
5. Maschinen mit 2 Cylindern zur doppelten Benuͤzung des Dampfes. 6.
Rotirende Maschinen. 7. Einige andere durch Feuer und Waͤrme in
Bewegung gesezte Maschinen. 8. Ueber die Kessel und Feuerungen der
Dampfmaschinen. 9. Anwendung der Dampfmaschinen aus die Bewegung der
Schiffe. II. Detaillirte Beschreibung einiger
Dampfmaschinen, ihrer Ausfuͤhrung und ihres Effectes. 1.
Eine Maschine von 16 Pferdekraft, bei dem Fabrikanten Hrn. Tappert in
Berlin. 2. Beschreibung der Dampfmaschine in der Kattundrukerei des Hrn.
Dannenberger in Berlin. 3. Beschreibung einer Dampfmaschine von dem
Mechanikus Hrn. Freund. 4. Beschreibung einer doppeltwirkenden Dampfmaschine
von Humphry Edwards in Paris, nach dem Woolff'schen Prinzip. 5. Ueber
Veraͤnderung der Richtung in der Bewegung einer Dampfmaschine.
6. Die beim Bergbaue aufgestellten Dampfmaschinen und verschiedene
Bauanstalten derselben in den Koͤnigl. Preussischen Staaten. III. Einige allgemeine Betrachtungen uͤber Dampf,
Dampfmaschinen und ihre Theile. 1. Ueber den Dampf. 2. Von den
Kesseln. 3. Von dem Cylinder, der Kraftberechnung und den einzelnen Theilen
einer Dampfmaschine. II. Beitraͤge zur
Tuchfabrikation. I. Beschreibung eines Tuchweberstuhls. Von den
Fabriken: Commissionsraͤthen Frank und May, den wir hier in einem um ein Viertheil
verkleinerten Maßstabe in Abbildung mittheilen. II. Beschreibung einer
Rauhmaschine. Von dem Fabriken-Commissionsrath Frank. III. Beschreibung einer Scheermaschine. Von dem Geheimen
Ober-Finanzrath Beuth. III. Beschreibung
einer Maschine fuͤr Kupferstecher. Von dem
Fabriken-Commissionsrath Severin.
Demselben sind beigegeben 13 große Kupfertafeln und 29 in groß Folioformat,
und zwar in einer so vollendeten Ausfuͤhrung, daß sie wohl schwerlich
durch ein aͤhnliches Werk uͤbertroffen werden koͤnnen.
Wenige Exemplare wurden der Buchhandlung Dunker
und Humblot in Berlin zum Debuͤt
uͤbergeben, wovon das Exemplar 30 preuß. Thlr. kostet, ein Preis, der
mit dem großen Kunstwerthe dieses Prachtwerkes in einem sehr geringen
Verhaͤltnisse steht. Wo der Staat seiner Industrie mit solchen
Leitfaͤden an Handen geht, da muß sie auch den hoͤchsten
Gipfel ihrer Vervollkommnung erreichen. A. d. Red.. Erster Theil, Berlin 1826. S. 379.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Frank's und May's, Beschreibung eines vollstaͤndigen
Tuchmacherstuhls.
Wenn man die Werkstaͤtten der Weberei durchwandert, und
seine Aufmerksamkeit auf die Werkzeuge und Maschinen richtet, welche sich darin
vorfinden, so wird man bald gewahr, daß die Konstructionen und Dimensionen, nach
welchen dieselben erbauet sind, in der Regel sehr von einander abweichen.
Laͤßt man sich daruͤber mit den Webern in Unterredung ein, so vernimmt
man wohl, daß es sich auf dem einen Weberstuhl leichter und besser arbeiten lasse,
als auf dem andern; aber selten wird man einen Meister oder Gesellen finden, welcher
im Stande waͤre; den eigentlichen Grund hiervon anzugeben. Um dem
fehlerhaften Stuhle zu Huͤlfe zu kommen, wenden die Weber wohl mancherlei
Mittel an, die auch oft den Zwek erreichen wuͤrden, wenn sie nur
hinlaͤngliche Dauer und Festigkeit gewaͤhrten; wiewohl diese
Huͤlfsmittel gewoͤhnlich dem Auge des Besuchers wehe thun, wenn
derselbe an Ordnung und Regelmaͤßigkeit gewoͤhnt ist.
Jene Verschiedenheit in der Konstruction und dem Baue der Weberstuͤhle
gruͤndet sich auf mehrere Ursachen. Zunaͤchst faͤllt es der
Nachlaͤßigkeit unserer Tischler oder Zimmerleute zur Last, wenn die von ihnen
erbaueten Weberstuͤhle nicht von der guten Wirkung sind, als das dazu gegebene Muster. Bei
dem Ausmessen wird gewoͤhnlich auf einen Viertel- oder halben Zoll
nicht so genau geachtet. Die Bearbeitung und Zusammenstellung des neuen Stuhls
fuͤhrt wiederum auf Abweichungen, und so kommt es oft, daß der neu erbauete
Stuhl ganz andere Dimensionen als das dazu gegebene Muster enthaͤlt, was
jedoch der gewoͤhnliche Weber selten zu beurtheilen versteht, welcher die
Verschiedenheit nur erst findet, wenn ihm die Arbeit auf dem neuen Stuhl nicht so
leicht von der Hand gehet, als auf dem zum Muster gegebenen alten.
Eine andere Ursache, weßhalb die Weberstuͤhle in ihrem Baue so sehr
verschieden erscheinen, liegt auch darin, daß der Tischler oder Zimmermann
gewoͤhnlich nur einige Maße, selten aber eine vollstaͤndige Zeichnung,
von dem Stuhle zur Hand hat, welchen er zu erbauen beabsichtiget, und aus der er die
erforderlichen Dimensionen, nach der beabsichtigten Konstruction, jederzeit
entnehmen koͤnnte. Vieles wird dann nach Gutduͤnken angefertiget, und
der neue Stuhl ist am Ende ganz etwas anderes geworden, als was er der Bestellung
nach haͤtte werden muͤssen, wenn die Ausfuͤhrung mit
Genauigkeit geschehen waͤre.
Eine Hauptursache aber, daß so viele schlechte Weberstuͤhle erbauet, und in
den Werkstaͤtten aufgestellet werden, liegt oft in der Nachlaͤßigkeit
und dem Mangel an Einsicht von Seiten der Fabrikenunternehmer. Ihnen liegt in der
Regel sehr wenig daran, ob dem Lehrmeister oder Gesellen die Arbeit leicht oder
schwer von der Hand gehet, denn sie bezahlen ja nicht nach Zeit, sondern nach
Stuͤk. Der Weber mag also sehen, wie er mit dem schlechten Stuhle fertig
wird, und dieser hilft sich denn auch so gut er kann, und so weit er es versteht.
Wenn nur die Arbeit bei der Ablieferung annehmbar erscheint, was kuͤmmert es den
Unternehmer, wie sehr der Arbeiter sich hat quaͤlen muͤssen. Werden
neue Stuͤhle erbauet, so gibt man sie dem Mindestfordernden in Arbeit. Ja, es
haben sich sogar Faͤlle ereignet, daß Fabrikenunternehmer, welche auf Bildung
und Anerkennung ihrer Verdienste Anspruch nehmen, die ihnen auf Kosten des Staats
zugetheilten zwekmaͤßigen Weberstuͤhle nicht einmahl weiter haben
nachbauen lassen, weil die nach gewoͤhnlichen schlechten Konstructionen
angefertigten wohlfeiler herzustellen waren, und es zunaͤchst nicht zu ihrem
Nachtheil gereicht, wenn die Arbeit darauf schwer zu verrichten ist.
In allen mechanischen Dingen, wozu die Weberei zunaͤchst gehoͤrt, gibt
es aber zur Erreichung eines Zwekes nur eine beste Art, und, wenn diese einmahl
aufgefunden ist, so sollte jeder in seinem Fache dahin streben, sie fest zu halten,
und dafuͤr zu sorgen, daß sie nicht wieder verloren gehe. Es geziemt dem
gebildeten Menschen, und so auch Fabrikenunternehmer, sich nur der besten und
verstaͤndigsten Mittel zu bedienen, und jedes Mittel, welches dazu geeignet
ist, eine Arbeit zu erleichtern, nuͤzt nicht allein dem Arbeiter, welcher sie
verrichtet, sondern auch dem Unternehmer, fuͤr welchen sie verrichtet wird,
indem es die Kraͤfte des Arbeiters schont, und ihn dadurch ermuthiget, seinen
Fleiß auf die Hervorbringung vollkommen guter Arbeit zu verwenden.
Indessen gibt es auch noch Fabrikenunternehmer und Gewerbsmeister, welche bei dem
Baue der Weberstuͤhle gern die besten Muster zum Grunde legen, und auf deren
genaue Ausfuͤhrung halten wuͤrden, wenn sie nur damit bekannt waren.
Um diesen nun zu Huͤlfe zu kommen, und zugleich die Weberstuͤhle nach
ihrer verschiedenen Art in neuester und zwekmaͤßigster Konstruction
darzustellen, sollen leztere in einer Reihe von Zeichnungen und Beschreibungen in
den Abhandlungen mitgetheilt werden.
Es wird mit dem einfachsten der Weberstuͤhle, dem Tuchmacherstuhl, der Anfang
gemacht, welcher zugleich in neuer Zeit, bei Anwendung des Schnellschuͤzens,
die wichtigste Verbesserung erhalten hat, indem man ihn von dem
zweimaͤnnischen zum einmaͤnnischen Stuhle umgestaltete.
Tab. I. stellt den Stuhl in verschiedenen Ansichten dar, und zwar Fig. 1. im Grundrisse,
Fig. 2. in
der vorderen Ansicht, Fig. 3. in der
Seitenansicht, und Fig. 4. im Querprofile. Einerlei Gegenstaͤnde sind dabei mit
einerlei Buchstaben bezeichnet.
Im Grundrisse, Fig.
1., ist, a, die schraͤgliegende Sizbank
fuͤr den Arbeiter; sie ruhet auf den beiden Leisten, b, b, welche an den Pfosten, c, c, mit
Naͤgeln oder Holzschrauben befestigt sind. Der Brustbaum, d, ist durch Schraubenbolzen mit dem Pfosten, e, verbunden. Durch das angesezte Brustbrett, d', entstehet eine Spalte, durch welche das gewebte Tuch auf den Tuchbaum,
f, gelanget; dieser ruhet mit eisernen Zapfen in
Einschnitten der Riegel, g, g. – h, ist ein am Tuchbaume befestigtes gußeisernes
Sperrrad, und, i, ein durch den Zapfen des Tuchbaumes
gehaltener beweglicher Hebel, an welchem der Schiebezahn, k, Fig.
4. angebracht ist. Die 4 Querschemmel (contre
marches) J, J, J, J, welche bei, m, durch Gewinde Paarweise vereinigt sind, werden in den
Lagern, n, n, durch eiserne Stifte gehalten. Bei, m, sind die Querschemmel durch Schnuͤre mit den
Tritten, o, o, verbunden, welche auf dem am Fußboden
befestigten Lager, p, ruhen. Die schraͤg
eingestaͤmmten Loͤcher in den Fußtritten, durch welche die Zapfen, q, q, gehen, gestatten erstern die auf- und
niedergehende Bewegung. Der Garnbaum, r, hat eiserne
Zapfen an beiden Enden, und liegt mit denselben in den hoͤlzernen Lagern, s, s, die an den Pfosten, t,
t, angeschroben sind. An dem einen Ende des Garnbaumes ist das Sperrrad,
u, befestiget, welches dem vorhin erwaͤhnten
am Tuchbaume vollkommen gleich ist. v, v, sind
bewegliche hoͤlzerne Scheiben, die so weit auseinander gestellt werden, als
es die Breite der Kette erfordert; eiserne Stifte, welche durch die Scheiben gehen,
erhalten sie in der gegebenen Stellung. Der Garnbaum sowohl, als der Tuchbaum sind
mit Ruthen versehen, in welche die zur Befestigung dienenden Staͤbe gelegt
werden.
Die vordere Ansicht, Fig. 2., in welcher die Bank, der Brustbaum und der Tuchbaum, so wie auf
der linken Seite der Pfosten, e, zur deutlicheren
Darstellung der dahinter liegenden Theile weggelassen sind, bemerkt man die Lage der
Querschemmel, J, J, J, J, und der Fußtritte, o, o, in aufgezogener Stellung mit den Gewinden bei, m. Die Gewinde sind von der Art, daß der Bogen, welchen
die Schemmel bei ihrem Auf- und Niedergange machen, nicht schiebend oder
ziehend auf die Lager, n, n, wirken kann. Durch die
Schnuͤre, w, w, sind die Querschemmel mit den
untern Schaͤften, x, x, des Geschirres verbunden;
an den oberen Schaͤften, x', x', sind Riemen, y, y, y, y, vermittelst eingeschraubter Kloben, z, z, z, z, befestigt, welche uͤber die mit
eisernen Zapfen versehenen beweglichen Wellen, 1,1, gehen. Die Arme, 2, 2, 2, 2,
welche die Zapfen der Wellen aufnehmen, sind in dem Geschirrbaume, 3, eingezapft.
Der Geschirrbaum ruhet auf den Riegeln, 4, 4, und ist verschiebbar, um ihm die zum
Weben schikliche Lage leicht geben zu koͤnnen. 5, ist der vordere, und, 6,
der hintere Riegel, wodurch die beiden Seitenwaͤnde des Stuhls oberhalb
mittelst Schraubenbolzen, deren Muttern in das Holz eingelassen sind, verbunden
werden. Die beiden obern Kanten des vordem Riegels sind abgerundet, damit er als
Streichriegel, beim Aufziehen der Kette benuͤzt werden kann. An der hintern
Seite dieses Riegels ist ein doppelarmiger Hebel, 7, angebracht, welcher sich auf
dem Zapfen, 8, drehet: er dient dazu, mittelst der Schnur, 9, die an dem einen Ende
bei, 7', befestigt ist, und bis zum Hebel, i, gehet, das
Aufziehen des Tuchs zu bewirken, ohne daß der Arbeiter noͤthig hat, sich von
seinem Stande in der Mitte des Stuhls zu entfernen. Indem naͤmlich der Weber
mit der. linken Hand den Hebel bei, 7, niederdruͤkt; erhebt er sich bei, 7',
wodurch zugleich der Hebel, i, und mit ihm der
Schieberzahn, k, Fig. 4., der in das
Sperrrad, h, eingreift, gehoben werden, und die
Umdrehung des Tuchbaums hervorbringen, der Sperrhaken, 21, aber das
Zuruͤkgehen verhindert. Unter dem Riegel, 5, ist bei, 5, noch eine Schnur
befestigt, welche uͤber die Rolle, 10, gehet, und von da uͤber eine
zweite Rolle, 10', Fig. 4., nach dem Sperrhaken, 11, geleitet ist; sie hat den Zwek, daß der
Arbeiter, indem er die Schnur anziehet, und dadurch den Sperrhaken aufhebt, die
Kette nachlassen kann. 12, 13, 14, 15, 16 und 17, sind die Haupttheile der Lade,
welche auf dem Holme, 18, ruhet. Sie wird weiter unten mit ihren Triebwerken zum
Schnellen des Schuͤzens noch naͤher beschrieben werden. Aus der
Seitenansicht, Fig.
3., und dem Querprofile, Fig. 4. ergibt sich die
Lage und Verbindung der erwaͤhnten Theile nach denen damit
uͤbereinstimmenden Buchstaben und Ziffern. Die zu den Seitenwaͤnden
gehoͤrenden Stuͤke, als die Pfosten, c, e,
und, t, so wie die Riegel, g, 4, und, 19, und der Holm, 18, sind durch Verzapfungen fest mit einander
verbunden. Der Laͤnge nach sind die beiden Seitenwaͤnde oberhalb durch
die Riegel, 5, und, 6, wie schon bemerkt, vereinigt, unterhalb aber sind sie durch
den Brustbaum, d, und den Riegel, 20, verbunden. Dieser
Riegel hat neben dem Zwek, den Stuhl zusammen zu halten, noch den, daß er der Kette
zur Unterlage dient, vermittelst welcher sie hoch und niedrig gestellt werden kann,
zu welcher Absicht in die Pfosten, t, t,
verlaͤngerte Zapfenloͤcher gemacht sind. An der aͤußeren Kante
ist er stark abgerundet, damit die Kettfaͤden leicht uͤber ihn
hinweggleiten koͤnnen. Die Festhaltung dieses Riegels geschieht
uͤbrigens auch durch Schraubenbolzen mit eingelassenen Muttern.
Zur Lade, welche Fig.
2. in der vorderen, Fig. 3. in der
Seitenansicht, und Fig. 4. im Querprofile zu sehen ist, gehoͤrt der Ladenbaum, 12,
die Bahn, 13, das Riethblatt, 14, der Ladendekel, 15, der Holm, 16, und die vier
Arme, 17, 17, 17, 17. Leztere sind durch dicht schließende Zapfen mit dem Ladenbaum
und Holm verbunden, welche unterhalb durch eiserne Schraubenbolzen, und oberhalb
durch hoͤlzerne Naͤgel in den Zapfenloͤchern gehalten werden.
Die Bahn wird auf dem Ladenbaum festgeleimt. Der Ladendekel ist verschiebbar, um das Blatt einsezen zu
koͤnnen. Durch den Holm gehen die Schrauben, 22, 22, welche unten mit
verstaͤhlten Spizen versehen sind, mit welchen sie in eisernen Pfannen,
23,23, ruhen. Leztere enthalten mehrere Loͤcher, damit die Lade nach
Erforderniß vor- und ruͤkwaͤrts gestellt werden kann, so wie
durch die Schraube die Stellung nach der Hoͤhe bewirkt wird. Die Schraube,
welche Fig. 9
und 10. nach
groͤßerem Maßstabe gezeichnet ist, stehet absichtlich an der aͤußeren
Kante des Holms, um einen staͤrkeren Fall der Lade hervor zu bringen, der dem
Arbeiter das Einschlagen des Schußgarns erleichtert. Wuͤnscht man diesen Fall
durch noch weitere Vorruͤkung der Aufhaͤngepuncte zu vermehren, so
kann dieses dadurch geschehen, daß man die Schrauben durch ein verschiebbares Eisen
gehen laͤßt, wie Fig. 12. zeigt, wobei man
auch statt der Schraube eine einfache Spize, Fig. 11., anbringen kann,
welche leztere jedoch den Vortheil zum Hoch- und Niedrigstellen der Lade
nicht gewahrt. Der staͤrkere Fall der Lade kann uͤbrigens auch noch
dadurch bewirkt werden, daß man an den Holm horizontale verschiebbare Arme mit
Gewichten anbringt, wie Fig. 9. zeigt.
Zum Hin- und Hertreiben des Schuͤzens dient die an beiden Enden der
Lade angebrachte Vorrichtung, welche durch den Grundriß vom rechten Fluͤgel
der Lade, Fig.
5., durch die perspektivischen Ansichten, Fig. 6 und 8., und durch die
Profil-Zeichnung, Fig. 7. dargestellt ist.
Dabei ist, a, ein duͤnnes Brettchen, welches
hinter der Bahn liegt, und in die Arme der Lade eingelassen ist. Es ist
verschiebbar, damit es nach der jedesmahligen Laͤnge des Riethblatts gestellt
werden kann, an welches es dicht anstoßen muß. b, ist
eine auf der Bahn befestigte Leiste, welche dem Schieber, a, gegenuͤber stehet, und nach der Breite des zu webenden Tuchs
ihren Stand erhaͤlt. Sie ist an dem einem Ende abgerundet, damit der
Schuͤze ohne Anstoß in den Raum, c, gelangen
kann. Ueber dem Schieber, a, liegt die eiserne Schiene,
d, welche durch die Schraubenbolzen, e, e, an den Armen der Lade befestigt ist. Sie hat
mehrere Loͤcher, um sie nach der Breite des zu webenden Tuchs vor-
oder ruͤkwaͤrts stellen zu koͤnnen. An den umgebogenen Enden
der Schiene ist die runde eiserne Stange, f, befestigt,
welche gut geschliffen und polirt seyn muß, damit der Treiber, g, sich leicht auf derselben hin- und herschieben
lasse. Dieser Treiber haͤngt frei auf der Stange, f, wie Fig. 7. zeigt, und wird von zaͤhem und nicht zu schwerem Holz, als
Birken oder Ahorn, angefertigt. Fig. 8. gibt ein
deutliches Bild von seiner Gestalt, wobei, h, die nach
dem Schuͤzen zugekehrte Seite darstellt, an welcher der Einschnitt zu sehen
ist, in welchen ein Stuͤk starkes Sohlleder, i,
hineingeschoben wird. Er ist mit vier runden Loͤchern durchbohrt; durch das
oberste gehet die Stange, f, in dem darunter liegenden
kleinern wird die Schnur,
k, Fig. 6. befestigt: das in
dem Einschnitte angebrachte groͤßere Loch wird mit Filzscheiben, Kork, oder
mit einem anderen elastischen Koͤrper ausgefuͤllt. Das in der vorderen
Seite angebrachte Loch dient theils zur Verminderung des Gewichtes, theils dazu, den
zur Befestigung der Schnur, g, dienenden Knoten
aufzunehmen. Das Leder, i, so wie der dahinter liegende
Kork, vermindert den harten Schlag beim Auffangen und Fortschnellen des
Schuͤzens, auch muß zu diesem Zweke die Stange, f, an ihrem Ende bei, J, mit Tuch, Filz, oder Kork
umgeben werden.
Fig. 5. zeigt
uͤbrigens noch im Grundrisse die Lage der Bahn, m, auf dem darunter befindlichen Ladenbaum, so die die Ruthe, n, in welcher das Rieth stehet. Diese Ruthe ist nicht,
wie gewoͤhnlich, in den Ladenbaum hinein gearbeitet, sondern bildet sich
durch die vorstehende Bahn und durch die auf den Ladenbaum geleimte Leiste, o, welche den inneren Raum zwischen den Ladenarmen
einnimmt. Sie ist nach der aͤußern Seite abgerundet, wie Fig. 7. zeigt, um die
Reibung der uͤber ihr liegenden Kettfaͤden zu vermindern.
Der Schnellschuͤze selbst ist hier nicht abgebildet. Es wird davon in
Zusammenstellung mit allen uͤbrigen Arten von Schnellschuͤzen
besondere Zeichnung und Beschreibung erscheinen.
Tafeln