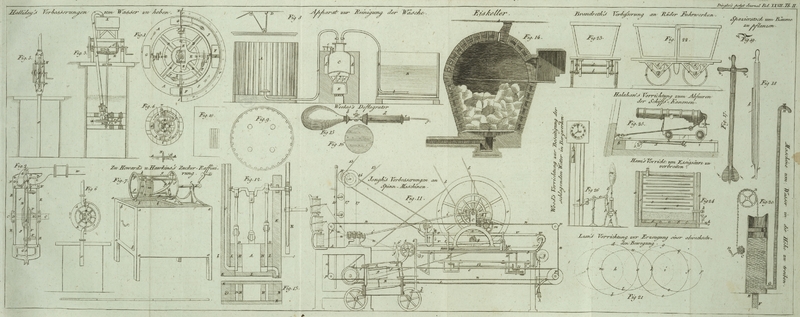| Titel: | Verbesserung im Heben oder Treiben des Wassers, worauf Franz Halliday, Esqu., zu Ham, sich am 25. August 1826 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 27, Jahrgang 1828, Nr. VIII., S. 19 |
| Download: | XML |
VIII.
Verbesserung im Heben oder Treiben des Wassers,
worauf Franz Halliday,
Esqu., zu Ham, sich am 25.
August 1826 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent Inventions. Novbr. 1827.
S. 261.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Halliday's Verbesserung im Heben oder Treiben des
Wassers.
Diese Verbesserungen, Wasser zu heben oder zu treiben, lassen
sich vorzuͤglich an jenen Maschinen anwenden, die man drehbare hydraulische
Maschinen nennt, und mit welchen dann, wenn sie von Dampfmaschinen, Wind, Wasser
oder von Thieren oder Menschen getrieben werden, Wasser in ununterbrochenem Strome
durch die unmittelbare Einwirkung gewisser Theile gehoben oder getrieben wird,
welche sich innerhalb einer Kammer oder eines geschlossenen Gefaͤßes in einem
Kreise so bewegen, daß sie gegen das Wasser wirken, dasselbe aus der Kammer
austreiben, und durch die Roͤhren in die Hoͤhe heben.
Fig. 1. ist
ein Grundriß dieser sich drehenden Maschine, Fig. 2. ein Seitenaufriß.
A, A, ist ein sich drehendes, auf der Achse, C, befestigtes Rad. Diese Achse hat zwei Haͤlse
oder Zapfen, die in Lagern, D, D, liegen, und frei auf
denselben laufen. Ein Ende der Achse, C, laͤuft
uͤber das Lager, D, aus, und die Kraft, welche
die Maschine in Bewegung sezt, wird an diesem hervorstehenden Ende der Achse
angebracht, um das Rad, A, in ununterbrochener
kreisfoͤrmiger Bewegung umher zu drehen. Das Rad, A, hat in seinem Mittelpuncte einen Knopf, der auf der Achse, C, befestigt ist, und vier oder mehr Arme, B, B, die sich von diesem Knopfe aus bis zu dem breiten
kreisfoͤrmigen Rande, A, A, der an seinen beiden
gegenuͤberstehenden Flaͤchen genau flach abgedreht ist, und an seiner
Kante genau einen Kreis bildet, hin erstreken.
An dem kreisfoͤrmigen Rande, A, A, sind vier oder
mehrere Oeffnungen, F, F, F, F, angebracht, zur Aufnahme
von eben so vielen vierekigen oder laͤnglichen Fluͤgeln der
Staͤmpel, G, G, G, G, die genau in diese
Oeffnungen passen, so daß sie dieselben ausfuͤllen und genau sich in die
flachen Flaͤchen zu beiden Seiten des Randes so einlegen, als wenn gar keine
Oeffnungen in diesem Rande waͤren, und dieser aus Einem Stuͤke
bestuͤnde. Jeder dieser Staͤmpel, G, ist
in seiner Oeffnung, F, mittelst einer Spindel oder Achse
der Bewegung, g, die durch die Dike des Randes, A, und des Staͤmpels, G, in der Richtung nach dem Mittelpuncte der Achse, C, laͤuft, eingelassen.
Die Spindel fuͤr den Staͤmpel, G, ist so in
Stiefeln, welche sich in dem Rande, H, H, zu jeder Seite
der Oeffnung, F, (in welche der Staͤmpel, G, paßt) befinden, vorgerichtet, daß dieser
Staͤmpel sich mit der Spindel, g, als Achse der
Bewegung, zugleich drehen kann, so daß der Staͤmpel, g, mit seiner Flaͤche senkrecht oder unter rechten Winkeln auf die
Flaͤche des Randes, A, A, zu stehen kommt, in
welcher Lage dann der Staͤmpel zu jeder Seite des flachen
kreisfoͤrmigen Randes hervorsteht, so daß er seine flache Flaͤche dem
Wasser darbietet, auf welches er wirken soll. Derselbe Staͤmpel kann auch so
durch seine Spindel oder Achse, g, gedreht werden, daß
er, indem er einen Viertelkreis beschreibt, in seine vorige Lage und in seinen Plaz
in der Oeffnung, F, im Rande, A,
A, gelangt, diese ausfuͤllt, und dann mit der flachen Flaͤche
dieses Randes eine und dieselbe Ebene bildet, so daß er dem Wasser, welches gehoben
werden soll, gar keine Flaͤche oder gar keinen Widerstand darbietet. Die
Staͤmpel, G, wirken gegen das Wasser in einer
halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, die einen Canal
bildet, der sich auf die Haͤlfte (oder daruͤber) des Randes, A, A, um diesen herum erstrekt und so gekruͤmmt
ist, daß er mit dem Kreise, den dieser bildet, correspondirt.
Die Staͤmpel, G, G, sind sehr genau in die
halbkreisfoͤrmige Kammer, J, J, eingepaßt, so,
daß sie den Querdurchschnitt derselben genau ausfuͤllen, so oft sie so
gedreht werden, daß sie mit ihren flachen Flaͤchen senkrecht auf die
Flaͤche des Rades, A, A, zu stehen kommen; d.h.
der aͤußere Rand oder der Umriß eines jeden Staͤmpels, G, ist genau eben so groß und von derselben Gestalt, wie
der Querdurchschnitt der Kammer, J, J, so daß er genau
in dieselbe paßt und eine bewegliche Scheidewand in derselben bildet. Diese
Scheidewand ist im Stande, gegen das Wasser zu wirken, mit welchem diese Kammer
ausgefuͤllt ist, so daß dasselbe von ihr aus dieser Kammer durch die
armfoͤrmige Drukroͤhre, L, L, welche mit
einem Ende der Kammer, J, in Verbindung steht,
ausgetrieben wird. Dieses Ende dieser Kammer wird von dem Dekel, N, geschlossen, welcher mittelst Schraubenbolzen an
einem hervorstehenden Rande am Ende der Kammer befestigt wird. Die Arme, L, L, der Drukroͤhre ragen aus dem Ende des
Dekels, N, hervor, und vereinigen sich mit einander, um
eine gemeinschaftliche Roͤhre zu bilden, an welche die aufsteigende
Drukroͤhre, w, x, angefuͤgt wird.
Die Kante des flachen kreisfoͤrmigen Randes des Rades, A, laͤuft zwischen den beiden Armen, L,
L, der Drukroͤhre, durch eine schmale Oeffnung in dem Enddekel, N, und der Rand, A,
fuͤllt diese Oeffnung so genau aus, daß das Wasser dadurch nicht durch kann,
und nicht anders aus
derselben entweichen kann, als durch die Arme, L, L,
obschon das Rad sich frei darin drehen kann; und wenn die verschiedenen
Staͤmpel, G, seitwaͤrts (nach ihrer Kante)
gedreht sind, so daß sie sich in die Oeffnungen, F, in
dem kreisfoͤrmigen Rande des Rades zuruͤkziehen, bieten sie kein
Hinderniß in der Bewegung oder in dem Durchgange des Rades durch diese schmale
Oeffnung in dem Dekel, N, der Kammer, J, dar.
Fig. 3. zeigt
die Art, wie diese Maschine im Grunde eines Brunnens oder Wasserbehaͤlters,
aus welchem das Wasser in eine daruͤber befindliche Cisterne, X, gehoben werden soll, angebracht wird, und Fig. 4. ist ein
mit Fig. 3.
correspondirender Grundriß. Die Maschine ist unter der Oberflaͤche des
Wassers in dem Brunnen angebracht. Das kreisfoͤrmige Rad, A, A, wird in eine horizontale Lage gebracht, so daß
seine Achse, C, senkrecht steht. Die
halbkreisfoͤrmige Kammer, J, J, hat Stangen, E, E, die quer durch dieselbe laufen, so daß sie einen
Rahmen bilden, welcher die Lager, D, D, traͤgt,
von welchem die Zapfen der senkrechten Achse getragen werden. Die
halbkreisfoͤrmige Kammer mit ihren Querstangen bildet den feststehenden Theil
der Maschine, und ist auf gehoͤriger hoͤlzerner Zimmerung im Grunde
des Brunnens wohl befestigt. Die Achse, C, welche durch
ein angefuͤgtes Laͤngenstuͤk derselben, r, verlaͤngert ist, welches bis oben an den Brunnen hinaufreicht,
fuͤhrt ein Rad, R, an dieser
Verlaͤngerung, welches von dem Triebstoke, S,
getrieben wird, der auf einer horizontalen Achse, s,
befestigt ist. Diese Achse kann von einem Manne gedreht werden, der eine Kurbel an
dem einen Ende derselben dreht: an dem anderen ist ein Flugrad angebracht, wodurch
die Bewegung gleichfoͤrmig gemacht wird. Das sich drehende Rad wird auf diese
Weise mit Kraft und in einer solchen Richtung getrieben, daß die Staͤmpel bei
dem offenen Ende der halbkreisfoͤrmigen Kammer hinein fahren, und bei dem
geschlossenen Ende derselben herauskommen. Wenn die Staͤmpel bei dem offenen
Ende der halbkreisfoͤrmigen Kammer hineinfahren, muͤssen sie unter
rechten Winkeln auf die Flaͤche des Rades stehen, so daß sie die
halbkreisfoͤrmige Kammer ausfuͤllen, und waͤhrend sie sich in
derselben der Laͤnge nach hinbewegen, das in derselben enthaltene Wasser vor
sich her treiben, welches dann durch die armfoͤrmige Roͤhre, L, L, in die aufsteigende Drukroͤhre, w, x, steigt, mittelst welcher es in die obere Cisterne,
X, gehoben wird.
Da das Rad immer ununterbrochen vorwaͤrts getrieben wird, so wird ein
ununterbrochener Wasserstrom durch dasselbe gehoben, indem, ehe ein Staͤmpel
die ganze Laͤnge der halbkreisfoͤrmigen Kammer durchlief und dieselbe
verließ, ein anderer nachfolgender Staͤmpel bei dem offenen Ende dieser
Kammer bereits eingetreten ist, und das Wasser wieder vor sich hertreibt. Nachdem jeder Staͤmpel
auf diese Weise beinahe durch die ganze Laͤnge der halbkreisfoͤrmigen
Kammer durchging, und nahe an das geschlossene Ende, N,
oder den Dekel derselben kam, wird jeder Staͤmpel nach seiner Kante in seine
Hoͤhlung in dem Rade, A, gedreht, damit er in
dieselbe Ebene mit der Flaͤche des Randes des Rades zu liegen kommt, und nach
seiner Kante durch die schmale Oeffnung in dem Enddekel, N, der halbkreisfoͤrmigen Kammer durchkann, ohne dem Wasser durch
dieselbe irgend einen Ausweg zu gestatten. Um die Staͤmpel in dem
gehoͤrigen Augenblike so nach ihrer Kante zu drehen, ist eine Walze oder ein
kleines Rad, das man in Fig. 1. sieht, innerhalb
der halbkreisfoͤrmigen Kammer in einer solchen Stellung angebracht, daß
dadurch der obere Theil eines jeden Staͤmpels gefangen wird, wenn dieser in
die Naͤhe des geschlossenen Endes der Kammer gelangt, und da der
Staͤmpel mit dem Rade in der kreisfoͤrmigen Bewegung desselben unter
dieser Walze umhergetrieben wird, wird er in die Flaͤche des Randes
hineingedreht oder hineingedruͤkt. Diese Walze ist auf einem feststehenden
Centralstifte aufgezogen, der von einem kleinen Boke getragen wird, welcher an dem
Enddekel, N, innerhalb desselben befestigt ist und
soweit in die Kammer hervorragt, daß die Staͤmpel von dieser Walze oder von
dem Rade aufgefangen und zu gehoͤriger Zeit dadurch seitwaͤrts gedreht
werden.
Die armfoͤrmige Roͤhre, L, welche aus dem
Dekel, N, der halbkreisfoͤrmigen Kammer
heraustritt, ist so angebracht, daß sie das Wasser aus dem unteren Theile dieser
Kammer unter der Flaͤche des Rades, A, durch
einen ihrer Arme leitet, waͤhrend der andere Arm das Wasser aus dem oberen
Theile der Kammer uͤber dieser Flaͤche des Rades fortfuͤhrt.
Der Theil, wo die beiden Arme sich in eine Roͤhre, w, vereinigen (so wie die beiden Roͤhren selbst), muß von
hinlaͤnglicher Weite seyn, um dem Wasser geraͤumigen Durchgang zu
lassen. In dieser Roͤhre ist eine Klappe angebracht, die bei, z, sich abwaͤrts schließt, so daß das Wasser
nicht zuruͤk kann, wenn die Maschine still steht. So lang die Maschine
hingegen arbeitet, ist die Klappe immer offen, und wirkt nicht, indem ununterbrochen
ein Strom Wassers durchzieht. Nachdem die Staͤmpel nach ihrer Kante durch die
schmale Oeffnung in dem Enddekel, N, der
halbkreisfoͤrmigen Kammer durchgegangen sind, muͤssen sie wieder so
gedreht werden, daß sie unter rechten Winkeln auf der Flaͤche des Rades, A, A, zu stehen kommen, und so vorbereitet werden, bei
dem offenen Ende der Kammer wieder einzutreten, und eine neue Menge Wassers vor sich
her zu treiben. Zu diesem Ende fuͤhrt die Achse, g, eines jeden Staͤmpels einen kurzen Hebel oder Griff, h, welcher auf dem aͤußersten Ende desselben
innerhalb des Randes des Rades, A, befestigt ist, und
jeder dieser Hebel, h, ist mit einer Walze oder mit einem kleinen Rade an
seinem Ende versehen, welche Walze sich gegen eine feststehende
Leitungs-Stange, P, P, (wenn das Rad gedreht
wird) anlegt.
Diese Leitungs-Stange, P, P, ist so
gekruͤmmt, daß sie concentrisch mit einem Kreisbogen ist, der um den
Mittelpunct oder die Achse der Bewegung, C, umschrieben
wird, so daß die Walzen der Hebel, h, h, wenn sie in
ihrer kreisfoͤrmigen Bewegung umhergefuͤhrt werden, sich an die
besagte gekruͤmmte Stange, P P, anlegen, welche
in der Naͤhe ihres Endes auch so nach außen gekruͤmmt ist, daß die
Walzen davon gedreht werden, und dadurch auch die Staͤmpel, G, in die gehoͤrige Lage kommen, um gegen das
Wasser wirken zu koͤnnen, ehe jeder in die halbkreisfoͤrmige Kammer,
J, J, eintritt; d.h. jeder Hebel, h, ist auf der Achse oder Spindel, g, in einer Querrichtung, oder unter rechten Winkeln auf
die Flaͤche des Staͤmpels selbst befestigt; folglich wird, wenn dieser
Staͤmpel nach der Kante gedreht wird, so daß er sich in die Flaͤche
des kreisfoͤrmigen Randes, A, A,
zuruͤkzieht, um aus der Kammer, J, J, durch den
Endedekel, N, auszutreten, die Richtung der
Laͤnge des Hebels, h, nach außen von der
Flaͤche des Rades, A, A, vorstehen, so daß sie
einen rechten Winkel mit der Flaͤche desselben bildet, und parallel auf die
Achse, C, ist. Der Hebel, h,
und die Walze desselben bleiben in diesem Zustande, bis der Staͤmpel die
Kammer, J, J, vollkommen verlassen hat. Ehe der
Staͤmpel aber in das offene Ende der Kammer, J,
J, zuruͤk tritt, faͤngt das gekruͤmmte Ende der
befestigten Leitungs-Stange, P, die Walze auf,
und da Walze und Hebel in ihrer kreisfoͤrmigen Bewegung mit dem Rade, A, A, vorwaͤrts gefuͤhrt werden, treibt
die Kruͤmmung von jenem Ende der besagten Leitungsstange, P, die Walze und den Hebel, h, seitwaͤrts, so daß sie den Staͤmpel um seine Achse, g, in einem Viertelkreise dreht, um den Staͤmpel,
C, senkrecht quer uͤber die Flaͤche
des Rades auf eine solche Weise zu stellen, daß dieser in das offene Ende der
halbkreisfoͤrmigen Kammer eintreten kann. Dieses offene Ende ist an seinem
aͤußeren Theile etwas erweitert, so daß die Muͤndung etwas
glokenfoͤrmig wird, damit der Staͤmpel leichter eintreten kann. Wenn
der Staͤmpel aber in der halbkreisfoͤrmigen Kammer etwas vorgedrungen
ist, fuͤllt der Rand des Staͤmpels genau den Querdurchschnitt der
halbkreisfoͤrmigen Kammer so aus, daß kein Wasser an den Kanten
durchkann.
Anmerkung.
Die Staͤmpel koͤnnen auch nach ihrer Kante in die Flaͤche des
Rades mittelst einer anderen befestigten Leitungs-Stange gebracht werden, die
der mit, P, P, bezeichneten aͤhnlich ist, statt
mittelst des obenerwaͤhnten Rades oder des angefuͤhrten Rades
innerhalb der kreisfoͤrmigen Kammer. In diesem Falle muß die Achse, g, eines jeden Staͤmpels, G, einen
anderen Hebel auf sich haben, der dem Hebel, h,
aͤhnlich, aber so befestigt ist, daß er in einer Querrichtung, oder unter
einem rechten Winkel darauf steht. Die Walzen an den Enden dieser Extra-Hebel
muͤssen auf der kreisfoͤrmigen Krummen der
Extra-Leitungs-Stange laufen, die an der entgegengesezten Seite des
Rades, A, befestigt seyn muß, d.h. auf der der Seite, an
welcher die zuerst erwaͤhnte Leitungsstange, P,
befestigt war, gegenuͤberstehenden Seite. Das Ende der besagten
Extraleitungs-Stange muß gekruͤmmt oder seitwaͤrts von der
Flaͤche des Kreises, welchen das Rad bei seiner Umdrehung beschreibt, gebogen
seyn, so daß das besagte gekruͤmmte Ende der Leitungs-Stange die Walze
des Extra-Hebels, h, zur gehoͤrigen Zeit
und auf eine solche Weise faͤngt, daß der Staͤmpel nach der Kante in
die Flaͤche des Rades gedreht wird, so oft der besagte Staͤmpel nahe
an das geschlossene Ende, N, der
halbkreisfoͤrmigen Kammer kommt, damit der Staͤmpel nach der Kante
durch die enge Oeffnung in dem Endedekel, N, durchlaufen
kann. Die Raͤder, R, und, S, welche die hydraulische Maschine in Bewegung sezen, sind sehr bequem,
wenn die Maschine durch die Hand in Bewegung gesezt wird, um das Wasser aus dem
Brunnen zu heben, oder in obere Stokwerke hinauszuschaffen, oder aus
Schiffsraͤumen aufzupumpen, und auch bei Feuer- und Gartensprizen.
Fuͤr groͤßere Wasserwerke und Fabriken kann diese Maschine durch Pferde
oder Ochsen an einem Gestaͤnge (einer Reihe von Hebeln, die an dem oberen
Ende der Achse angebracht ist, und dadurch eine kreisfoͤrmige Bewegung ohne
alles Raͤderwerk mittheilt) oder durch eine Dampfmaschine in Bewegung gesezt
werden, indem man die Hauptwelle derselben mit der Hauptachse dieser Maschine
entweder mittelst eines Zahnraͤder-Werkes oder auf eine andere Weise
in Verbindung sezt. Die halbkreisfoͤrmige Kammer, J,
J, besteht aus zwei Haͤlften oder aus zwei aͤhnlichen
Theilen, wovon der eine nach der Flaͤche in Fig. 1., und beide nach
der Kante oder Seite in Fig. 2. dargestellt sind.
Jede Haͤlfte hat einen flachen, an der convexen Kante derselben
Hervorstehenden Rand, r, mittelst dessen sie durch
Schraubenbolzen, welche durch beide Raͤnder, r,
laufen, zusammengehalten werden. Eine kreisfoͤrmige Vertiefung findet sich in
den Flaͤchen dieser hervorstehenden Raͤnder dort, wo sie sich mit
einander verbinden, so daß eine Art von Umschlag oder Furche innerhalb der
halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, entsteht, die
von groͤßerem Durchmesser ist, als der innere Raum dieser Kammer, und zur
Aufnahme des aͤußersten Umfanges des Rades, A, A,
dient, oder jedes Theiles, der uͤber die Oeffnungen, F, F, hervorragt, in welchen die Staͤmpel eingeschlossen sind.
Diese kreisfoͤrmige Furche, Vertiefung oder Oeffnung ist genau so breit und
dik, als die Peripherie des Rades, A, A, so daß sie in
dieselbe paßt; und wenn diese Theile sich durch Reibung abnuͤzen, lassen die
flachen Oberflaͤchen der Raͤnder, wo sie an einander anliegen, sich
verduͤnnen, so daß die beiden Haͤlften einander naͤher kommen,
und wieder an die Peripherie des Rades anschließen. Die halbkreisfoͤrmige
Kammer, J, J, laͤuft um den halben Theil des
Rades, A, A; wenn man die beiden Haͤlften dieser
Kammern, J, J, verfertigt, so muͤssen beide
mittelst ihrer hervorstehenden Raͤnder, I, I,
verbunden werden, so daß sie einen ganzen kreisfoͤrmigen Canal bilden, dessen
innere Flaͤchen auf einer Drehebank vollkommen genau zugedrehet werden
muͤssen. Diese beiden von einander getrennten Theile werden dann
zusammengefuͤgt, ein Theil dem anderen gegenuͤber, um die
halbkreisfoͤrmige Kammer, J, J, zu bilden, und
werden dann innenwendig genau passen. Das kreisfoͤrmige Rad, A, A, hat einen kreisfoͤrmigen Rand, a, a, der zu beiden Seiten uͤber die flache
kreisfoͤrmige Flaͤche, A, A, emporsteht,
und diese hervorstehenden Raͤnder passen genau in den concaven Rand eines
jeden Segmentes der halbkreisfoͤrmigen Kammer, J,
J, so daß kein Wasser aus der halbkreisfoͤrmigen Kammer heraus kann.
In jeder Seite des Rades sind dort, wo der kreisfoͤrmige erhabene Rand
derselben eintritt, zwischen den beiden Haͤlften der
halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, die Kanten der
Staͤmpel, G, G, sehr genau in das Innere der
halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, eingepaßt,
ebenso auch in die Oeffnungen in dem kreisfoͤrmigen Rande, A, A; es koͤnnen auch Furchen um die Kanten der
Staͤmpel-Dike angebracht seyn, in welchen Leder, Hanf u. d. gl.
aufgenommen wird, fuͤr den Fall naͤmlich, wo es noͤthig ist,
die Gefuͤge vollkommen wasserdicht zu erhalten, und alle Entweichung des
Wassers zu hindern.
Fig. 5. und
6. zeigt
eine sich drehende hydraulische Maschine, um Wasser sowohl durch Aufsaugen, als
durch Druk in die Hoͤhe zu treiben. In diesem Falle haben beide Enden der
halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, ihre Dekel, die
sie schließen, wie, N, und, n, zeigt, so daß diese Kammer kein offenes Ende hat, und der Rand des sich
drehenden Rades, A, A, laͤuft durch die enge
Oeffnung in den Dekeln, so genau in dieselbe passend, daß kein Wasser entweichen
kann. Die Staͤmpel muͤssen in jedem Falle nach der Kante in die
Flaͤche des Rades, gedreht seyn, damit sie durch diese Oeffnungen
durchkoͤnnen, und jeder Staͤmpel muß, so lang er außer der Kammer ist,
naͤmlich von der Zeit an, wo er aus dem geschlossenen Ende der Kammer, N, heraustritt, bis er wieder in dieselbe
zuruͤkgekehrt und in das andere Ende der Kammer eingetreten ist, nach der
Kante gerichtet bleiben. Sobald aber jeder Staͤmpel durch die enge Oeffnung
des geschlossenen Endes der Kammer durch und in dieselbe eingetreten ist, wird
dieser Staͤmpel mittelst des Hebels, h, und der
Leitungsstange, P, nach seiner Flaͤche so
gekehrt, daß er das Wasser vor sich her treibt, und nachdem er dieß gethan hat, und
nahe an das andere Ende
der Kammer gekommen ist, wird er wieder nach der Kante gedreht, um aus der
halbkreisfoͤrmigen Kammer mittelst der Walze oder auch mittelst der
erwaͤhnten Extraleitungs-Stange innerhalb derselben auf die
beschriebene Weise austreten zu koͤnnen. Die beiden Arme der
Saugroͤhre, x, sind mit jenem Ende des Dekels der
halbkreisfoͤrmigen Kammer verbunden, durch welches die Staͤmpel in
diese Kammer treten, und die beiden Arme der Drukpumpe sind mit dem anderen
Endedekel verbunden, durch welchen die Staͤmpel aus der Kammer laufen. Die
hydraulische Maschine in Fig. 5. und 6., die eine
Saugpumpe zum Aufziehen des Wassers hat, braucht nicht unter das Wasser getaucht zu
seyn, wie die Maschinen in 3 und 4, sondern kann in jede bequem zugaͤngige
Lage gebracht werden. Was die Groͤßen der hier gezeichneten Maschinen
betrifft, so ergeben sie sich aus dem Maßstabe; sie koͤnnen aber auch nach
Umstaͤnden abgeaͤndert werden, so wie das Materiale, aus welchem die
Maschine gebaut ist. Die Maschine kann, je nach ihrer Groͤße, 3, 4, 6
Staͤmpel, G, fuͤhren, und die Kammer, J, J, muß von solcher Groͤße seyn, oder einen
solchen Theil von dem Rade, A, A, umfassen, daß ein
Staͤmpel leicht in diese Kammern eintreten und darin laufen kann, ehe der
andere austritt, so daß immer einer der nachfolgenden Staͤmpel sich in einer
Lage befindet, das Wasser vor sich her zu treiben. Die Staͤmpel, G, koͤnnen kreisfoͤrmig, oval oder von
irgend einer anderen Form, vierekig oder laͤnglich seyn, vorausgesezt, daß
die Oeffnung, F, in dem kreisfoͤrmigen Rande, A, A, und der Querdurchschnitt der inneren Kammer die
dazu gehoͤrige Form hat.An welchem Werke ist diese Maschine im Gange? A. d. U.
Tafeln