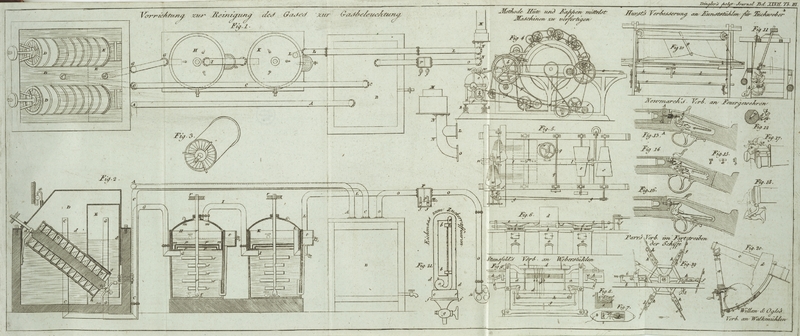| Titel: | Verbesserung an den Kunststühlen der Tuchweber, worauf Wilh. Hurst, Fabrikant, und Georg Bradley, Maschinen-Verfertiger, beide zu Leeds in Yorkshire, sich am 16. Julius 1825 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 27, Jahrgang 1828, Nr. XXIV., S. 81 |
| Download: | XML |
XXIV.
Verbesserung an den Kunststuͤhlen der
Tuchweber, worauf Wilh.
Hurst, Fabrikant, und Georg Bradley, Maschinen-Verfertiger,
beide zu Leeds in Yorkshire, sich am 16. Julius 1825 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem London Journal of Arts. October.
1827.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
[Hurst und Bradley's, Verbesserung an den Kunststuͤhlen der
Tuchweber.]
In diesem Patente kommen zwei Dinge zu beachten: 1) der
Schlaghebel, durch welchen das Schiffchen hin und her geschnellt wird zwischen der
Kette; 2) ein sich drehendes Muschelrad, welches so vorgerichtet ist, daß die Lade
zwei schnelle Schlaͤge hinter einander auf den Eintrag macht, was an
Tuͤchern so sehr zu wuͤnschen ist.
Fig. 10. Tab.
III. zeigt diesen Kunststuhl von vorne. a, ist die
Hauptachse, welche von einer Dampfmaschine, oder auf irgend eine andere Weise, in
Umtrieb gesezt wird, und alle anderen Theile des Stuhles treibt. Fig. 11. ist ein
senkrechter Durchschnitt des Stuhles unter einem rechten Winkel mit Fig. 10. b, ist ein gekruͤmmter Hebel in der Naͤhe
des Endes des Stuhles, welcher sich auf einem Zapfen, c,
als um seinen Stuͤzpunct dreht. d, ist ein Arm an
der Hauptachse, a, welcher als Daͤumling wirkt,
und gegen den gekruͤmmten Hebel anschlaͤgt, so wie die Hauptachse sich
dreht. Die senkrechte Stange, e, ist an ihrem unteren
Ende mit diesem gekruͤmmten Hebel verbunden, und an ihrem oberen Ende an
einer Schnur befestigt, die uͤber die Rolle, f,
zu dem Schlaghebel, g, laͤuft.
Ein aͤhnlicher Apparat, wie dieser, wird auch an dem entgegengesezten Ende des
Stuhles angebracht, und die Schnur von dem Schlaghebel, die uͤber eine andere
Rolle laͤuft, ist an einer anderen senkrechten Stange, e, befestigt, wie diese unten an einem aͤhnlichen
gekruͤmmten Hebel.
Durch die Umdrehung der senkrechten „(horizontalen!)“ Achse, a, wird der Arm oder Daͤumling, d, umgetrieben, und schlaͤgt auf das obere Ende
des gekruͤmmten Hebels, b, der sich auf seinem
Stuͤzungs-Zapfen dreht, sein umgekehrtes Ende in die Hoͤhe
wirft, und einen daran befestigten Stift in einen Ausschnitt in dem Sperrkegel, h, treibt, so daß der gekruͤmmte Hebel in die
durch die Puncte angedeutete Lage kommt. Durch die weitere Umdrehung der Achse kommt
der Daͤumling, d, in Beruͤhrung mit dem
Ende des Sperrkegels, h, lezterer wird gehoben, und der Stift des gekruͤmmten
Hebels dann frei, so daß
dieser mit bedeutender Kraft niederfaͤllt, wozu das Gewicht, i, beitraͤgt, und im Fallen die Stange, e, niederzieht, die damit verbunden ist, welche die
Schnur zieht, und so den Schlaghebel, g, in rasche und
kraͤftige Bewegung sezt, wodurch das Schiffchen schnell durch die Kette
geworfen wird.
Ein correspondirender Daͤumling ist in entgegengesezter Richtung an dem
gegenuͤberstehenden Ende der Hauptachse angebracht, und wirkt auf
aͤhnliche Weise auf den gekruͤmmten Hebel, wodurch das Schiffchen
wieder zuruͤkgeschnellt wird.
Auf einem Nebenschafte, h, der durch eine Reihe von
Zahnraͤdern getrieben wird, ist ein anderes Muschelrad, l, dessen Form man in Fig. 11. sieht. Dieses
Muschelrad wirkt gegen eine Reibungs-Walze, m,
die an der unteren Seite der Lade, n, angebracht ist.
Beinahe der dritte Theil des Umfanges dieses Muschelrades ist ein concentrischer
Kreis, welcher, wenn er gegen die Reibungs-Walze unter der Lade wirkt,
dieselbe zuruͤk haͤlt, um Zeit fuͤr den Durchlauf des
Schiffchens zu gewinnen. Wie dieser kreisfoͤrmige Theil von der Walze frei
wird, faͤllt die Lade mit bedeutender Gewalt, und gibt den Schlag, wodurch
der Eintrag eingeschlagen wird. Unmittelbar darauf hebt der spizige Theil des
Muschelrades, so wie es sich, weiter umdreht, die Lade wieder, und laͤßt sie
geradezu fallen, so daß der Eintrag einen zweiten Schlag erhaͤlt, was bei der
Tuchweberei aͤußerst wichtig ist.
Tafeln