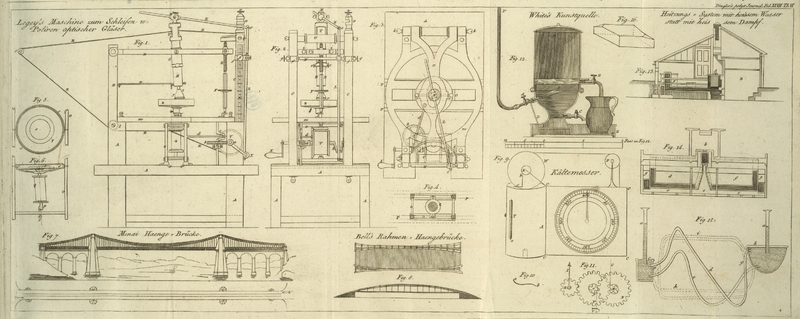| Titel: | Beschreibung einer Maschine zum Schleifen und Poliren optischer Gläser, von der Erfindung des Hrn. Legey, Verfertiger mathematischer Instrumente, rue de la Planche, N. 12 zu Paris. |
| Fundstelle: | Band 27, Jahrgang 1828, Nr. LXIV., S. 254 |
| Download: | XML |
LXIV.
Beschreibung einer Maschine zum Schleifen und
Poliren optischer Glaͤser, von der Erfindung des Hrn. Legey, Verfertiger mathematischer Instrumente,
rue de la Planche, N. 12 zu Paris.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement, N. 280, S. 339.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Legey's Maschine zum Schleifen und Poliren optischer
Glaͤser.
Das gewoͤhnliche Verfahren bei dem Schleifen optischer
Glaͤser besteht darin, daß man sie in convexen oder concaven Beken, je
nachdem sie naͤmlich concav oder convex werden sollen, abreibt. Diese Beken
werden auf der Drehebank abgedreht, wo sie den gehoͤrigen Grad von
Woͤlbung erhalten, welchen man dem Glase geben will. Das Gelingen dieser Art
des Schliffes ist hoͤchst ungewiß. Die Woͤlbung des Bekens leidet sehr
bald durch die Reibung des Glases und des Schmergels; ja es geschieht nicht selten,
daß, nachdem man die erste Arbeit, die man das Schleifen
(Doucir) nennt, gluͤklich vollendet hat, die
Woͤlbung des Glases durch die Politur leidet, indem man bei dem Poliren auf
die Oberflaͤche des Bekens einen weichen Koͤrper, wie z.B. Papier,
legen muß.
Aergerlich uͤber den Ungewissen Erfolg dieser Arbeit, zumahl bei
achromatischen Objectivglaͤsern, die die hoͤchste Genauigkeit
erfordern, hat die Société d'Encouragement
im J. 1820 die Aufmerksamkeit der Mechaniker auf diesen wichtigen Gegenstand
geleitet, und einen Preis von 2,500 Franken fuͤr
Verfertigung einer Maschine ausgeschrieben, die den optischen Glaͤsern
eine beliebige Woͤlbung gibt und sie polirt, ohne diese Woͤlbung
im Mindesten zu
veraͤndern. Diese Aufgabe schien um so weniger schwierig zu
loͤsen, als der beruͤhmte Optiker zu Muͤnchen, Hr. von Reichenbach, mit dem besten
Erfolge sich gewisser mechanischer Vorrichtungen hierzu bediente, und es sich nur
darum handelte, eine Maschine vorzurichten, die dasselbe leistete.
In den ersten Jahren blieben diese Wuͤnsche der Gesellschaft ohne Erfolg. Die
Preiswerber sandten theils nur sehr kleine Modelle, theils nur Versuche ohne alles
positive Resultat. Im J. 1825 war es indessen nahe daran, daß Hr. Stewart zu Bordeaux den Preis
gewonnen haͤtte. Dieser geschikte Mechaniker sandte eine sehr einfache
Maschine, die, bei einer in Gegenwart der Commissaͤre vorgenommenen
Pruͤfung sehr guͤnstig beurtheilt wurde, und ohne Zweifel den Preis
erhalten haben wuͤrde, wenn sie nicht in Hinsicht der Politur des Glases noch
etwas zu wuͤnschen uͤbrig gelassen haͤtte. Diese Maschine, die
gegenwaͤrtig in dem Conservatoir des arts et
métiers aufbewahrt ist, besteht in einer Art von senkrechter
Drehebank, die das Beken dreht, unter welchem das zu schleifende. Glas
aufgehaͤngt ist. Das Glas ist an einer Metallstange befestigt, deren
Laͤnge man nach Belieben abaͤndern kann, und laͤßt sich auf der
bekannten Cardan'schen Vorrichtung bewegen, deren Mittelpunct der Bewegung genau mit
dem sphaͤrischen Theile des Glases correspondirt, den man erzeugen will. Die
Maschine ertheilt, fuͤr sich selbst, dem Glase keine Bewegung; der Arbeiter
fuͤhrt dasselbe mit seiner Hand ganz nach der gewoͤhnlichen Weise, nur
daß er bei dieser neuen Vorrichtung weit weniger Geschiklichkeit noͤthig
hat.
In Erwartung, daß Hr. Stewart
seine Maschine verbessern, und wieder als Preiswerber auftreten wuͤrde,
verschob die Société die Vertheilung des
Preises auf das Jahr 1826, und belohnte ihn einstweilen mit der goldenen Medaille
als Beweis ihrer Zufriedenheit. Hr. Stewart kam aber nicht wieder, und das Jahr 1826 gab kein neues
Resultat. Dieß veranlaßte die Gesellschaft den Preis einzuziehen, und in ihrem
Bulletin Zeichnung und Beschreibung der von Hrn. v. Frauenhofer erfundenen, und in der
Werkstaͤtte des Hrn. v.
Reichenbach angewendeten, Maschine herauszugeben. Allein ihre
Bemuͤhungen, die Mittheilung der hierzu noͤthigen Papiere aus
Muͤnchen zu erhalten, blieben ohne Erfolg.
Indessen verdienen die Versuche mehrerer Kuͤnstler den Wuͤnschen der
Gesellschaft zu entsprechen, bekannt zu werden; und dieß veranlaßte dieselbe, die
Beschreibung der zeither vorgelegten Maschine des Hrn. Legey bekannt zu machen. Die Gesellschaft hat
zwar nur ein Modell; indessen arbeitet dasselbe mit solcher Leichtigkeit, daß sich
die gluͤklichsten Resultate von der Maschine selbst erwarten lassen.
Der Mechanismus, den Fig. 1, 2, 3, Taf. VI. im Grundrisse und Aufrisse darstellt, ist so eingerichtet,
daß die einfachste Anwendung irgend einer Triebkraft an einer Kurbel hinreicht, das
Glas zu drehen, indem sie dasselbe auf einer flachen Platte, die als Schleifstein
dient, so herumfuͤhrt, daß die Zuͤge sich kreuzen. Diese Platte dreht
sich im Kreise um sich selbst und senkrecht auf ihrer Achse hin und her. Mittelst
dieser vier Bewegungen, die auf eine eben so sichere als einfache Weise
ausgefuͤhrt werden, kommt jeder Theil des Glases nach und nach mit jedem
Theile des Modells in Beruͤhrung, und das Glas muß auf diese Weise
unvermeidlich die Form eines Theiles einer Kugel erhalten, welche dasselbe durch das
Poliren, das durch dieselben Bewegungen geschieht, nicht verlieren kann. Was den
Halbmesser betrifft, so laͤßt dieser sich auf die genaueste und leichteste
Weise nach Belieben bestimmen und festhalten.
Concave Glaͤser erhaͤlt man, wenn man in diesem Apparate das Glas an
die Stelle der flachen Platte, und einen gewoͤlbten Schleifstein an die
Stelle des Glases sezt, und die Bewegung des ersteren hin und her zur Kreuzung der
Zuͤge unterbricht.
Um flache Glaͤser zu erhalten, bringt man dieselben an dem Ende der Achse an,
welcher man nur ihre umdrehende Bewegung laͤßt, und nimmt wieder die
Schleifplatte, die ihre beiden Bewegungen, sowohl die drehende als jene hin und her,
fortsezt.
Die Commissaͤre haben gezweifelt, daß die lezten beiden Arten von
Glaͤsern auf dieser Maschine eben so gut gelingen koͤnnen, als die
Convexglaͤser, und dieß zwar wegen der Mittelpuncte der Stuͤke, die
sich drehen, die, da sie keine Bewegung haben, sich durch die Umdrehung allein nicht
abschleifen werden, sondern bloß durch die Bewegung hin und her, welche der eine der
wirkenden Theile besizt.
Hr. Legey hat diesen Nachtheil
dadurch beseitigt, daß er der unteren Achse, welche das Glas dreht, eine
excentrische Bewegung gab, und an einem der Haͤlse dieser Achse die
Cardan'sche Haͤnge-Vorrichtung anbrachte. Auf diese Weise verfertigt
die Maschine nun die concaven Glaͤser eben so genau, wie die convexen.
Die Maschine befindet sich in einem Gestelle, A, Fig. 1, 2. und 3, Taf. VI. Auf
dem Tragebalken, A', laͤuft in Falzen, P, P, ein Wagen, O, der
seinen Mittelpunct der umdrehenden Bewegung in, Y, hat.
Auf diesem ist ein platter Schleifstein, Z, aufgezogen,
der mit vieler Sorgfalt zugerichtet seyn muß, und der sich auf allen Theilen gleich
abschleift. Dieser Schleifstein hat eine Umdrehungs-Bewegung um sich selbst,
die ihm mittelst der Rolle, Q, mitgetheilt wird, um
welche die Schnur, R, laͤuft, und eine
geradelinige Bewegung hin und her mittelst der Stange, d. Ueber dem Schleifsteine ist senkrecht ein kleiner Laͤufer, J,
aufgehaͤngt, an dessen unteren Ende der Laͤufer befestigt ist. Dieser
Laͤufer, der an einer Stange, H, aufgezogen ist,
die in eine Diele, G, paßt, dreht sich um sich selbst,
und schwankt zugleich auf den zwei Drehezapfen, i, i.
Die erste Bewegung erhaͤlt er durch die Rolle, T,
um welche die Schnur, R, laͤuft, und die auf der
Stange, H, aufgezogen ist; die zweite durch eine in
einen rechten Winkel gebogene Stange, K, L, die mittelst
des Theiles, L, an einer gebogenen Stoßstange, h, haͤngt. Der Koͤrper des Laͤufers
haͤngt in einer Alhidade, D, die zwischen den
zwei Stuͤzen, B, B, auf den Zapfen, K, K, beweglich ist, und die man nach Belieben mittelst
der Schraubenstange, E, die in das vordere Ende
desselben paßt, heben oder senken kann. Wenn man diese Stange mittelst des
geraͤndelten Knopfes, F, dreht, so, kann man das
Glas dem Schleifsteine naͤher bringen, oder weiter davon entfernen, und
dadurch auch den Halbmesser der verlangten Kruͤmmung bestimmen.
Die Maschine wird durch die Kurbel, X, in Bewegung
gesezt, deren Achse eine Winde, V, fuͤhrt, um
welche die Schnur, R, sich windet. Diese Schnur
laͤuft, nachdem sie die Rolle, Q, umschlungen
hat, unter der Rolle, l, uͤber die Rolle, S, oben an der Deke der Werkstaͤtte, schlingt
sich dann um die Rolle, T, geht uͤber die Rolle,
U, und kommt endlich auf die Winde zuruͤk.
Man wird einsehen, daß, wenn man die Kurbel dreht, Schleifstein und Laͤufer
sich zugleich um sich selbst drehen muͤssen.
Wir haben gesagt, daß der Wagen mittelst der Stange, d,
in Falzen laͤuft; diese Stange ist an einem Ende an dem Wagen und an dem
anderen an der gekruͤmmten Stoßstange, c,
befestigt, auf welcher ein Zahnrad, b, aufgezogen ist,
welches von der Schraube ohne Ende, a, umgetrieben wird,
die sich auf der Treibachse befindet. Wenn diese Schraube und das Zahnrad in
Bewegung gesezt wird, wird der Wagen abwechselnd geschoben, und wieder um eben so
viel zuruͤkgefuͤhrt, als die Laͤnge des Armes der
gekruͤmmten Stange, c, betraͤgt.
Die Stange, k, welche den Laͤufer sich schwingen
laͤßt, laͤuft in eine Art von Knie, M. Sie
ist in einen rechten Winkel gebogen, und bewegt sich auf dem Stifte, t. Wenn man die Stange, h,
mittelst der Treibachse dreht, hebt oder senkt man den Arm, L, dieser Stange um so viel, als die Laͤnge des Elbogens der
Stoßstange betraͤgt. Diese Bewegung theilt sich dem Arme, K, und folglich auch dem Laͤufer mit. Man stellt
die Weite des Bogens dieser Bewegung, indem man die horizontale Achse, N, in welche der Arm, L,
laͤuft, hebt oder senkt. Diese Achse ist auf Zaͤumen aufgezogen, f, welche die senkrechten Pfeiler, C, C, umfassen, und die man durch Drukschrauben,
g, stellt. Einer dieser Pfeiler hat einen graduirten
Maßstab, n, um die krumme Linie, welche der
Laͤufer beschreibt, verlaͤngern oder verkuͤrzen zu
koͤnnen.
Dieß ist die Einrichtung dieser sinnreichen Maschine im Allgemeinen, deren
verschiedene Wirkungen wir erklaͤren wollen.
1) Um ein convexes Glas in einer bestimmten Kruͤmmung zu verfertigen, kittet
man auf einem hoͤlzernen oder kupfernem Laͤufer, J, dessen Rand gehoͤrig zugedreht ist, ein Glas
von solcher Dike und von jenem Durchmesser auf, den die zu verfertigende Linse haben
soll, unter der Vorsorge, daß sie gehoͤrig centrirt wird. Man bringt den
Laͤufer in den Mittelpunct der Kreisbewegung, I,
und befestigt ihn mittelst einer Schraube.
Der Schleifstein wird, nachdem er gehoͤrig zugerichtet wurde, mittelst vier
Zapfen auf einer Buͤhne befestigt, und dann auf den Mittelpunct der Umdrehung
des Wagens gestellt, worauf er mittelst einer Schraube festgehalten wird.
Man laͤßt hierauf die Stange, H, so weit
niedersteigen, daß die Entfernung von ihrem feststehenden Mittelpuncte bis zur
Oberflaͤche des Schleifsteines gleich ist dem Halbmesser der verlangten
Kruͤmmung; hierauf hebt oder senkt man den Arm, L, in einer zum Durchmesser des Glases verhaͤltnißmaͤßigen
Laͤnge; dann dreht man die Kurbel, x.
Buͤhne und Glas wird dann in entgegengesezter Richtung sich drehen, der Wagen
wird die Bewegung hin und her hervorbringen, und den Laͤufer, waͤhrend
er die verlangte Krumme beschreibt, hin und her schwingen. In dem
Verhaͤltnisse, als das Glas sich abschleift, laͤßt man es sich tiefer
auf den Schleifstein senken, indem man die Alhidade, D,
mittelst der Schraubenstange, E, herablaͤßt.
Waͤhrend das Glas sich bildet, mißt der Arbeiter mit einem Maßstabe die
Entfernung des feststehenden Mittelpunctes von der Flaͤche des
Schleifsteines.
2) Um ein concaves Glas zu verfertigen, bringt man statt des Glases einen kleinen
gewoͤlbten Schleifstein an, und legt das Glas auf die Stelle des platten
Schleifsteines. Man befestigt den einen und das andere auf ihren respectiven
Mittelpuncten. Man stellt die hin- und herlaufende Bewegung des Wagens
mittelst zweier Haken, und indem man die Stange, d, die
ihn mit der Stoßstange, h, verbindet, abnimmt. Man
begreift, wie nun, da der Wagen unbeweglich ist, das auf der Buͤhne
befestigte Glas nur mehr eine umdrehende Bewegung haben kann, waͤhrend der an
dem Laͤufer befestigte Schleifstein noch seine schwingende und umdrehende
Bewegung behaͤlt. Da dieser Laͤufer immer einen Kreisbogen beschreibt,
wird auch die innere Kruͤmmung des Glases immer die Entfernung des
feststehenden Mittelpunctes von dem Mittelpuncte des Glases als Halbmesser haben.
Hr. Legey hat diese Vorrichtung
abgeaͤndert, indem er die Achse, p, der
Buͤhne, q, welche das zu bearbeitende Glas, o, traͤgt, außer die Lothrechte brachte, und sich
auf einer Centrirungs-Schraube, r, (siehe Fig. 5. und
6.) drehen
laͤßt, zu gleicher Zeit aber die Buͤhne mit Ringen, s, s, umgibt, deren Breite der Dike des Schleifsteines
gleich ist, und die mittelst der Cardan'schen Vorrichtung zwischen den
Stuͤzen des Wagens, O, haͤngen. Auf diese
Weise werden alle Theile des Glases und des Schleifsteines immer im Gleichgewichte
erhalten, und nuͤzen sich gleichfoͤrmig ab, ohne daß die Reibung auf
einem Puncte groͤßer waͤre, als auf dem anderen.
3) Um ein flaches Glas zu schleifen, geschieht das Entgegengesezte der vorigen
Arbeit; d.h., man stellt die Schwingung des Laͤufers mittelst des Hakens, u, indem man den Stift, t,
aus der Stange, k, herauszieht. Diese Stange tritt dann
in den Ausschnitt der Doke, v, wo sie mittelst einer
Drukschraube, x, festgehalten wird. Dadurch
erhaͤlt der Laͤufer mehr Festigkeit, indem er sich dann nur mehr um
sich selbst drehen kann. Man stellt aber dafuͤr zu gleicher Zeit die
Verbindungsstange, d, des Wagens in ihre alte Lage,
damit dieser wieder hin und her laufen kann, und wenn alles so vorgerichtet ist,
wird das Glas, das unter dem platten Schleifsteine hin und her laͤuft, sich
gleichfoͤrmig auf allen Puncten abnuͤzen, bis der Arbeiter es
fuͤr hinlaͤnglich zugeschliffen haͤlt.
Um zu sehen, ob die Maschine gehoͤrig arbeitet, hat man eine Probirnadel,
deren eines Ende, welches abgeplattet ist, sich auf dem Glase reibt, und deren
anderes Ende laͤngs einem Zifferblatte an einem der senkrechten Pfeiler, C, laͤuft. Wenn diese Nadel, waͤhrend sie
so zwischen Glas und Laͤufer sich befindet, schwankt, so ist dieß ein Beweis,
daß ein Fehler im Falze des Wagens ist, den man alsogleich verbessern muß.
Eine Hauptsache ist es, dafuͤr zu sorgen, daß der Rand der Laͤufer
gehoͤrig zugedreht wird. Wenn er es nicht ist, muß der Arbeiter auf die bei
den flachen Glaͤsern angegebene Weise die Lage verbessern.
Zur Aufnahme der Abfalle des Schmergels stellt man eine große mit Blei
gefuͤtterte Kufe unter das Gestell.
Hr. Legey bedient sich der
gewoͤhnlichen Schleifpulver.
Erklaͤrung der Figuren auf Tab. VI
.
Fig. 1. Tab.
VI. Seiten-Aufriß der Maschine zum Schleifen optischer Glaͤser.
Fig. 2. Aufriß
von ruͤkwaͤrts.
Fig. 3.
Grundriß.
Fig. 4.
Horizontaler Durchschnitt des Wagens.
Fig. 5. und
6.
Grund- und Aufriß der Verbesserung zum Schleifen concaver Glaͤser.
A, A, Gestell der Maschine; A', Tragbalken. B, B, die beiden vorderen
Stuͤzen. C, C, die beiden hinteren senkrechten
Pfosten, zwischen welchen der Mechanismus angebracht ist. D, Alhidade, zur Regulirung der Stellung des Glases. E, Stange mit einem Schraubengewinde, die zur Hebung und
Senkung dieser Alhidade gehoͤrt, F,
geraͤndelte Scheibe, die auf dieser Stange aufgezogen ist und zur Drehung
derselben gehoͤrt. G, Dille mit feststehendem
Mittelpuncte. H, Stange, die mit Reibungsgefuͤge
in die Dille paßt. I, Mittelpunct der drehenden
Bewegung. J, Laͤufer aus Holz, sehr genau
zugedreht. K, L, unter einem rechten Winkel gebogene
Stange, mittelst welcher man dem Laͤufer eine schwankende Bewegung geben
kann. M, Knie, welches den Arm, K, der Stange aufnimmt. N, Achse zur
Regulirung der Lage des senkrechten Armes, L. O, Wagen.
P, P, Falze, in welchen der Wagen laͤuft. Q, Rolle, welche den Laͤufer dreht. R, Schnur, welche um diese Rolle laͤuft, und um
die Rolle des Laͤufers. S, Rolle, welche diese
Schnur zuruͤkschikt, und oben an der Deke der Werkstaͤtte befestigt
ist. T, Rolle des Laͤufers. U, eine andere Rolle zwischen den beiden senkrechten
Pfeilern. V, Winde. X,
Kurbel. Y, Zapfen des Laͤufers. Z, Schleifstein fuͤr convexe Glaͤser, der
fuͤr concave und flache Glaͤser durch eine Platte ersezt wird.
a, Schraube ohne Ende, die mit der Treibachse Einen
Koͤrper bildet. b, Zahnrad, welches von dieser
Schraube getrieben wird. c, gekruͤmmte Stoßstange
der Achse dieses Rades. d, Hebel, der den Wagen
vor- oder ruͤkwaͤrts schiebt. e,
Schraube, um die Stange, H, in der Dille, G, zu befestigen. f,
Zaͤume, die die Achse, N, laͤngs der
Pfeiler, C, C, sich schieben lassen. g, g, Schraube zur Stellung derselben. h, gekruͤmmte Stoßstange der Treibachse. i, i, Schrauben, auf welchen der Laͤufer seine
schwankende Bewegung hat. k, k, Zapfen der Alhidade, D. I, Rolle, unter welcher die Schnur, R, laͤuft. m,
Quer- oder Tragbalken des Gestelles, welcher die Zapfen der Achsen, E, und, c, aufnimmt. n, graduirter Maßstab an einem der Pfeiler, C. o, Fig. 5. und 6., concaves
Glas, auf der Buͤhne aufgezogen. p, schiefe Achse
der Buͤhne, q. r, Centrirungs-Schraube
dieser Achse. s, s, Ringe oder Reife, die mittelst der
Cardan'schen Vorrichtung aufgehaͤngt sind. t,
Stift, welcher die Stangen, K, und, L, vereinigt. u, Haken, um
das Schwanken des Laͤufers zu stellen. v, Doke,
welche den Arm, K, in einem Ausschnitte aufnimmt. x, Drukschraube dieser DokeWas wuͤrden die HHrn. v.
Frauenhofer und Reichenbach gesagt haben, wenn sie dieß gelesen
haͤtten? A. d. U..
Tafeln