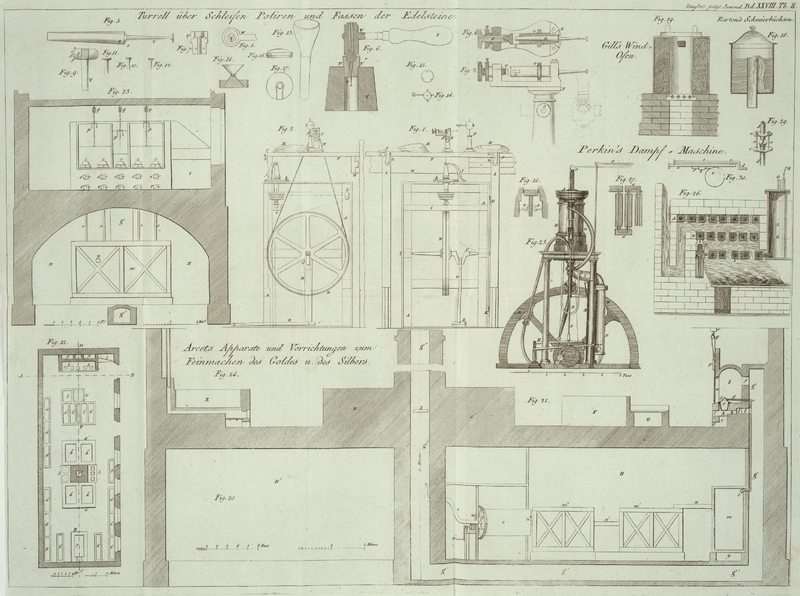| Titel: | Unterricht über das Feinmachen des Goldes und Silbers; abgefaßt von Hrn. d'Arcet im Namen des Gesundheits-Rathes der Stadt Paris und des Seine-Departements. Allgemeine Betrachtungen über den Zustand von Vollkommenheit, welche diese Kunst in Frankreich erreicht hat. |
| Fundstelle: | Band 28, Jahrgang 1828, Nr. I., S. 2 |
| Download: | XML |
I.
Unterricht uͤber das Feinmachen des Goldes
und Silbers; abgefaßt von Hrn. d'Arcet im Namen des Gesundheits-Rathes der Stadt Paris und des
Seine-Departements. Allgemeine Betrachtungen uͤber den Zustand von
Vollkommenheit, welche diese Kunst in Frankreich erreicht hat.Aus den Annales
mensuelles. Mai 1827. S. 131.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
d'Arcet', Unterricht uͤber das Feinmachen des Goldes und
Silbers.
Die Kunst des Feinmachens (affinage) hat keinen anderen Zwek, als Gold und Silber,
wenn beide entweder mit einander, oder mit anderen leichter oxydirbaren Metallen von
geringerem Werthe verbunden sind, auf den hoͤchsten Grad von Reinheit
zuruͤk zu fuͤhren. Diese Kunst war schon den Alten bekannt. Man schied
in den aͤltesten Zeiten das Gold von den leichter oxydirbaren Metallen
entweder durch lange anhaltendes Schmelzen, oder durch die sogenannte
Caͤmentation, oder durch Anwendung des Schwefels und Salpeters;
spaͤter bediente man sich des Spießglanzschwefels und des Sublimates zur
Reinigung des Goldes. Das Silber reinigten die Alten dadurch von den demselben
beigemengten leichter oxydirbaren metallischen Substanzen, daß sie dasselbe unter
freiem Zutritte der atmosphaͤrischen Luft lange im Fluße erhielten, oder mit
Schwefel und Salpeter behandelten. Das Abtreiben auf der Kapelle (coupellation), das Saigern (liquation) wurde erst in spaͤteren Zeiten zum Feinmachen des
Silbers von geringerem Korne angewendet, und erst gegen das Ende des 14ten
Jahrhundertes brachte man es dahin, Silber von dem Golde mit Salpetersaͤure
durch die Quart zu scheiden. Dieses leztere Verfahren ist der wichtigste
Fortschritt, den die Kunst des Feinmachens in den fruͤheren Zeiten gethan
hat. Sie sezte die sogenannten Probirer in den Stand, allen Beduͤrfnissen des
Handels mit Gold und Silber zu entsprechen, und da diese Kunst nur unter der Aegide
eines Privilegiums getrieben werden durfte, so wird man sich leicht
erklaͤren, wie sie Jahrhunderte lang getrieben werden konnte, ohne irgend
einen weiteren Fortschritt zu thun.Wir betrachten hier das Feinmachen (l'affinage)
nicht in der weitesten Bedeutung dieses Wortes, sondern bloß in Hinsicht auf
Gold und Silber, d.h., bloß um die Verbindungen des Goldes und Silbers mit
einander und mit anderen Metallen zu behandeln. A. d. O.
Als im Jahre 1789 die Revolution die verderblichen Privilegien-Rechte
zerstoͤrte, ward die Ausuͤbung der Kunst, reines Gold und reines Silber darzustellen, das
Recht eines jeden franzoͤsischen Buͤrgers (Gesez vom 19. Brumaire, An VI. Article 112.). Dem Privat-Fleiße
uͤberlassen, vervollkommnete diese Kunst sich jezt schnell, und man fing bald
an, Schwefelsaͤure statt der Salpetersaͤure bei der Behandlung der
Verbindung des Goldes mit dem Silber anzuwenden.Man vergleiche uͤber Anwendung der Schwefelsaͤure bei dem
Feinmachen die Abhandlung von d'Arcet, neveu, vom J. 1802 im LV. Bd. des Journal de Physique p. 259, und die Antwort
hierauf von Dizé, Ebendas. p. 437, 440. Hr. d'Arcet, neveu, wendete zuerst Kessel
von Platinna an, um Verbindungen von Gold und Silber fein zu machen. A. d.
O. Die große Menge Platinna, die nach und nach in das Publicum kam,Haͤmmerbare Platinna galt die Unze 36 Franken, als die HHrn. Cuvq und Couturier
eine bedeutende Menge dieses Metalles nach Frankreich brachten, und Hrn. Bréant zur Bearbeitung uͤberließen.
Dadurch gaben sie die erste Veranlassung zur besseren Behandlung der rohen
Platinna, zu den gluͤklichen Erfolgen, welche Hr. Bréant erhielt, und zu der
maͤchtigen Herabsezung des Preises, die die Platinna damals erlitt.
Dadurch konnte dieses Metall nur haͤufiger zum
Fabrik-Gebrauche angewendet werden. Die HHrn. Cuoq und Couturier fahren noch jezt
fort diesen Zweig der Industrie zu betreiben. Die Gefaͤße, die
lezterer verfertigt, werden rue de Lulli, N. 1.
verkauft. A. d. O. und die Fortschritte in der Kunst, Platinna zu haͤmmern,Hr. Bréant, vérificateur général des essais des monnaies,
ließ die Platinna-Gefaͤße verfertigen, die wir in dem unten
beschriebenen Laboratorium anwenden. Er hat seine Fabrik, rue Montmartre, N. 64, wo alle Gefaͤße
zur Concentrirung der Schwefelsaͤure, zur Scheidung des Goldes von
dem Silber etc. verfertigt werden. A. d. O. trugen endlich noch dazu bei, der Kunst des Feinmachens einen Grad von
Vollkommenheit zu verschaffen, den man nicht voraussehen konnte, und der jezt noch
schwer zu begreifen ist. Wir muͤssen uns hier in einiges Detail einlassen,
damit das Andenken an eine so große Verbesserung im Gold- und Silberhandel
erhalten wird, und jene Maͤnner, die unserer Industrie diese Vortheile
gewaͤhrten, eben so geehrt werden, wie die Wissenschaft selbst, die ihnen die
Mittel hierzu dargebothen hat.
Im Jahre 1789 wurde eine Silberbarre von geringem Korne, welche Gold enthielt, auf
folgende Weise fein gemacht.
Man fing damit an, daß man sie, oͤfters sogar mehrere Mahle, mit Salpeter
schmelzte, um das Kupfer davon abzuscheiden. Man koͤrnte hierauf dieses
Silber, und behandelte es in Gefaͤßen von Steingut mit heißer
Salpetersaͤure. Das nicht aufgeloͤste Gold wurde noch ein Mahl mit
staͤrkerer Salpeter-Saͤure behandelt, und mit vielem Wasser
gewaschen, getroknet, und mit Salpeter geschmolzen. Die, Fluͤßigkeiten wurden
zusammengegossen, mit Kupfer gesaͤttigt, und heiß mit Kupferplatten in
Beruͤhrung so lange gebracht, bis alles Silber ausgeschieden war. Das im
metallischen Zustande niedergeschlagene Silber wurde sorgfaͤltig gewaschen,
dann getroknet, und mit Salpeter und etwas Borax geschmolzen. Die
Fluͤßigkeiten, welche alles salpetersaure Kupfer enthielten, wurden bis zur
Syrup-Consistenz eingedikt, in große Gefaͤße von Steingut gegossen, und in diesem einem
Feuer ausgesezt, durch welches das salpetersaure Kupfer zersezt werden konnte. Auf
diese Weise ging natuͤrlich beinahe alle angewendete Salpetersaͤure
verloren. Man mußte nun auch noch das Kupfer-Oxyd auf dem Boden dieser
Gefaͤße in metallischen Zustand reduciren, und mit Kohlen in einem
Wind- oder in einem sogenannten Aermel-Ofen schmelzen.
Man sieht, daß man bei diesem Verfahren sehr viel Salpeter brauchte; daß man sich der
Salpetersaͤure bediente, die sehr theuer zu stehen kommt; daß die
Gefaͤße, deren man sich bediente, sehr gebrechlich waren, und dem schnellen
Wechsel der Temperatur nur sehr schlecht widerstehen koͤnnen; daß beinahe
alle Salpetersaͤure verloren ging, theils durch die Aufloͤsung des
Metalles, theils durch die Zersezung des salpetersauren Kupfers; daß man
aͤußerst gefaͤhrliche, und fuͤr die Gesundheit verderbliche
Gasarten erzeugte; daß man bedeutenden Abgang an dem angewendeten Kupfer erlitt; daß
man viele Schlafen und Tiegeltruͤmmer erhielt, um daraus die Abfaͤlle
an Gold und Silber zu gewinnen; daß man endlich alle diese Kosten nur durch das Gold
und Silber, als die einzigen brauchbaren Artikel, die man bei diesen Operationen
erhielt, deken konnte.
Bei der neuen Verfahrungs-Art, deren man sich gegenwaͤrtig zu Paris
bedient, sind alle so eben angefuͤhrten Nachtheile beseitigt. Das Detail,
welches wir sogleich angeben werden, wird, verglichen mit Obigem, hinreichen um zu
beweisen, mit welchem Erfolge unsere Feinmacher alle Huͤlfsquellen der Chemie
auf ihre Arbeiten anzuwenden verstanden.
Wir wollen nun annehmen, man haͤtte eine Silberbarre von geringem Korne, die
etwas Gold enthaͤlt, fein zu machen. Nach dem neuen Verfahren wird nun der
Arbeiter diese Barre schmelzen und koͤrnen, ohne sie mit Salpeter zu treiben,
um ihren Gehalt zu erhoͤhen, und das gekoͤrnte Metall mit
Schwefelsaͤure in Gefaͤßen von Platinna behandeln. Das von dem Silber
abgeschiedene Gold wird noch ein Mahl mit neuer Saͤure behandelt, dann
gewaschen, getroknet und mit etwas Salpeter geschmolzen. Das schwefelsaure Silber
wird heiß zersezt, indem man Kupferplatten in dasselbe taucht, das Silber gewaschen
und getroknet, und dann mit etwas Salpeter und Borax geschmolzen, und in eine neue
Barre gegossen. Das aufgeloͤste schwefelsaure Kupfer wird gereinigt, indem
man demselben noch heiß eine hinlaͤngliche Menge Kupfer-OxydVergl. Hrn. Gay-Lussac's Abhandlung im 49.
Bd. d. Annales de Chimie, p. 25. A. d. O. zusezt, dann bis zur gehoͤrigen Consistenz abgeraucht, und zur
KrystallisirungVergl. hieruͤber Descroizilles,
uͤber Erzeugung des Kupfervitrioles und die Krystallisation dieses
Salzes in den Mèmoires de l'Acad. de Rouen,
année 1807, p. 63. A. d. O. bei Seite gestellt, wo man nach dem Erkalten schoͤne Krystalle von
schwefelsaurem Kupfer erhaͤlt.
Man sieht hieraus schon, daß man bei diesem Verfahren in einem gut eingerichteten
Laboratorium weit weniger Ausgaben fuͤr Arbeitslohn, fuͤr Salpeter,
fuͤr Saͤuren, fuͤr Tiegel, fuͤr Kohlen etc. hat; daß man
weniger Abgang erleidet; daß man weniger Ruͤkstaͤnde erhaͤlt,
die man neuerdings bearbeiten muß; daß man viel an Zeit gewinnt, indem die Operation
schneller von Statten geht; daß man endlich dadurch auch eine brauchbare Waare
erhaͤlt, indem man, außer dem feingemachten Golde und Silber, auch
krystallisirten Kupfervitriol bekommt, und so die Schwefelsaͤure und das
Kupfer, welche man bei diesem Verfahren brauchte, so wie auch das Kupfer, welches
dem Silber beigesezt war, am besten verwendet hat. Ueberdieß ist bei diesem
Verfahren auch die Gesundheit weniger gefaͤhrdet, da sich waͤhrend
desselben nur schwefeligsaures Gas und etwas Schwefelsaͤure in Dampf
verwandelt entwikelt, und selbst die wenigen hierdurch entstehenden Nachtheile
lassen sich leichter beseitigen. Die unten beigefuͤgte Uebersicht wird die so
eben erwaͤhnten Vortheile dieser neuen Verfahrungs-Weise noch mehr
bestaͤtigen. Wir koͤnnten dieselben noch mehr herausheben; da wir aber
nicht die Absicht haben, die ganze Kunst des Feinmachens zu beschreiben, so werden
wir uns nicht in das Detail der bei derselben nothwendigen Handgriffe einlassen, und
beschraͤnken uns bloß darauf, dieses Verfahren in allen seinen Theilen
fuͤr die Gesundheit gaͤnzlich unschaͤdlich zu machen.
Beschreibung eines Laboratoriums, in
welchem man Gold und Silber ohne alle Gefahr fuͤr die Arbeiter, und ohne
alle Ungelegenheit fuͤr die Nachbarschaft fein machen kann.
Die HHrn. St. André, Poizat und Comp., rue de la Fidélité N. 11, haben das hier
beschriebene Laboratorium sich nach unserem Plane und nach unserer Weisung erbauen
und einrichten lassen. Man fing am 1. April 1826 in demselben an zu arbeiten. Es ist
groß genug, um taͤglich mehr als zwei Ztr. (100 Kilogramm) Silber fein zu
machen. Man hat in demselben bereits 15,000 Kilogramm verarbeitet (im Werthe von
3,300,000 Franken), und 3,000 Kilogramm Gold, im Werthe von ungefaͤhr
10,500,000 Franken. Man erzeugte in demselben noch uͤberdieß 12 bis 15,000
Kilogramm krystallisirten Kupfer-Vitriol. Die Nachbarn, welche alle der
Errichtung dieser Fabrik
sich widersezten, und dieselbe nicht in ihrer Mitte leiden wollten, haben indessen
das ganze Jahr uͤber nicht die mindeste Klage gefuͤhrt; sie wußten
sogar eine lange Zeit uͤber nicht, daß die Fabrik bereits im Gange war, und
sind gegenwaͤrtig vollkommen uͤber alle Moͤglichkeit eines
fuͤr sie entstehenden Nachtheiles beruhigt. Folgende Zeichnung stellt den Bau
und die Einrichtung dieser Fabrik dar.
Fig. 22.
Grundriß des Laboratoriums zum Feinmachen des Goldes und Silbers.
b, b, Grundriß der Oefen, auf welche die fuͤnf
Kessel aus Platinna gestellt werden.
g, g, Schornstein, durch welchen die sauren
Daͤmpfe und der Rauch der Oefen niedersteigt, um in den horizontalen
Schornstein zu gelangen, g'', Fig. 23, 24., und aus diesem in
den Hauptschornstein, g'', Fig. 22, 24. in der Mitte des
Laboratoriums.
1, kleiner Rauchfang, der seinen Zug von dem Hauptschornsteine erhaͤlt.
Dieser Winkel ist zur Aufnahme der Platinna-Kessel vorgerichtet, wenn
dieselben von ihren Oefen abgehoben werden, um unter diesem Rauchfange die sauren
siedenden Fluͤßigkeiten abzugießen, ohne daß ungesunde Daͤmpfe sich in
dem Laboratorium verbreiteten. Diese Daͤmpfe werden von dem Schornsteine, g, aufgenommen, in welchen sie der Luftzug hinreißt.
G, ist die Tafel, auf welche die Platinna-Kessel
gestellt werden, wenn man die Schwefelsaͤure und das gekoͤrnte Silber
in dieselben bringt. Man waͤscht daselbst auch das aus dem Kupfer und Silber
ausgeschiedene feingemachte Gold.
2, sind die Kessel, in welchen man das Silber, nachdem es durch das Kupfer
gefaͤllt und gewaschen wurde, troknet.
3, Grundriß der drei Windoͤfen, in welchem man sowohl die unreinen Barren, die
man koͤrnen will, als das feingemachte Gold und Silber schmilzt.
4, bleierne Kessel, in welchen man das mit Wasser verduͤnnte schwefelsaure
Silber mittelst der kupfernen Platten zersezt; man verdampft in denselben auch die
Aufloͤsungen des schwefelsauren Kupfers, um dieses Salz dann zu
krystallisiren.
5, Behaͤlter, in welchem man die Platinna-Kessel und alles
Geraͤthe des Laboratoriums waͤscht, das von schwefelsauren Silber
benezt oder beschmuzt wurde.
6, Krystallisir-Gefaͤße, mit Blei ausgefuͤttert, in welche man
die concentrirte Aufloͤsung des schwefelsauren Kupfers gießt, um sie in
denselben krystallisiren zu lassen.
7, Kessel, in welchem man die Mutter-Laugen der ersten Krystallisation des
Kupfer-Vitrioles bis zur gehoͤrigen Dike abraucht.
g'', Durchschnitt des Hauptschornsteines, der aus der
Mitte des Laboratoriums aufsteigt und allen Rauch der Oefen; b, b, 2, 3 und 4, aufnimmt. Die in den Oefen, 2, 3 und 4, erzeugte Hize
erwaͤrmt vorzuͤglich den senkrechten Theil dieses Schornsteines, und
erzeugt dadurch den anhaltenden und maͤchtigen Zug.
Fig. 23.
Querdurchschnitt des Laboratoriums nach der Linie, A, B,
des Grundrisses in Fig. 22. vom Puncte, C, aus gesehen.
Man sieht in, q, q, q, die Rollen, uͤber welche
die Ketten laufen, die zum Aufziehen und Niederlassen der
Blech-Thuͤrchen, p, p, p dienen, welche
man, nach Belieben, ganz oder zum Theile schließen, und dadurch auch das vordere
Ende des Rauchwinkels, in welchem sich die Platinna-Kessel befinden, die man
in, c, c, c, c, c, sieht, ganz oder zum Theile absperren
kann. Die Thuͤren der 5 Oefen sind mit s, die
Thuͤren der Aschenherde mit t, bezeichnet.
1, ist der kleine Rauchwinkel, der gleichfalls in den Schornstein, g, seinen Abzug hat, und in welchem man alle Arbeiten
verrichtet, welche in dem Laboratorium einen uͤblen Geruch verbreiten
koͤnnten.
g, ist jener Theil des Schornsteines, welcher den Rauch
der 5 Oefen, auf welchen sich die Platinna-Kessel befinden, in den
horizontalen Schornstein, g', leitet, und aus diesem in
den Hauptschornstein, g'', Fig. 24. fuͤhrt.
Die sauren Daͤmpfe, welche aus den Platinna-Kesseln entweichen, wenn
man sie oͤffnet, koͤnnen sich nicht in dem Laboratorium verbreiten,
sondern vermengen sich mit dem Rauche der Oefen, und ziehen mit diesem durch die
Schornsteine, g, g', in den Hauptschornstein, g'', Fig. 24.
e, e, e, e, sind bleierne Roͤhren von 0,08 Meter
im Durchmesser, welche die Platinna-Kessel mit der mit Blei
ausgefuͤtterten Kiste, m, im Keller, H, unter dem Laboratorium in Verbindung sezen. Die
fuͤnfte bleierne Rohre, e, dient zur
Luͤftung des Platinna-Kessels, der in der Mitte des Ofens steht, und
laͤuft in den inneren Raum des Schornsteines, g',
kann also in dieser Figur nicht dargestellt werden. Man sieht in, n, den Durchschnitt der bleiernen Roͤhre, welche
die Daͤmpfe der Kiste, m, in die uͤbrigen
Theile des Apparates fuͤhrt.
g', Durchschnitt, des Theiles des Schornsteines, welcher
horizontal unter dem Boden des Kellers hinlaͤuft, und in der Mitte des
lezteren in den Hauptschornstein, Fig. 24. tritt.
Fig. 24. ist
der Durchschnitt des Laboratoriums nach der Linie, C, D,
des Grundrisses.
In dem oberen Theile der Tafel sieht man den Durchschnitt des Laboratoriums, in
welchem gearbeitet wird. Der untere Theil stellt den Durchschnitt des Kellers, H,In dem hier beschriebenen Laboratorium ist jener Theil des Kellers, welcher
hier mit H, bezeichnet ist, ein Pochwerk und
zusammenhaͤngendes Muͤhlenwerk, in welchem die Abfalle des
Laboratoriums mit Queksilber behandelt werden. A. d. O. unter dem Laboratorium dar, wo sich, in zwekmaͤßigen Apparaten, die
Dampfe und schaͤdlichen Gasarten verdichten und absorbirt werden, die sich
bei der Einwirkung der Schwefelsaͤure auf das unreine Gold und Silber
entwikeln. Diese Apparate wirken auf folgende Weise.
Der Platinna-Kessel, c, welcher so viel Metall und
Schwefelsaͤure enthaͤlt, als er auf ein Mahl fassen kann, wird auf
seinen Ofen, h, gestellt, dessen Aschenherd man in, i, sieht, und den Schornstein in, k, l, g, g', g''. Man bedekt diesen Kessel mit
seinem Platinna-Hute, und verbindet sorgfaͤltig seinen Hals, d, mit der Roͤhre, e,
e, die aus Blei ist. Eben dieß geschieht mit den vier anderen
Platinna-Kesseln. Man laͤßt die Blech-Thuͤren, p, p, p, Fig. 23. beinahe ganz
herab, und schuͤrt das Feuer unter den 5 Oefen an, deren Ofen- und
Aschen-Thuͤren man bei, s und t, sieht.
Unter den Oefen, 2, 3, 4, in Fig. 22. wird zuerst
Feuer gemacht. Die dadurch erhizte Luft in dem Hauptschornsteine, g'', g'', Fig. 24. erzeugt einen
maͤchtigen Zug nach aufwaͤrts, der alles der Gesundheit
Gefaͤhrliche aus dem Laboratorium fortreißt, theils unter dem Rauchwinkel,
b, der Oefen, auf welchem die
Platinna-Kessel, stehen, theils aus dem Rauchwinkel, 1, (Fig. 22 und 23.), wo jede
ungesunde Arbeit zu geschehen hat.
Sobald die Schwefelsaͤure auf das Silber und Kupfer einzuwirken
anfaͤngt, entwikelt sich schwefeliges Gas und Wasserdampf, der in
Daͤmpfe verwandelte Schwefelsaͤure enthaͤlt. Der Zug in dem
Hauptschornsteine macht, daß in jeden Platinna-Kessel einige Luft durch die
Roͤhre, 8, Fig. 24. eintritt. Diese Luft, die sich mit der schwefeligen
Saͤure und mit den Daͤmpfen verbindet, wird mit denselben in den Hals
des Hutes hineingezogen, und kommt von da in die bleierne Roͤhre, e, e, e. Diese Daͤmpfe gelangen mit der
schwefeligen Saͤure in die Bleikiste, m, in dem
Keller, H; ein Theil verdichtet sich; der uͤbrige
Theil durchlaͤuft nach und nach die Roͤhre, n; die zweite Bleikiste, m'; die Rohre, n'; die dritte Bleistifte, m'', in welcher sich endlich die lezten Daͤmpfe verdichten. Durch die
Roͤhre, n'', geht dann beinahe reine schwefelige
Saͤure uͤber, und gelangt in die mit Kalk-Hydrat
gefuͤllte Kiste, o, die mittelst eines
Raͤderwerkes, u, und einer Kurbel, u', um ihre Achse gedreht, und so gehoͤrig
geruͤttelt wird, um allen Kalk in Beruͤhrung mit dem schwefeligen Gase
zu bringen. Auf diese Weise wird alles Gas leicht verschlungen, und es entweicht
durch die Roͤhre, q, in den Schornstein, g'', nur jene wenige atmosphaͤrische Luft, die man durch die
Tubulirung in den Platinna-Kessel eintreten ließ, um die Daͤmpfe aus
demselben zu verjagen, und zu verhindern, daß sie sich nicht unter dem Rauchwinkel,
b, der Oefen verbreiten. Wenn sich auch einige
ungesunde Daͤmpfe in dem Rauchwinkel, b, oder
unter dem sogenannten Mantel waͤhrend der Arbeit, entweder in dem Augenblike,
wo man die Kessel von dem Ofen wegnimmt, oder waͤhrend der Arbeit,
verbreiten, so koͤnnen sie doch nicht aus diesem Winkel heraus, oder unter
dem Mantel durch. Der in dem Hauptschornsteine, g'',
hergestellte Zug wuͤrde sie noͤthigen, zugleich mit der Luft, die
unter den Blech-Thuͤren, p, Fig. 23.
eintritt, in den Schornstein, g, zu treten, indem sie
durch die Oeffnung, f, oben in dem Rauchwinkel, b, (Fig. 24.) in den
Schornstein, g, treten, und dann dem horizontalen
Schornsteine, g', folgend sich mit dem Rauche in dem
Hauptschornsteine, g'', verbinden, der sie hoch in die
Atmosphaͤre hinauf fuͤhrt.
Eben dieß gilt auch von den schaͤdlichen Daͤmpfen, die sich in dem
Rauchwinkel, 1, entwikeln (Fig. 22 und 23.); und auf
diese Weise laͤßt sich leicht diese Arbeit der Gesundheit vollkommen
unschaͤdlich machen. Was die Gewinnung des schwefelsauren Silbers und die
Verdampfung der Aufloͤsung des schwefelsauren Kupfers betrifft, so ist es
genug, wenn man, um diese Arbeit unschaͤdlich zu machen, diese
Aufloͤsungen nicht mit einer zu hohen Temperatur behandelt, ehe man sie auf
den neutralen Zustand gebracht hat, was immer leicht geschehen kann, wenn man sich
des gepuͤlverten kohlensauren Kupfer-Oxydes bedient, und damit die
Aufloͤsung saͤttigt.
In einigen besonderen Faͤllen, wo man sich des Eisens oder Zinkes, statt des
Kupfers, bedienen kann, um das Silber oder Kupfer niederzuschlagen, aus
Aufloͤsungen, die uͤberschuͤssige SchwefelsaͤureEisen und Zink kann man dann zur Zersezung des schwefelsauren Silbers und
Kupfers anwenden, wann es sich nur um Ausscheidung des Goldes aus seinen
Verbindungen mit Silber und Kupfer handelt. Die
Muͤnz-Directoren, die nur Silber von 0,009 brauchen,
koͤnnten sich dieser Methode mit großem Vortheile bedienen. A. d.
O. enthalten, muß diese Arbeit in einer bedekten Kufe verrichtet werden, die
wie in den Berlinerblau-Fabriken vorgerichtet ist.Die Beschreibung dieses Apparates findet sich im 82. Bd. der Annales de Chimie, p. 165. A. d. O. In diesem Falle muß das Wasserstoffgas, welches sich entwikelt, durch eine
Roͤhre von gehoͤrigem Durchmesser in das Innere des Schornsteines, g'', uͤber der Oeffnung, I, geleitet werden, damit dieses Gas in keinem Falle sich
entzuͤnden kann. Man sieht in y, Fig. 24., daß die
Blei-Kiste, m, den Boden nicht beruͤhrt;
sie steht zugleich auf allen Seiten frei. Dadurch kann sie leichter
abkuͤhlen, und folglich koͤnnen die dahin geleiteten Daͤmpfe
sich leichter verdichten.
Man sieht in E, den Durchschnitt des bleiernen Kessels,
E, im Grundrisse, Fig. 22. Der Buchstabe,
F, zeigt den Aufriß der
Krystallisations-Gefaͤße im Grundrisse, so wie G, den Tisch, G, zeigt.
Die Oeffnung, I, im Schornsteine, g'', dient als besonderer Schornstein fuͤr die Oefen, 2, Fig. 22, 24.Man muß die Oeffnung, i, ganz oder zum Theile,
nach Belieben, schließen koͤnnen. Eben dieß gilt auch von den
Schornsteinen der Oefen, die in Fig. 22. durch,
b, b, 3, 4, und 7, bezeichnet sind. Alle
diese Schornsteine muͤssen mit guten Schiebern (Registern) versehen seyn, damit man den Zug
gehoͤrig reguliren kann. A. d. O.. Die Buchstaben, x und x' bezeichnen den Durchschnitt des Mauerwerkes der Oefen, auf welchen die
Bleikessel, 4, 4, 4, 4, Fig. 22. aufgestellt
sind.
Alle Dekel auf den Blei-Kisten und allen uͤbrigen Apparate
muͤssen genau verkittet werden; dann, wenn diese aͤußere Luft zwischen
den Fugen eintreten, wuͤrde, wuͤrde der Zug durch den Schornstein, g'', weniger auf die Tubulirungen der
Platinnen-Kessel wirken, und nicht die verlangte Kraft aͤußern. Immer
muͤssen zuerst auch die Oefen, 2, 3, und 4, in Fig. 22. geheizt werden,
damit die schaͤdlichen Daͤmpfe aus b und
1, vertrieben werden koͤnnen, und, wie gesagt, alle gefaͤhrlichen
Arbeiten muͤssen in diesen Rauchwinkeln oder unter diesen Maͤnteln
verrichtet werden. Man muß auch dafuͤr sorgen, daß immer frische Luft genug
in das Laboratorium gelangen kann; theils damit die Oefen ziehen koͤnnen,
theils damit durch die Gitterbedachung die Daͤmpfe aus den
Abrauch-Kesseln leichter ihren Ausweg finden; denn sonst wuͤrde
fuͤr die Kessel in der Mitte des Laboratoriums eine andere Ventilation
nothwendig werden.Wenn man anderswo kein Gitterdach errichten koͤnnte, so muͤßten
uͤber den Kesseln um den Hauptschornstein, g'', Rauchwinkel oder Mantel aus Brettern, oder aus leichtem
Mauerwerke errichtet werden, die man mit dem Hauptschornsteine in Verbindung
bringt. Wenn man diese Rauchwinkel mit Vorhaͤngen versieht, und sich
so benimmt, wie bei dem Vergolden, wird man allen Dampf leicht in den großen
Schornstein fuͤhren, und auch auf diese Weise das Laboratorium gesund
machen koͤnnen. A. d. O.
Verschiedene Tarife uͤber die
Kosten des Feinmachens in Frankreich seit der Zeit, als diese Kunst frei gegeben
wurde. (Im Auszuge.)
Nach Titel IX. Sect. 2. Art. 135 des Gesezes 19. Brumaire
J. VI. (9. Nov. 1797.) konnte der Feinmacher der
Regierung als Kosten fuͤr seine Arbeit anrechnen:
1) Wenn die Barren mehr als die Haͤlfte ihres Gewichtes Gold enthielten, 24
Fr. 35 C. von jedem Kilogramm feinen Goldes, das er aus diesen Barren schied.
2) Wenn die Barren weniger als die Haͤlfte Goldes hielten, 10 Fr. 22 C.
fuͤr jedes Kilogramm, das die unreine Barre vor der Scheidung wog.
3) Fuͤr Silber-Barren, 3 Franken 27 C. fuͤr jedes Kilogramm
reinen Silbers in diesen Barren.
Nach dem Geseze vom 4. Prairial Jahr XI. (24. Mai 1803.)
wurde fuͤr Gold 32 Franken fuͤr jedes Kilogramm Fein als Taxe
fuͤr das Feinmachen bestimmt.
Fuͤr Silber wurde diese Taxe nach dem Korne berechnet: fuͤr Barren von
890 oder 899 Tausendtheilen kamen 4 Franken 10 C. fuͤr jedes Kilogramm:
fuͤr Barren unter 200 aber 14 Franken fuͤr das Kilogramm.
Diese Taxen fordert man noch heute zu Tage an den Wechsel-Buͤreaux der
Muͤnze, wenn man daselbst Gold oder Silber unter 0,09 umsezen will.
Die Kunst ist seit der Zeit, als dieses Gesez fabricirt wurde, so weit
fortgeschritten, daß dem Feinmacher jezt jede Barre fuͤr Gold-Barre
gilt, die mehr als ein Zehntel ihres Gewichtes Gold enthaͤlt. Wenn sie das
Gold aus solchen Barren zu scheiden haben, erstatten sie dem Eigenthuͤmer
alles darin enthaltene Gold und Silber, behalten nur das Kupfer fuͤr sich,
das derselben beigemengt war, und verlangen nur 5 Franken 50 C. Kosten-Ersaz
fuͤr das Feinmachen fuͤr jedes Kilogramm.
Wenn man eine Silber-Barre fein machen laͤßt, die weniger als 100
Tausendtheile Gold enthaͤlt, so behaͤlt der Feinmacher Ein
Tausendtheil Gold und alles Kupfer in dieser Barre fuͤr sich; alles
uͤbrige Gold und Silber, welches in der Barre enthalten war, gibt er dem
Eigenthuͤmer, und noch eine Verguͤtung, die jezt 75 Cent, fuͤr
das Kilogramm betraͤgt. Will der Eigenthuͤmer aber alles Gold und
Silber in der fein zu machenden Barre, so verlangt der Feinmacher 2 Franken 68 C.
fuͤr jedes Kilogramm, und behaͤlt nur das Kupfer fuͤr sich. Bei
Barren von sehr schlechtem Korne ist der Feinmacher durch das Kupfer allein
hinlaͤnglich bezahlt; er gibt dem Eigenthuͤmer gern alles Silber, was
die Barre enthielt, zuruͤk. So sehr hat die Kunst des Feinmachens sich
vervollkommnet!
Die Vortheile hiervon fuͤr den Handel sind nicht zu berechnen. Es ist sehr
wahrscheinlich, daß Aufhebung der schaͤndlichen Privilegien, daß Concurrenz
und Wissenschaft diese Kunst noch weit mehr vervollkommnen, und noch
genuͤgendere Resultate liefern wird.
Tafeln