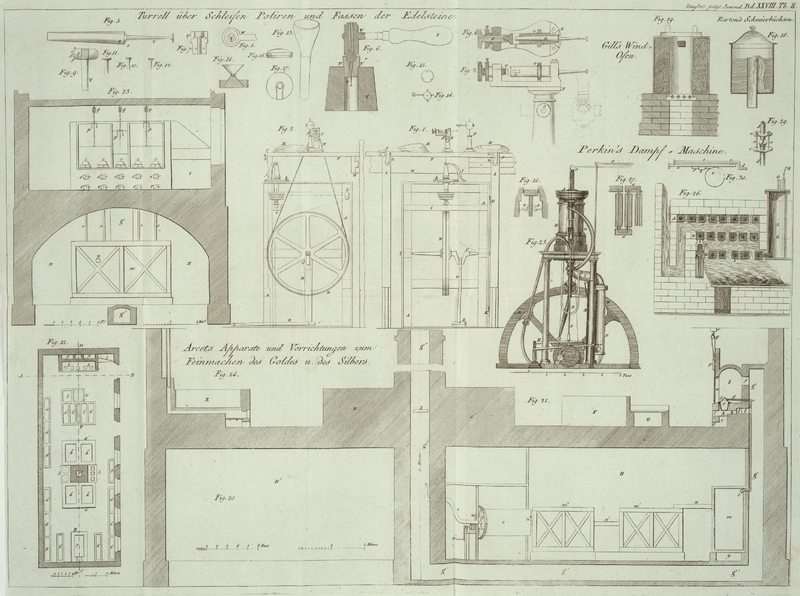| Titel: | Ueber das Spalten, Schleifen, Poliren und Fassen der Demante zu allen bekannten Zweken. Von Hrn. Edm. Turrell. |
| Fundstelle: | Band 28, Jahrgang 1828, Nr. II., S. 11 |
| Download: | XML |
II.
Ueber das Spalten, Schleifen, Poliren und Fassen
der Demante zu allen bekannten Zweken. Von Hrn. Edm. Turrell.
Aus Gill's technological Repository, Decbr. S.
321.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
(Fortsezung Bd. XXVII
S. 363.)
Turrell, uͤber das Spalten, Schleifen, Poliren und Fassen
der Demante zu allen bekannten Zweken.
Ueber Anwendung des Demantpulvers zum
Siegelstechen. Ich verdanke Hrn. Raphael Clint,
einem jungen Kuͤnstler von vielen Talenten in unserer Hauptstadt, diese
Bemerkungen uͤber die wichtige Kunst des Siegelstechens; er erlaubte mir auch
seinen verbesserten Apparat hier abzuzeichnen.
Im technical Repository (VII. B. polytechn. Journ. B. XVI
S. 302.) wurde bereits seine verbesserte Methode, Demantstaub mit Oehl mittelst
concaver und convexer Werkzeuge aus gehaͤrtetem Stahle, statt mittelst des
gewoͤhnlichen Moͤrsers und Stoͤßels abzureiben beschrieben, so
daß ich hierbei nicht laͤnger verweilen darf.
Er hat ferner noch die Drehebank oder die Muͤhle verbessert, durch welche die
kleinen eisernen Raͤder und Werkzeuge, welche mit Demantstaub belegt sind,
getrieben werden, so daß sie jezt nicht bloß tragbar ist, sondern auch die zitternde
Bewegung des Laufrades und des Tretschaͤmels, wodurch das Augenglas immer hin
und her bewegt wurde, gaͤnzlich beseitigt wird.
Er bringt jezt das Laufrad auf einem besonderen Gestelle an, das mit dem Werktische
in keiner anderen Verbindung steht, als mittelst einer duͤnnen Darmsaite, die
die kleinen Raͤder treibt.
Fig. 1. auf
Tab. II. ist ein Aufriß des Werktisches und des Rahmens von der Vorderseite, und
Fig. 2.
ein Seitenaufriß. A, A ist das Gestell, welches das
Lauf- oder Bandrad aus Gußeisen traͤgt. Dieses Rad ist auf der
Kurbelachse, C, aufgezogen: die Kurbel hat zwei und
einen halben Zoll im Durchmesser. Die Kurbelstange, D,
ist aus Holz, und ist. in der Naͤhe ihres oberen Endes mit einem Loche
versehen, welches genau in den Hals der Kurbel paßt. Sie ist durch dieses Loch bis
in ihre Mitte herabgespalten oder gesaͤgt, so daß sie sich oͤffnen und
den Hals in dem Loche aufnehmen kann, und wird dann mittelst einer durch ihre Dike
gerade unter dem Loche hin durchziehenden Schraube befestigt, wie die punctirten
Linien in Fig.
2. zeigen. An dem unteren Ende dieser Stange ist noch ein Loch durch
dieselbe durchgebohrt, und ein Ausschnitt oder eine Kehle in der Naͤhe des
einen Endes des Tretschaͤmels, E, nimmt dieselbe
auf. Correspondirende Loͤcher befinden sich gleichfalls in diesem
Tretschaͤmel, und durch einen Schraubenstift, der durch eines derselben und durch das Loch in der
Kurbelstange durchgestekt wird, wird der Tretschaͤmel mit derselben
verbunden.
Das andere oder aͤußere Ende des Tretschaͤmels ist mit einem daran quer
befestigten Holzstuͤke versehen, welches eiserne Zapfen an seinen Enden
fuͤhrt, die in zwei Loͤchern laufen, welche in Oehren angebracht sind,
die an einem vierekigen, auf dem Boden des Zimmers befestigten, Stuͤke Holzes
steken, so daß auf diese Weise Kurbelstange, Tretschaͤmel und Kurbel so unter
einander verbunden sind, daß sie sich frei und ohne alles Wakeln und ohne
Laͤrmen bewegen koͤnnen.
Der Werktisch aus Mahagonyholz, F, der die Drehebank oder
die Muͤhle traͤgt, G ruht mit seinem
Ruͤken auf einer horizontalen hoͤlzernen Latte, H, die quer nach dem Fenster im Zimmer befestigt wird. Vorne ruht sie auf
zwei anderen Pfeilern, I, I. Jedes dieser drei
Hoͤlzer besteht aus zwei Stuͤken, die mit
Schwalbenschweifgefuͤge in einander eingelassen sind, so daß sie genau in
einander passen, wie Fig. 2. zeigt, und verlaͤngert oder verkuͤrzt werden
koͤnnen, je nachdem man sie hoͤher oder tiefer stellen will. Die
Mahagonytafel bildet auch das Vordertheil der dadurch und durch die bedekten Seiten
des Gestelles, A, A, gebildeten Lade auf einer Reise,
und fuͤhrt die weiblichen Haͤlften der zwei Angelgewinde, J, J die auf den Zapfen in den anderen Haͤlften,
K, K, vorne an der Seite des Rahmens befestigt sind.
Wenn indessen die Tafel horizontal liegt, wie in den beiden Figuren, nehmen die
Loͤcher in den halben Angeln, J, J, andere Zapfen
in sich auf, die an den Platten, L, L angebracht, und an
den oberen Enden der Pfeiler, I, I, befestigt sind, so
daß sie, wie Fig.
1. zeigt, davon festgehalten werden. Wenn man diese drei Stuͤke
nicht braucht, kann man sie so zusammenschieben, daß sie bequem eingepakt und in die
Kiste gebracht werden koͤnnen. Der obere Theil der Kiste und die
Mahagonytafel haben Laͤngeneinschnitte, durch welche das Laufband von dem
Laufrade auf die Rolle an der Doke der Drehebank laͤuft; und diese
Einschnitte werden auf Reisen durch Holzstuͤke geschlossen, die genau in
dieselben passen, und innerhalb der Kiste durch Dreheschieber befestigt.
Hr. Clint hat seinen Werktisch gern so, daß er bei der
Arbeit stehen kann, indem das Sizen eine Menge Krankheiten erzeugt, von welchen man
durch das Stehen frei bleibt.Anhaltendes Stehen erzeugt aber ebensoviele, nur andere Krankheiten: es ist
„das Leiden Christi auf eine andere Manier“ wie der
alte Kaͤstner sagte. A. d. U. Seine Elbogen stuͤzen sich auf zwei lederne Kissen, M, M, von ungefaͤhr 9 Zoll im Durchmesser und mit Kleien
ausgefuͤllt: seine Haͤnde haben also alle zu einer so feinen Arbeit
noͤthige Ruhe.
Die Doke seiner Drehebank steht auf einem netten Untersaze aus Gußeisen, N, der in Fig. 3. in halber
natuͤrlicher Groͤße dargestellt ist. Man sieht sie in dieser Figur in
halber natuͤrlicher Groͤße im Aufrisse von der Seite, und in Fig. 4. von
oben im Durchschnitte und im Grundrisse. Dieser Untersaz ist auf einem
keilfoͤrmigen Holzstuͤke aufgezogen, das unter demselben auf dem
Tische so befestigt ist, daß sein oberer Theil vorwaͤrts gegen den
Kuͤnstler gekehrt ist, wie man in Fig. 2. sieht. Die Doke,
O, in Fig. 3. und 4. ist aus
Stahl, der gehaͤrtet und temperirt ist. Sie laͤuft an ihrem vorderen
Ende verschmaͤlert zu, und hat eine Schulter; ihr hinteres Ende ist
walzenfoͤrmig, und laͤuft in einem walzenfoͤrmigen Loche,
welches sich in dem Ende einer staͤhlernen Schraube, P, befindet, die gleichfalls gehaͤrtet und temperirt ist, in eine
Schraubenmutter in dem Untersaze, N, paßt, und durch ein
Schraubenniet, Q, genau in ihrer Lage erhalten wird. Der
Boden des walzenfoͤrmigen Loches in der Schraube, P, ist flach, und das Ende der dagegen spielenden Doke ist etwas
zugerundet, oder convex, so daß es nur in seiner Mitte denselben beruͤhrt und
die Reibung dadurch sehr vermindert wird, wie es bereits vor vier Jahren im technical Repository (polytechn. Journ. B. XVII. S. 174.) empfohlen wurde.
Der Boden des Loches und das Ende der Doke sind beide sehr fein, in ihrem
Mittelpuncte polirt: dieß ist die Wirkung der von Hrn. Gill empfohlenen sinnreichen Vorrichtung. Das Vordertheil oder das
schmaͤlere Ende laͤuft in einem gespaltenen Halsbande von sogenanntem
Piuter, wie bei den Doken der Knopfpolirer, und laͤuft darin sehr schnell,
weil ein solches Halsband sich weniger erhizt, als ein staͤhlernes oder
messingenes. Dieses Halsband wird bereits vier Jahre lang gebraucht, und befindet
sich noch immer in einem vollkommen guten Zustande, da man stets dafuͤr
sorgte, daß keine harten und sandigen Theile in dasselbe
eindringen, und waͤhrend sie sich in den Piuter einlegen, die Doke zerkrazen.
Dieses Halsband aus Piuter ward auf der Doke selbst gegossen, nachdem jede Seite des
vorderen Endes des Standes, N, vorlaͤufig mit
Platten von verzinntem Eisenbleche gedekt wurde, die mit Loͤchern versehen
waren, welche auf die Doke an ihrem Untersaze paßten. Das Halsband wurde hierauf
horizontal mit der Saͤge durchschnitten, und wie gewoͤhnlich in zwei
Theile getheilt. Es wird auf dem Untersaze mittelst zweier ekigen Stuͤke oder
Baken vorne an seiner Stelle erhalten. Diese ganze Vorrichtung wird mittelst einer
Dekplatte und zwei Schrauben auf ihrem Plaze niedergehalten. Eine dritte Schraube,
die gleichfalls durch ein Loch in der Mitte der Platte laͤuft, druͤkt die oberste
Haͤlfte nieder, und macht dasselbe auch dann noch sich an die Doke
anschließen, wann eines oder das andere dieser Stuͤke sich abgenuͤzt
haͤtte.
Die Doke hat ein allmaͤhlich sich verschmaͤlerndes oder
kegelfoͤrmiges Loch, R, Fig. 4., das der
Laͤnge nach durch dasselbe laͤuft, und ein Querloch, oder einen
Ausschnitt, 8, an dem duͤnneren Ende dieses Loches, wie man in Fig. 3. und
4. sieht.
Das sich verschmaͤlernde oder duͤnn zulaufende Loch, R, dient zur Aufnahme der kegelfoͤrmig
zulaufenden Theile der Stiele der Werkzeuge, die den
Demantstaub fuͤhren. Eines dieser Werkzeuge ist in Fig. 5. in seiner vollen
natuͤrlichen Groͤße dargestellt. Es haͤlt in seinem
kegelfoͤrmigen Theile zwei Zoll, und an seinem
duͤnnsten Ende einen Viertelzoll; an seinem diksten Ende 1 Viertel und 1
Sechzehntel „(sic! auf deutsch fuͤnf
Sechzehntel)“ Zoll. Dieser Unterschied in der Dike der beiden Enden
reicht hin, um diese Werkzeuge fest genug in dem verduͤnnt zulaufenden Loche
der Doke steken zu lassen, und sie vor dem Lokerwerden waͤhrend des
Gebrauches zu sichern: sie koͤnnen, bei dieser Festigkeit, jedoch leicht
wieder herausgestoßen werden, wenn man einen Keil an dem inneren Ende anbringt,
welches in den Querdurchschnitt, S, in der Doke
hervorragt.
Diese Kegel werden alle in messingenen Modeln aus einer Blei-Composition
gegossen, in welcher dem Bleie zur Haͤrtung etwas Spießglanzkoͤnig
zugesezt wird, oder aus Letternmasse. Da die hierzu verfertigten Model sehr
sinnreich sind, und das Gelingen der Arbeit gar sehr von der Genauigkeit derselben
abhaͤngt, so will ich mit Erlaubniß des Hrn. Clint
denselben beschreiben.
In Fig. 6. ist,
T ein hoͤlzerner Blok, der in einem in seiner
Mitte angebrachten kreisfoͤrmigen Loche zwei messingene Baken, U, U, stuͤzt und aufnimmt, die einander
vollkommen gleich sind. Sie werden durch vier an der einen Haͤlfte
angebrachte festehende Zapfen oder Stellzapfen zusammen gehalten, indem diese in
vier mit denselben correspondirende Loͤcher in der anderen Haͤlfte
passen, wie Fig.
7. zeigt. Diese Figuren sind in halbem Maßstabe gezeichnet, oder in der
Haͤlfte ihrer natuͤrlichen Groͤße. In diese Baken, U, U, werden die aͤußeren Stiele, V der Werkzeuge Fig. 5. und 6. durch
Zufeilen eingepaßt; oder wenn sie sehr duͤnn seyn sollten, wird Papier um
dieselben gewikelt. Die Baken kommen hierauf senkrecht in das zu ihrer Aufnahme
verfertigte Loch, T, und der Stiel des Werkzeuges wird
gleichfalls in den Baken senkrecht gehalten. Die inneren vierekigen, ungleichen und
verduͤnnt zulaufenden Theile des Stieles der Werkzeuge werden dann in dem
Haupttheile des Models, W, eingeschlossen, Fig. 6., der
genau in Laͤnge und Groͤße mit dem verduͤnnt zulaufenden Loche in der Doke
correspondirt, und einen Stiel und hoͤlzernen Griff, X, eingepaßt hat. Der untere Theil des Models
hat einen Hals, der genau in eine Hoͤhlung in dem oberen Theile der Baken
paßt, und wenn der Model so gehalten wird, daß das spizige Ende des Stieles des
Werkzeuges in den Mittelpunct des Loches des Models kommt, wird das geschmolzene
Metall mittelst eines eisernen Loͤffels mit einer Lippe in den Model
gegossen, oder mittelst einer Tobakpfeife, welche das Metall aus dem
groͤßeren Loͤffel, in welchem es geschmolzen wird, in den Model
leitet, wo sie auch als Maßstab dient. Nachdem das Metall sich gesezt hat, wird der
Guß mittelst eines walzenfoͤrmigen eisernen Staͤngelchens aus dem
Model geschafft, das genau den Durchmesser des kleineren Endes des Models hat,
welches darauf gestuͤzt wird: man stoͤßt so lang sacht daran, bis der
Guß heraus getrieben wird. Man wird finden, daß der Guß sich bloß in dem Theile, W, des Models gebildet hat, dessen aͤußere Theile
unten hervorstehen koͤnnen, da sie spaͤter durch Feilen etc.
weggeschafft werden koͤnnen.
Fig. 8. zeigt
das untere oder weitere Ende des Models, W, in welchem
man einen Einschnitt, Y, sieht, der an der
Muͤndung desselben eingefeilt ist. Dieser Einschnitt erzeugt einen kleinen
unter einem Winkel hervorstehenden Theil auf dem breiteren Ende des Kegels, wie Z, in Fig. 5. zeigt. Dieser
Theil paßt dann in einen anderen ekigen Ausschnitt, der an der inneren Seite der
Doke, O, angebracht ist. Dieser Vorsprung hindert die
Werkzeuge, sich in der Doke loker zu drehen, und erhaͤlt sie innerhalb
derselben immer in derselben Lage, worauf gar sehr viel ankommt.
Die Werkzeuge, oder wenn man will, Meißel, sind alle aus dem weichsten Eisen,
entweder aus Hufnaͤgelstumpfen, die von Flintenlauf-Schmieden
zusammengeschweißt werden, oder aus Eisendraht, den man in gehoͤrige
Laͤngen zuschneidet und verduͤnnt zuschmiedet, dann in Buͤschel
zusammenbindet und vom Morgen, wo man das Feuer anzuͤndet, bis zum
naͤchsten Morgen ruͤkwaͤrts hinter dem Feuer eines
Kuͤchenherdes liegen laͤßt. Auf diese Weise bleibt der Draht den
ganzen Tag uͤber der Hize des Feuers ausgesezt, und kuͤhlt mit
demselben allmaͤhlich ab, so daß er dadurch vollkommen angelassen und zum
Gebrauche dienlich wird. Sie werden auf der Drehebank mittelst eigener Werkzeuge auf
der Doke, auf eine Ruhe gestuͤzt, abgedreht. Die Hauptstange dieser Ruhe
laͤuft durch ein Loch, das in der Stuͤze der Lade sich findet, wie die
punctirten Linien in Fig. 3. zeigen, und ist auf die an den Lacashireladen gewoͤhnliche
Weise auf einer Querleiste aufgezogen und mittelst Schrauben gestellt. Ihre
Hauptstange wird durch die Bindschraube, a, Fig. 3. in dem
Untersaze befestigt. Die Formen der Werkzeuge sieht man im Allgemeinen an einem derselben in
Fig. 9. in
natuͤrlicher Groͤße: es ist das groͤßte, das man braucht. V, ist ein Theil des Stieles, auf dessen aͤußerem
Ende das Werkzeug, b, aufgeschraubt wird. Die Peripherie
dieses Werkzeuges ist kegelfoͤrmig, oder vorne schmaͤler als hinten.
Der Theil, der davon gebraucht wird, ist mit, c, d,
bezeichnet, und die Kanten, e, und, f, sind zugerundet. Man gibt ihm diese Form, weil man
den Stein bei dem Schneiden nothwendig unter einem Winkel gegen dasselbe halten muß,
damit er nicht mit dem Stiele desselben in Beruͤhrung kommt.
Die Werkzeuge in Fig. 10. und 11. sind beinahe so, wie
das in Fig.
9., gestaltet, sind, aber kleiner, und man braucht noch kleinere.
Fig. 12. ist
ein Meißel mit einem doppelten Rande, den man zur Schattirung des Grundes eines
Schildes etc. braucht, wo die Linien parallel und gleich weit von einander entfernt
seyn muͤssen: der Meißel zeichnet hier eine zweite Linie vor, waͤhrend
er die erste schneidet. Diese kleineren Meißel sind jedoch nicht so, wie in Fig. 9., auf
das Ende eines Stieles aufgezogen, sondern sind aus einem Stuͤke mit
denselben auf der Drehebank gedreht.
Die Steine, welche geschnitten werden sollen, sind rothe oder weiße (?) Carneole,
denen der Steinschneider die Form gegeben hat. Man nimmt diesen Steinen zuerst ihre
Politur mittelst Schmergels und Wassers, womit man eine flache Piuter Platte
bestreicht, an welcher man den Stein abreibt, nachdem man denselben auf einem
hoͤlzernen Griffe, wie in Fig. 13., gehoͤrig
aufgekittet hat. Die Umrisse der Zeichnung werden mittelst eines zugespizten
Messingdrahtes gezogen, der trefflich zu diesem Zweke dient. Nun wird der Stein
geschnitten. In dieser Absicht bringt der Graveur etwas von dem mit Oehle
abgeriebenen Demantstaube, den er von den oben erwaͤhnten staͤhlernen
Reibwerkzeugen nimmt, mittelst eines aus einem Federkiele geschnittenen
Loͤffelchens, auf den Umfang des Meißels, welcher Staub sich in das weiche
Eisen, aus welchem der Meißel verfertigt ist, fest einlegt. Der Demantstaub wurde
mit Baumoͤhl abgerieben; der Meißel wird aber waͤhrend der Arbeit
bestaͤndig mit sogenanntem Ziegeloͤhle (oil of bricks) schluͤpfrig gemacht, einem
brennzeligen vegetabilischen Oehle, welches die Chemiker eigens zu diesem Gebrauche
dadurch bereiten, daß sie roth gluͤhende Ziegel in Oehl eintauchen, und diese
das Oehl einsaugen lassen, hierauf aber die Ziegel destilliren. Dieses Oehl wird in
einem kegelfoͤrmigen Gefaͤße aus verzinntem Eisenbleche aufbewahrt,
welches in, das obere Ende eines anderen Kegels eingeloͤthet wird, wie Fig. 14.
zeigt, wo dann dieser Kegel als Untersaz dient, damit es fester steht. Hr. Clint hat in dieser Absicht einen solchen Kegel in einen
kupfernen Reifen gestellt, und innenwendig mit geschmolzenem Bleie
ausgefuͤllt, mit
welchem er ihn auch von außen in dem Reife umgeben hat.
Es ist eine Thatsache, daß die feine Arbeit des Siegelstechens mehr durch das
Gefuͤhl, als durch das Auge vollendet wird: denn das Werkzeug, womit
gearbeitet wird, hindert das Auge am Sehen, und die von dem Steine abgeschliffenen
Theilchen, so wie das Oehl, das von dem Werkzeuge oder Meißel abfließt, bilden auf
dem Steine einen undurchsichtigen Flek, durch welchen der Blik nicht durchzudringen
vermag. Die durch die Arbeit selbst hervorgebrachte Wirkung laͤßt sich nur
dadurch beurtheilen, daß man bestaͤndig Abdruͤke von dem geschnittenen
Stuͤke auf Bienenwachs macht, das man mit befeuchtetem Elfenbeinschwarz
gemengt hat, und gegen den Stein andruͤkt. Der Griff, auf welchem der Stein
ausgekittet ist, wird in der rechten Hand gehalten, die sich auf den Arbeitstisch
stuͤzt. Der Stein wird ferner mittelst der linken Hand geleitet und fest
gehalten, deren Flaͤche auf einer convexen Metallplatte ruht, mit welcher,
wie man in Fig.
1. in punctirten Linien sieht, der obere Theil der Drehelade bedekt ist.
Auf diese Weise ist der Arbeiter vollkommen Herr uͤber den Stein, und kann
denselben waͤhrend der Arbeit in jede beliebige Lage bringen.
Der Kuͤnstler schaͤrft sein Auge mittelst eines
Vergroͤßerungsglases von anderthalb Zoll Brennweite, das so wie das
Handvergroͤßerungsglas der Uhrmacher und Kupferstecher etc. aufgezogen ist.
Die Linie ist naͤmlich in einem Ringe, in welchen ein Eisendraht sich endet,
aufgezogen; und dieser Draht laͤuft durch ein horizontales Loch, welches in
einer hoͤlzernen Kugel von drei Zoll im Durchmesser sich befindet, durch
welche noch ein anderes Loch unter einem rechten Winkel mit dem vorigen
durchlaͤuft. In dieses Loch paßt ein anderer Draht, der an einem schweren
metallnen Fußgestelle befestigt ist, welches drei Naͤgel oder Schrauben an
seiner flachen Unterflaͤche hat, damit es desto fester steht. Diese Drahte
werden in den Loͤchern der Kugel mittelst Bindschrauben fest gestellt. g, in Fig. 1. und 2. zeigt diesen
Apparat. Fig.
14 zeigt ihn im Grundrisse, und Fig. 15. zeigt die untere
Flaͤche desselben.
Nachdem die Arbeit vollendet ist, muß die Oberflaͤche des Steines wieder
polirt werden. Dieß geschieht gewoͤhnlich mittelst einer flachen Platte von
Piuter, die in einem besonderen Gestelle auf einer senkrechten Achse aufgezogen ist,
und von einem Laufrade mittelst einer Schnur in Umtrieb gesezt wird. Hr. Clint hat aber diese Vorrichtung an seinem tragbaren
Gestelle selbst angebracht, wo sie von derselben Schnur in Bewegung gesezt wird, die
seine Meißel oder Werkzeuge treibt. In Fig. 1. und 2. ist diese
Piuterplatte bei, h, dargestellt; die Achse derselben
laͤuft in einem Loche, und ruht auf dem oberen Ende einer Stellschraube, die
in die Querleiste, i, des Gestelles, A, A, eingelassen ist. Das obere Ende dieser Achse wird
von einem Zapfen gestuͤzt, der in einem eisernen Arme oder Buͤgel
angebracht ist, j, welcher mittelst Schrauben oben auf
dem Rahmen gehoͤrig befestigt wird. Der Zapfen tritt in ein Loch, das oben in
der Achse angebracht ist. Ein Band laͤuft von dem Rade, B, unter einer der zwei messingenen Rollen, K, hin, Fig. 2., die sich in einer
eigenen Kapsel befinden, und dann uͤber die Rolle zu dem Querl oder der Rolle
auf der Achse der Kappe, die sie zum Theile umgibt, und steigt dann oben auf eine
andere Rolle, K, hinauf, von welcher sie auf den Umfang
des Rades, B, herabsteigt, und also gehoͤrig
getrieben wird. Die Politur wird mittelst Ziegelmehles (?) (zerfallenen Steines, rotten stone) und Wasser gegeben, das man auf die flache
obere Flaͤche der Polirscheibe auftraͤgt: das Ziegelmehl (rotten stone) muß sorgfaͤltig von allen groben
oder sandigen Theilchen, mit welchen es gewoͤhnlich vermengt ist, befreit
werden; diese muͤssen daher ausgelesen werden. Damit das Wasser mit dem
Ziegelmehle nicht versprizt, ist die Polirplatte mit einer zinnernen Buͤchse
umgeben, deren unterer Theil mit einem Loche in seiner Mitte versehen ist, damit die
Achse der Polirscheibe durch kann, ehe man die Rolle darauf sezt. Der Dekel der
Buͤchse hat einen Einschnitt oben und an der Seite, der bis in die Mitte
desselben laͤuft, damit die Achse bei dem Schliessen der Spindel durch kann.
Dieser Einschnitt wird mittelst eines zinnernen Schiebers geschlossen, der in
Furchen laͤuft, welche an dem Dekel zu diesem Ende angebracht sind. Fig. 16. zeigt
diese Buͤchse im Aufrisse und Fig. 17. von oben.
Die schneidenden Werkzeuge laufen außerordentlich schnell. Sie machen 10 Umdrehungen,
waͤhrend das Laufrad, B, eine macht. Die besten
Demante zu dieser Arbeit sind die schwarzen und rauhen, die von den Juwelieren
weggeworfen werden. Hr. Clint sagte mir, daß er einmahl
einen anderen Demant hatte, der aus einem anderen Grunde weggeworfen wurde, weil er
naͤmlich so hart war, daß man keinen anderen fand, der ihn haͤtte
schleifen koͤnnen.
Glas kann nicht auf diese Weise geschnitten werden, weil das Glas macht, daß die
Theilchen des Demantstaubes die Werkzeuge selbst angreifen. Glas wird mittelst
Schmergels geschnitten, den man auf kupfernen Meißeln auftraͤgt.
Formen von Thieren und sehr artige krumme Linien lassen sich durch diese
kreisfoͤrmigen Werkzeuge sehr leicht in Stein schneiden. In Stahl hingegen
werden flache und vierekige Formen leichter dargestellt, weil hier mittelst Punzen
und Meißeln gearbeitet wird. Daher sind auch Steinschnitte schoͤner, als
Stahlschnitte. Die Weise selbst, wie gearbeitet wird, laͤßt den
Kuͤnstler weit kleinere Gegenstaͤnde darstellen, als bei einem anderen
Verfahren nicht moͤglich ist.
Tafeln